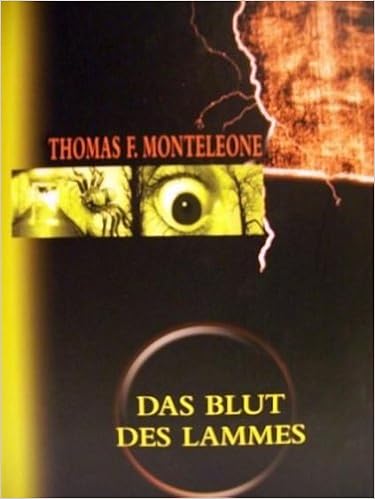|Per Helge Sorensen ist Spezialist für Internetsicherheit und Kryptographie. Mit [„Intrigenspiel“ 1590 hat Lübbe seinen zweiten Roman in die deutschen Buchläden gebracht, der komplexer ist als sein Vorgänger „Mailstorm“, aber erneut faszinierende Blickwinkel auf die Abgründe der Multi-Media-Gesellschaft eröffnet. Grund genug, um einige neugierige Fragen nach Dänemark zu schicken:|
_Alf Stiegler:_
Wie lange hast du an „Intrigenspiel“ gearbeitet und was war der schwierigste Teil seiner Entstehung?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe an dem Roman volle eineinhalb Jahre gearbeitet. Der schwierigste Teil war definitiv der Anfang. Ich musste den ersten Abschnitt mehrere Male neu schreiben, um die richtige Energie in die ersten Kapitel zu bekommen. Außerdem hatten die ersten fünf Kapitel ursprünglich 120 Seiten. Ich habe sie auf nur 70 Seiten heruntergekürzt.
_Alf Stiegler:_
Wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die du von „Mailstorm“ bis zum aktuellen „Intrigenspiel“ durchlaufen hast?
_Per Helge Sørensen:_
Mailstorm ist ein recht traditioneller Thriller – trotz der Handlungsplattform Internet. Irgendjemand wird auf Seite sieben umgebracht und die Hauptfigur hat herauszufinden, warum. Verglichen dazu ist „Intrigenspiel“ ein viel komplexerer Roman. Es gibt keinen Mord, der den Plot vorantreibt. Und die Story ist aus vier verschiedenen Perspektiven heraus erzählt. Außerdem hat sich die Sprache verändert: von der traditionellen, kompakten Thrillersprache in „Mailstorm“ zur ausgefeilter satirischen Sprache in „Intrigenspiel“.
_Alf Stiegler:_
Sind deine Storys schon fertig konstruiert, wenn du zu schreiben beginnst? Oder ziehst du es vor loszuschreiben, um dann zu sehen, wohin dich die Geschichte führt?
_Per Helge Sørensen:_
In Mailstorm kannte ich den kompletten Plot, als ich zu schreiben begann, in „Intrigenspiel“ waren es stattdessen anfangs etwa 2/3 der Handlung. Ich hatte keine Vorstellung, wie die Geschichte enden würde. Sollte Herman verhaftet werden? Sollte er verurteilt werden? Ich war darüber wirklich ein wenig beunruhigt, aber als ich den Punkt erreicht hatte, wo nichts mehr geplant war, hatte ich keine Probleme damit. Das letzte Drittel der Story hat sich praktisch von selbst geschrieben.
_Alf Stiegler:_
Bist du als Autor eher ein „einsamer Wolf“ oder engagierst du dich in deiner lokalen Literatur-Szene?
_Per Helge Sørensen:_
Ich bin eingebunden in die lokale Autorengemeinschaft. Tatsächlich war ich ein Jahr Vorsitzender der dänischen Autorengemeinschaft (von 2004 bis 2005). Aber diese Arbeit betrifft hauptsächlich politische Themen: Vertragsverhandlungen mit Verlegern, Entschädigungen von öffentlichen Bibliotheken an Autoren usw. Was mein Schreiben betrifft, bin ich allerdings ein „einsamer Wolf“.
_Alf Stiegler:_
Wie bist du überhaupt mit Literatur und dem Schreiben in Berührung gekommen?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe 1998 für das dänische Ministerium gearbeitet, Internet- und Sicherheitsfragen betreffend. Irgendwann war ich einfach überarbeitet und musste verschwinden. Also habe ich mir ein Flugzeugticket gekauft, um mich in Kuba für sechs Monate zu entspannen. Dort dachte ich mir dann, dass es durchaus den Versuch wert wäre, über manche der Themen einen Roman zu schreiben, die ich im Ministerium bearbeitet habe (Kryptographie etwa, die ja auch in „Mailstorm“ eine Rolle spielt). Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte.
_Alf Stiegler:_
Wie wichtig waren deine „digital-rights“-Arbeiten für den Schreibprozess von „Intrigenspiel“ und wie sehr beeinflussen sie deine Autorenarbeit überhaupt?
_Per Helge Sørensen:_
Politik ist ein wichtiger Motor für mein Schreiben. „Mailstorm“ ist auf der Basis von Diskussionen entstanden, die sich um Internetüberwachung und Kryptographie gedreht haben. Eines der wichtigsten Themen in „Intrigenspiel“ ist „freie Meinungsäußerung vs. Pornographie und kontroverse Inhalte“. In dem Zusammenhang sind die Arbeiten, die ich für „digital rights“ verfasse, wichtige Inspirationsquellen.
_Alf Stiegler:_
Beide deiner Bücher behandeln den Missbrauch von Medien – besonders das Internet. Ist dieses Thema dir ein brennendes Anliegen?
_Per Helge Sørensen:_
Auf jeden Fall. Das Internet ist ein sehr mächtiges Medium. Das erste Mal in der Geschichte können sich normale Bürger der ganzen Welt darstellen, ohne von irgendwem zensiert zu werden. Und sie können sich mit Gleichgesinnten austauschen – über den kompletten Globus. Aber die Gesellschaft ist es nicht gewöhnt, mit einer solchen Freiheit umzugehen, vor allem nicht, wenn diese Freiheit dazu verwendet wird, Informationen zu verbreiten, die wir als kontrovers ansehen oder sogar als gefährlich. Wie die Gesellschaft mit dieser Freiheit umgehen soll, ist ein wichtiges Thema der Demokratie. Zum Beispiel: Sollten wir Informationen darüber verbieten, wie man Verbrechen begehen kann (wie man Bomben bauen kann etwa), oder sollen wir nur die Verbrechen selbst verbieten?
_Alf Stiegler:_
Wie viele Erfahrungen aus deinem Alltagsleben haben ihren Weg in „Intrigenspiel“ gefunden? Das Leben von Kristian Nyholm zum Beispiel, oder der Umgang, den die Journalisten des Dagbladet miteinander pflegen – es wirkt so „echt“, dass man es beinahe fühlen kann. Ist das deiner Vorstellungskraft entsprungen, oder gestattest du dem Leser hier Einblicke in frühere Abschnitte deines Lebens?
_Per Helge Sørensen:_
Nyholms Figur basiert tatsächlich auf Erfahrungen, die ich während meiner Arbeit im dänischen Ministerium gemacht habe. Und praktisch alle Szenen mit der Journalistin Camilla sind aus meinen Erfahrungen mit Journalisten entstanden, Erfahrungen, die ich sammeln konnte, wenn ich Interviews über digital rights gegeben habe usw. „Intrigenspiel“ ist sehr stark vom „wirklichen Leben“ beeinflusst.
_Alf Stiegler:_
Aufklärung vs. Unterhaltung; was ist dein wichtigster Schreib-Antrieb?
_Per Helge Sørensen:_
Ich würde sagen, Aufklärung. Aber natürlich muss es auch unterhaltsam sein, sonst verliert man seine Leser.
_Alf Stiegler:_
Ich persönlich mochte es, wie du mit Definitionen gespielt hast, das „Spiel der großen Worte“, wie es Kristian Nyholm genannt hat; Ich schätze, Luhman wäre stolz auf dieses „Man gestaltet die Realität, indem man sie formuliert“. War das deine Absicht?
_Per Helge Sørensen:_
Ich würde gerne sagen, dass dem so ist … Aber … wirklich: Ich habe nie viel von Luhmann gelesen. Ich kenne mich mit Mathematik und dem Ingenieurswesen aus. Das Luhman-Zeug in „Intrigenspiel“ basiert auf ein paar oberflächlichen Blicken, die ich auf die Diplomarbeit eines Freundes geworfen habe. Hm. Trotzdem freut es mich, dass dir das „Spiel der großen Worte“ gefällt. Ich bin auch ziemlich stolz darauf.
_Alf Stiegler:_
Was hältst du überhaupt von Cyberpunk und Science-Fiction? Eher eine Erweiterung des geistigen Horizonts oder Verschwendung von Gehirnkapazität?
_Per Helge Sørensen:_
Wenn es gut gemacht ist, mag ich es sehr gerne. Gibson ist natürlich der Meister. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Art von Romanen, die ich hauptsächlich lese. David Mitchell kann ich wärmstens empfehlen – er verbindet Zeitgenössisches mit SF, Cyberpunk und vielen anderen Einflüssen. „Cloud Atlas“ und „Number9Dream“ sind die besten Bücher, die ich seit Jahren gelesen habe.
_Alf Stiegler:_
Okay, lass uns mal etwas spekulieren: Es gibt die Hypothese, dass wir bereits in einer virtuellen Realität leben. Diese Idee wurde von Moores Gesetz abgeleitet: Wenn Computer alle drei Jahre ihre Prozessor-Kapazitäten verdoppeln, wären wir vielleicht irgendwann in der Lage, perfekte Kopien unserer Realität anzufertigen. Solche virtuellen Realitäten hätten dann die Aufgabe, Konsequenzen von Projekten und Handlungen zu ergründen – ein Was-wäre-wenn-Simulator sozusagen.
Aber falls Moores Gesetz tatsächlich so etwas ermöglichen sollte, gäbe es in der Zukunft eine unvorstellbare Menge solcher virtuellen Realitäten – und der Wahrscheinlichkeitsrechnung entsprechend wäre es viel wahrscheinlicher, in einer dieser virtuellen Realitäten zu leben – nicht etwa in der „wirklichen Realität“. Was hält ein IT-Spezialist von solchen Spekulationen?
_Per Helge Sørensen:_
Hm. Interessant. Kann ich einen Freund anrufen?
Nun, ich denke, die Idee ist einfach aufregend, dass wir in einer „gefälschten“ virtuellen Realität existieren könnten. Natürlich ist das auch ein hervorragender Aufhänger für eine Story. Ich glaube, das ist ein sehr grundsätzlicher Menschheitstraum: Es muss einfach mehr geben, wir leben nicht in der wirklichen Welt und es gibt eine Hintertür zu irgendeinem fremden Ort. Es ist wie der Traum vieler Kinder: Die eigenen Eltern sind nicht die echten Eltern, tatsächlich ist man der Sohn eines Königs, und der wird eines Tages kommen, um einen abzuholen. Wie auch immer, meistens stellt sich heraus, dass deine Eltern auch tatsächlich deine Eltern sind. Es stellt sich heraus, dass man hart arbeiten muss, um diese Hintertür zu finden, hinaus in eine Welt voller Magie.
Um zu den virtuellen Realitäten zurückzukehren: So leid es mir tut, dort gilt genau das Gleiche. Diese Welt ist, so fürchte ich, die wirkliche Welt. Aber wenn man hart genug arbeitet, kann man sich die Magie für sich selbst erschaffen.
Um auf die technischen Aspekte einzugehen: Was ist mit den Computern, in denen diese virtuellen Welten existieren sollen? Diese Computer müssten ja Teil der „wirklichen Welt“ sein. Aber müssten sie nicht genauso in der virtuellen Welt existieren? Müsste in dieser virtuellen Welt (einer perfekten Kopie unserer Welt!) nicht ein virtueller Computer existieren, der wiederum diese virtuelle Welt enthalten müsste? (Kann Gott der Allmächtige einen Felsen erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann?)
_Alf Stiegler:_
Was hältst du vom „Transhumanismus“ und der dort vertretenen These, dass es eines Tages Super-Intelligenzen geben wird, die über den normalen Menschen bestimmen werden?
_Per Helge Sørensen:_
Ich bin ein Skeptiker. Ich habe während meines Studiums ein wenig mit künstlichen Intelligenzen gearbeitet. Obwohl die Geschwindigkeit der Prozessoren und die Speicherkapazität explodieren, sind Computer immer noch ziemlich dumm. Es ist ein Albtraum, wenn man auch nur versucht, einen Computer menschliche Sprache erkennen zu lassen. Rechner dazu zu bringen, eben Gesagtes auch zu |verstehen|, ist noch immer reine Zukunftsmusik. Man darf keinesfalls unterschätzen, wie komplex der menschliche Geist ist!
_Alf Stiegler:_
Andererseits: Die meisten exponentiellen Funktionen flachen irgendwann ab und Moores Gesetz wird es wahrscheinlich irgendwann genauso ergehen. Glaubst du, dass der Gipfel der Computerentwicklung schon an unsere Tür klopft?
_Per Helge Sørensen:_
Nein. Obwohl die technische Entwicklung sich durchaus verlangsamen könnte, glaube ich, dass es ein gewaltiges Entwicklungspotenzial gibt – neue Wege, wie man Computer oder das Internet nutzen kann. Ich würde sogar sagen, dass wir bisher nicht einmal die Spitze des Eisbergs gesehen haben.
_Alf Stiegler:_
Wie sieht es mit DNA-Computern aus? Handelt es sich dabei noch um Science-Fiction, oder greifen Ingenieure bereits auf diese Idee zurück?
_Per Helge Sørensen:_
Momentan ist das noch reine Science-Fiction. Aber das Bild-Telefon war ebenfalls Science-Fiction, als ich noch ein Kind war. Man braucht ja nur einen Blick auf Star Trek werfen … und einen Vergleich zum neuesten Nokia-Handy ziehen.
_Alf Stiegler:_
Neal Stephensons „Snow Crash“ behandelt auf faszinierende Weise eine „Vermählung“ von Religion mit einer ultra-modernen, Technik-geprägten Gesellschaft. Glaubst du, dass es noch Platz für eine Seele in unserer „postreligiösen Gesellschaft“ gibt?
_Per Helge Sørensen:_
Ich denke, es gibt eine Menge Seele in der postreligiösen Gesellschaft: Die Seele innerhalb eines jeden menschlichen Individuums. In meinen Augen ist Religion hauptsächlich eine Ausrede, die (meist von alten Männern) benutzt wird, um das Leben anderer Menschen zu kontrollieren.
_Alf Stiegler:_
„Sex mit Kindern ist der Ersatz, den die postreligiöse Gesellschaft für Blasphemie gefunden hat.“ – Wahr und zynisch. Was hat dich zu dieser Ansicht geführt?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe nach etwas gesucht, das den modernen, säkularen Menschen auf die selbe Weise vor den Kopf stößt, wie sich Muslime durch Kritik an ihrer Religion vor den Kopf gestoßen fühlen. Pädophilie ist mir als einziges Problem eingefallen. Vielleicht liegt das daran, dass Kinder für viele Menschen den Platz von Gott eingenommen haben – das wichtigste Ziel im Leben.
_Alf Stiegler:_
Kontrolle vs. Entscheidungsfreiheit. Würdest du eine Softwarelösung unterstützen, die „grenzüberschreitende Internetpornographie“ aus dem Internet filtern kann, eine Softwarelösung, wie sie die Softwarespezialisten von Kyner vorgeschlagen haben? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage …
_Per Helge Sørensen:_
Das Schlüsselwort ist „grenzüberschreitend“. Kyner erzeugt die Illusion, dass es derart extreme Pornographie gibt, dass wir sie loswerden müssen. Obwohl es zweifellos |nicht| illegal ist (also Pädophilie, etc.)! Was Kyner tatsächlich sagt ist, dass diese Art von Information illegal sein |sollte| – aber solange wir damit nicht durchkommen (wegen irgendwelchem demokratischen Bockmist über „freie Meinungsäußerung“), versuchen wir dergleichen auf andere Weise zu ächten: über Filter.
Indem Kyner Worte verwendet wie „grenzüberschreitend“, erzeugt er die Illusion, dass es ein Problem gibt, welches wir zu lösen haben. Obwohl es keines gibt. Übrigens verwendet die EU-Kommission den Begriff „schädlicher Inhalt“.
Tatsächlich ist die Sache ganz einfach: Es gibt zwei Arten von Inhalten:
– illegale Inhalte, um die sich die Polizei und die Gesetze zu kümmern haben,
– legale Inhalte, die man in Ruhe lassen sollte.
Es gibt keinen Grund für Filter.
_Alf Stiegler:_
Was sind deiner Ansicht nach die widerlichsten Entwicklungen der Multi-Media-Unterhaltung?
_Per Helge Sørensen:_
Wenn Streitkräfte die Sprache und Bilder der Spieleindustrie verwenden, um Soldaten zu rekrutieren. Die dänischen Streitkräfte veröffentlichen beispielsweise eine monatliche Broschüre, die wie Werbung für Counter Strike aussieht. Die US-Streitkräfte haben sogar ihr eigenes Rekrutierungs-Spiel entwickelt. Krieg ist kein Computerspiel. Die Streitkräfte sollten es am besten wissen.
_Alf Stiegler:_
Die dänische Literatur hat es schwer, sich einen Weg in deutsche Buchgeschäfte zu bahnen. Hast Du ein paar Underground-Tipps für Skandinavien-hungrige Sørensen-Süchtige?
_Per Helge Sørensen:_
Es gibt einen neuen Roman von Morten Ramsland. In Dänemark war er sehr erfolgreich und wird wahrscheinlich demnächst in Deutschland veröffentlicht. Uneingeschränkte Leseempfehlung!
Falls eher Kriminalromane bevorzugt werden, sollte man Sara Blaedel antesten. Sie ist die neue, dänische „Queen of Crime“.
_Alf Stiegler:_
Welche Lektüre ziehst du persönlich vor?
_Per Helge Sørensen:_
Im Moment lese ich eine Menge zeitgenössische Literatur aus England und Amerika. Allan Hullinghurst. David Mitchell (wie oben schon erwähnt). Jonathan Franzen. Poul Auster. Und den japanischen Guru natürlich: Haruki Murakami.
_Alf Stiegler:_
Gibt es eine Genre, von dem du die Finger lässt?
_Per Helge Sørensen:_
Als ich 13 war, habe ich eine Menge Fantasy gelesen. Ich denke, ich habe genug für den Rest meines Lebens.
_Alf Stiegler:_
Die dritte Veröffentlichung ist die Magische, sagt man im Musikgeschäft. Was dürfen wir von deiner dritten Veröffentlichung erwarten?
_Per Helge Sørensen:_
Den „Großen Dänischen Roman“, der sich mit all den wichtigen Themen der letzten 30 Jahre befasst, in Dänemark, Europa und dem Rest der Welt. Oder um es anders auszudrücken: Ich weiß es noch nicht. 😉
_Alf Stiegler:_
Ein paar letzte Worte für die Leser von Buchwurm.info?
_Per Helge Sørensen:_
Hört nicht auf zu lesen. Die magische Welt ist da draußen.