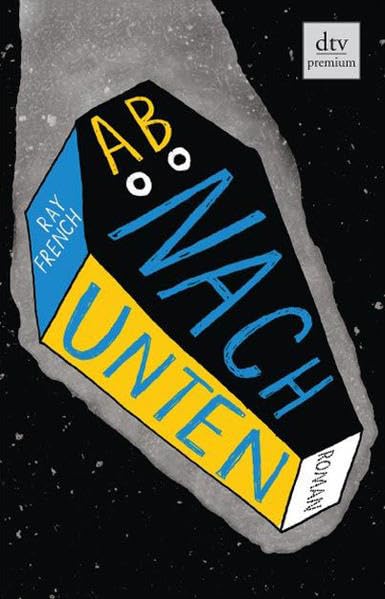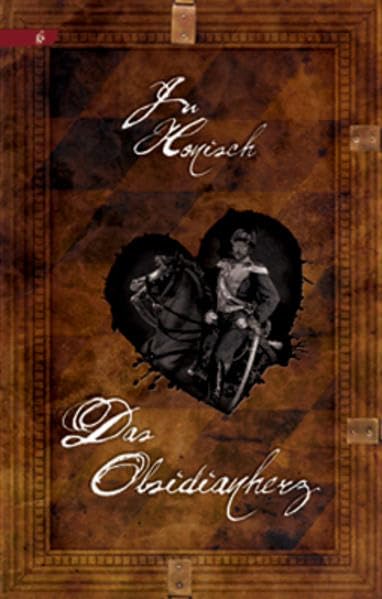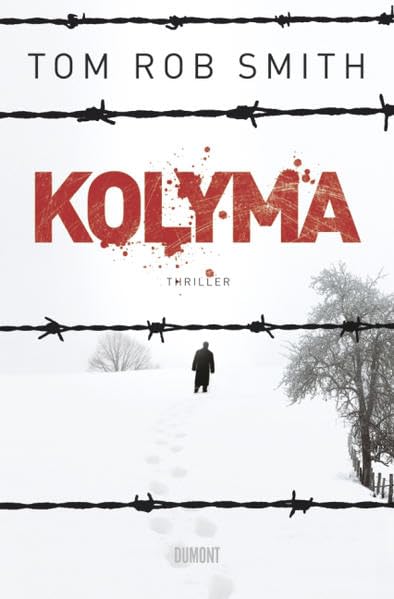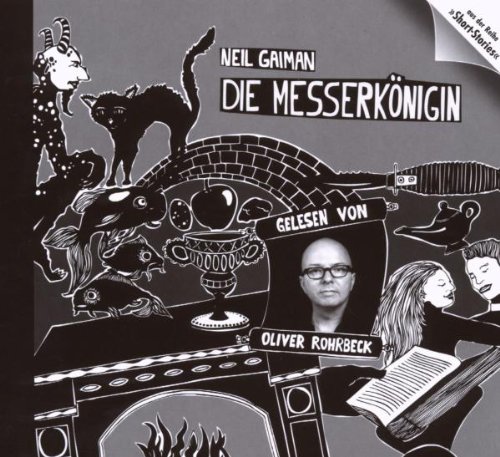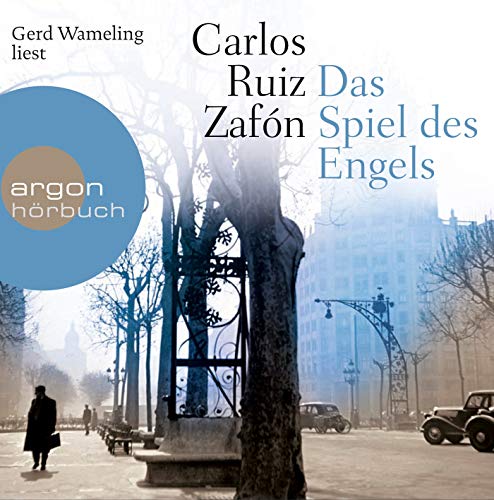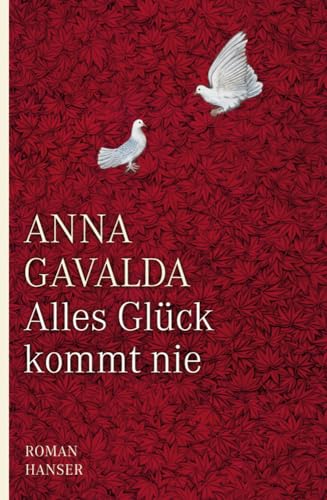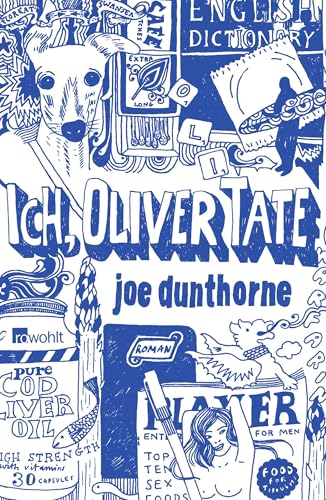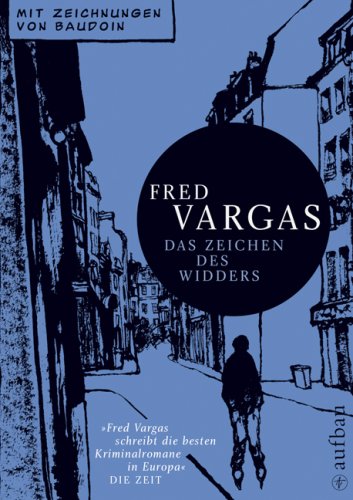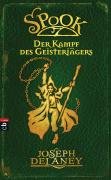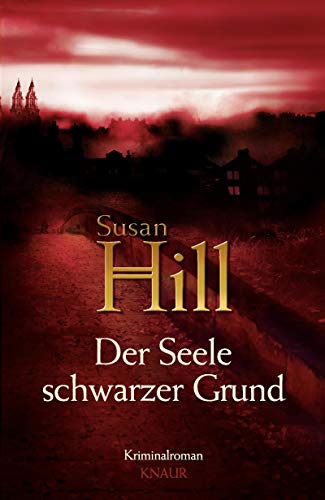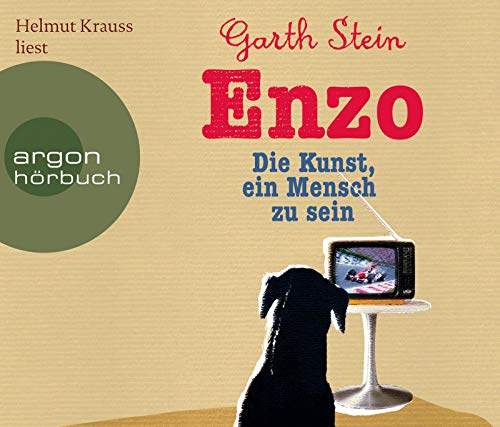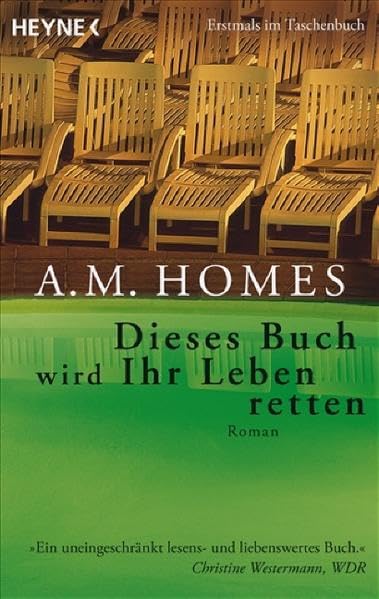Es gleicht schon einer Sensation, was Alan Bradley mit seinem ersten Roman auf die Beine gestellt hat. Bereits vor Erscheinen des Buches wurde „Flavia de Luce – Mord im Gurkenbeet“ mit dem renommierten Dagger Award für das beste Krimidebüt geehrt – und das lediglich auf der Basis des ersten Kapitels, da der Roman zum Zeitpunkt der Preisverleihung noch gar nicht fertiggestellt war. Das sind reichlich Vorschusslorbeeren, die zwar einerseits dafür sorgen, dass man seine Erwartungen nicht unbedingt tief stapelt, andererseits schwingt bei so viel Lobhudelei aber auch immer eine gewisse Skepsis mit. Kann „Flavia de Luce“ all die Erwartungen halten, die man in den Roman steckt?
_England, Anfang_ der 50er Jahre. Die elfjährige Flavia de Luce lebt zusammen mit ihren beiden älteren Schwestern Ophelia und Daphne und ihrem Vater auf dem altehrwürdigen Herrensitz Buckshaw. Flavia ist Hobbychemikerin und verbringt einen Großteil ihrer Zeit im Labor, das einer ihrer Vorfahren auf Buckshaw eingerichtet hat. Flavias große Leidenschaft gilt dabei Giften aller Art.
Dieses Wissen ist ihr unverhofft von Nutzen, als sie eines Morgens in aller Frühe im Gurkenbeet eine Leiche entdeckt. Jeder hält Flavias Vater für den Mörder und auch Flavia selbst kann sich von diesem Verdacht nicht ganz befreien, hat sie doch Abends vorher ihren Vater und den Toten lauthals streiten hören. Doch Flavia will an die Unschuld ihres Vaters glauben und stellt kurzerhand eigene Ermittlungen an.
Auf ihre kindlich unschuldige Art fragt sie allen Beteiligten und Zeugen Löcher in den Bauch, recherchiert in der örtlichen Bibliothek und durchsucht das Zimmer des Mordopfers. Sie folgt hartnäckig jeder noch so kleinen Spur und zieht in ihrer messerscharfen, rationalen Art so klare Schlussfolgerungen, dass der ermittelnde Inspektor Hewitt eigentlich vor Neid blass werden müsste.
Ihre Ermittlungen bringen Flavia auf die Spur eines alten Geheimnisses, in das auch ihr Vater verwickelt zu sein scheint. Als Flavia dann der Wahrheit ein gutes Stück näher kommt, wird es auch schon bald brenzlig für die junge Nachwuchsdetektivin …
_Die großen Erwartungen_ an „Flavia de Luce – Mord im Gurkenbeet“ sind nicht unberechtigt. Alan Bradleys Debütroman ist in der Tat eine Bereicherung für das Genre. Natürlich erfindet Bradley nicht das Rad neu, aber mit Flavia de Luce hat er eine Titelheldin geschaffen, die vom Fleck weg sympathisch ist und in ihrer präzisen und hartnäckigen Ermittlungsarbeit und ihren messerscharfen Schlussfolgerungen ein jugendliches Detektivtrio wie die Drei ??? ganz schön alt aussehen lässt.
Flavia de Luce wirkt in ihrer kindlich unschuldigen Neugier wie eine junge Miss Marple – nur, dass sie obendrein noch eine begnadete Chemikerin ist. Raffiniert setzt Flavia sich auf ihre ganz eigene Art mit ihren Schwestern und deren ständigen Versuchen sie zu Schikanieren auseinander. Da mischt sie der großen Schwester auch schon mal Gift in den innig geliebten Lippenstift und dokumentiert die Ergebnisse dieses Versuchs mit wissenschaftlicher Präzision in ihrem Tagebuch.
Flavia ist eine Außenseiterin. Freunde scheint sie keine zu haben. Ihre beste Freundin ist Gladys, ihr Fahrrad. Ihr Lieblingsort ist ihr Labor. Flavia macht einen schrägen, etwas verschrobenen Eindruck. Im Vergleich zu ihren Schwestern schlägt sie etwas aus der Art, aber genau das macht sie so herrlich sympathisch. Man braucht keine zehn Seiten, um sie zu mögen.
Und so ist es insbesondere auch Flavias Art und ihre Sicht der Welt, die für das besondere Lesevergnügen sorgt. Gewitzt und ironisch erzählt Bradley von Flavias Ermittlungen und es ist eben auch der schräge Kontrast der Giftmischerin, die sich hinter der unschuldigen, kindlichen Fassade verbirgt, der den Charme der Geschichte ausmacht.
Der Fall entwickelt sich dabei durchaus spannend. Flavia sammelt eifrig Aussagen und Indizien und kommt schon bald auf die Spur der wahren Hintergründe der Tat. Doch Flavias Ermittlungen dienen nicht nur dazu ein Verbrechen aufzuklären, sie sorgen auch für eine ganz ungewohnte Nähe zwischen Vater und Tochter in einem ansonsten eher unterkühlten Familienleben.
Der Vater, Colonel de Luce, weiß nach dem Tod seiner Frau nicht so Recht etwas mit den drei Töchtern anzufangen. Um das Wohlergehen der Kinder scheint sich eher die Haushälterin Mrs. Mullet zu kümmern, während der Vater sich lieber im Arbeitszimmer hinter seiner Briefmarkensammlung verschanzt. Erst durch die Ermittlungen kommt Flavia ihrem Vater überhaupt einmal ein Stückchen näher und so erzählt „Mord im Gurkenbeet“ ein Stück weit auch eine tragische Familiengeschichte im Spiegel ihrer Zeit.
Alan Bradley hat mit seinem Romandebüt einen hochgradig unterhaltsamen Krimi abgeliefert, der sich flott und spannend herunter liest. Flavia ist seit Langem die sympathischste Krimiheldin, die mir untergekommen ist, und mit seiner gewitzten, ironischen Art die Geschichte zu erzählen, bewegt Alan Bradley sich nicht all zu streng innerhalb der Grenzen des Genres. Zum Ende hin entwickelt der Plot gar noch einiges an Dramatik, als Flavia im Showdown dem Mörder gegenüber steht.
_Alles in Allem_ ist „Flavia de Luce – Mord im Gurkenbeet“ ein herausragendes Lesevergnügen. Alan Bradley hat die Vorschusslorbeeren auf seinen Roman nicht ohne Grund geerntet. Flavia ist eine Titelheldin, die vom Fleck weg sympathisch ist und durch ihre hartnäckige Ermittlungsarbeit und ihre messerscharfe Kombinationsgabe begeistert. „Mord im Gurkenbeet“ ist spannend, schräg, gewitzt und hochgradig unterhaltsam und fährt damit eine stimmige Mischung auf, die zu überzeugen weiß.
|Gebundene Ausgabe: 384 Seiten
ISBN-13: 978-3764530273|
Originaltitel: |The Sweetness at the Bottom of the Pie|
Aus dem Englischen von Gerald Jung, Katharina Orgaß