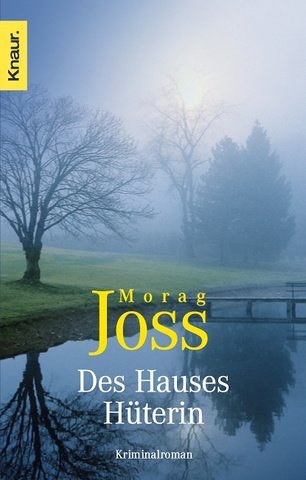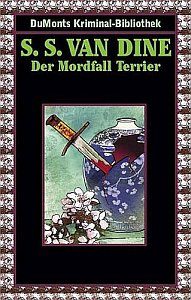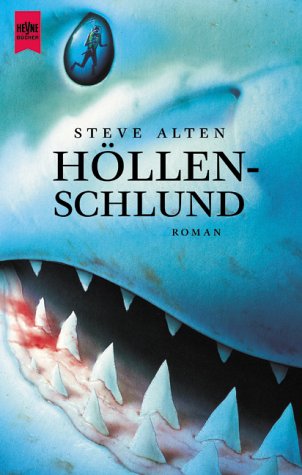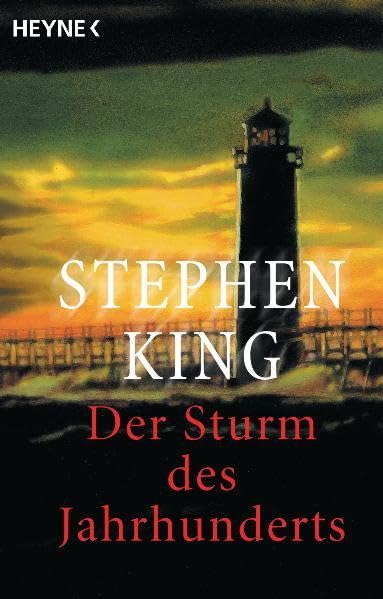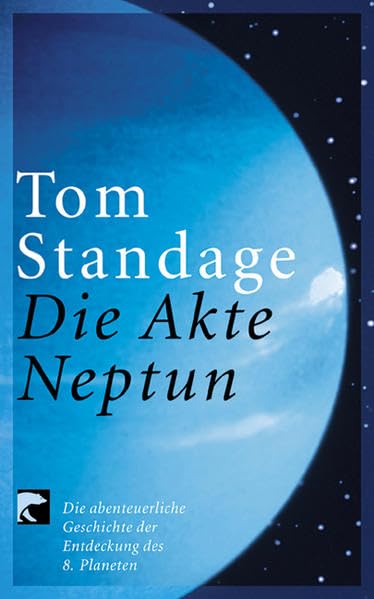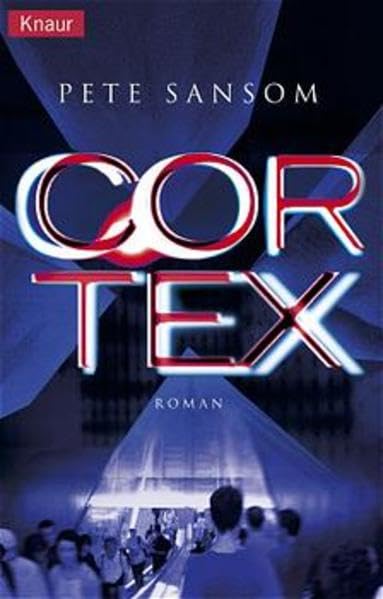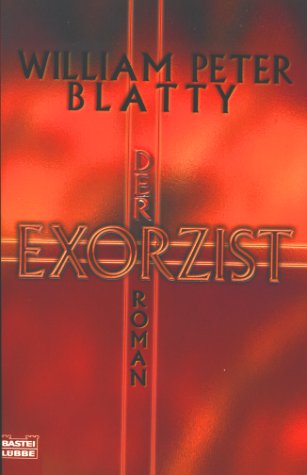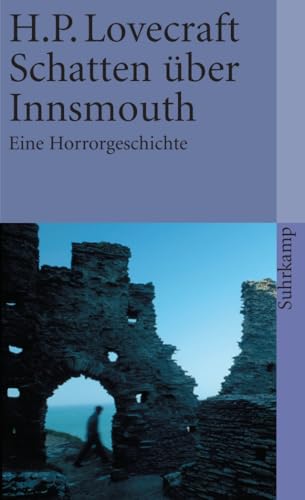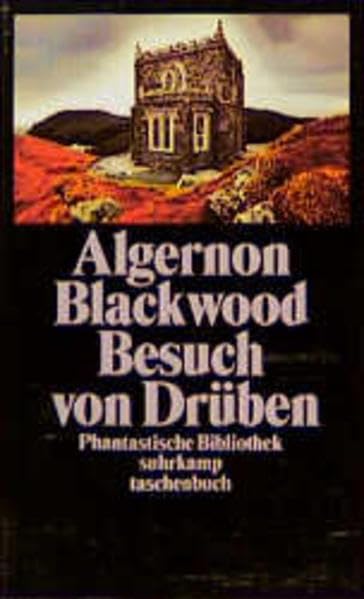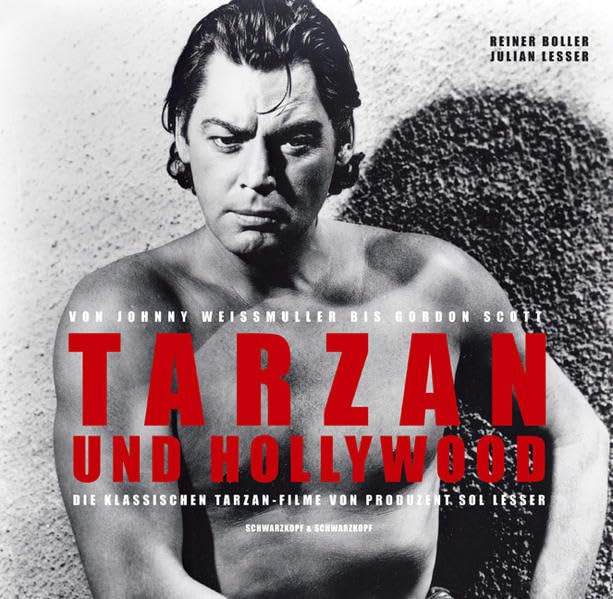Es ist ein Arbeitstag wie so viele andere im Berufsleben des Feuerwehrmanns Richard Picciotto. In 28 Jahren hat er sich bis zum Battalion Commander des FDNY (Fire Department of New York) Battalion 11 empor gearbeitet – ein hoher Posten mit viel Verantwortung, der dem „Chief“ jedoch die Möglichkeit bietet, gemeinsam mit seinen Männern vor Ort Brände zu bekämpfen.
Dieser 11. September 2001 führt Picciotto und seine Gefährten in das „ganz Große“, jenes gefürchtete, halb mythische Feuer, dem sie womöglich nicht gewachsen sind: Terroristen haben eine Verkehrsmaschine in den Südturm des „World Trade Center“-Komplexes gelenkt. Das mehr als 400 Meter hohe Gebäude steht in Flammen. Kurze Zeit darauf rammt ein weiteres Flugzeug den Nordturm.
Aus ganz Manhattan, dann aus ganz New York eilen Feuerwehrleute an den Ort des Geschehens. Auch Battalion 11 ist, obwohl eigentlich nicht zuständig, zur Stelle. Picciotto stürmt mit seinen Männern in den Nordturm. Apokalyptische Szenen spielen sich hier ab, die Menschen oberhalb der Feuergrenze sind verloren. Unterhalb macht die Räumung Fortschritte, als der Nordturm einstürzt.
Die Feuerwehrleute wissen nun, dass auch sie in Lebensgefahr schweben. In Windeseile beginnen sie den Nordturm zu evakuieren, als das Befürchtete eintritt und auch dieser in sich zusammenbricht. Noch immer sind überall Feuerwehrleute im Gebäude. Auch Picciotto und einige Kollegen geraten in den Sog des Untergangs.
Wie durch ein Wunder werden sie bei dem Einsturz nicht zermalmt wie 343 andere Feuerwehrleute, sondern in einen Treppenhaus-Hohlraum gewirbelt. Unter dem Schuttberg des gigantischen Nordturm finden sie sich lebendig begraben wieder. In dem Chaos nach dem Inferno ist die Angst berechtigt, dass niemand sie finden oder auch nur suchen wird. Also beginnen die geschockten, verletzten Überlebenden, verzweifelt nach einem Ausweg zu suchen …
Eine Gruppe gut ausgebildeter, erfahrener Profis gerät in eine Krise, die sie in völlige Hilflosigkeit stürzt: Das ist eine Geschichte, die es zweifellos wert ist erzählt zu werden. Zwar wurde uns über den Terroranschlag auf die „Twin Towers“ in den vergangenen Jahren mehr als genug Lesestoff geboten. „Unter Einsatz meines Lebens“ bietet jedoch in doppelter Hinsicht eine ungewöhnliche Perspektive: Zum einen schrieb dieses Buch ein Mann, der buchstäblich „vor Ort“ war und dessen Erfahrungen unmittelbar sind. Zum anderen entstand Picciottos Bericht kaum drei Monate nach den Ereignissen, die hier noch „frisch“ und weitgehend ohne den Filter nachträglicher Interpretation rekonstruiert werden.
Richard Picciotto ist kein Schriftsteller; er spricht es selbst immer wieder an. Das hat seine Vorteile, weil er so schreibt, wie er vermutlich auch seine Einsatzberichte als Feuerwehrmann verfasst: nüchtern, den Blick auf Abläufe gerichtet, die minutiös beschrieben werden. (Um die Lesbarkeit des Ergebnisses zu garantieren, wurde mit Daniel Paisner ein Profi als Co-Autor engagiert.) Weil er nach knapp drei Jahrzehnten seinen Job in- und auswendig kennt, gibt es viele interessante Fakten und Interna über die militärähnlich strukturierte New Yorker Feuerwehr zu erfahren.
Weniger sachlich bzw. fachbezogen sind Picciottos Erinnerungen an den 11. September 2001. Schock und Stress trüben verständlicherweise das Bild, doch seine Schilderungen sind trotzdem von großer Bedeutung: Es gibt kaum Zeugen, die sich bis zuletzt in den beiden Türmen aufhielten und dies überlebten, um dann darüber berichten zu können.
Sehr anschaulich und fesselnd beschreibt Picciotto die Mischung aus Professionalität und Todesangst, die ihn wechselweise „funktionieren“ ließ und dann wieder lähmte. Als Leser fragt man sich natürlich, wie man selbst in einer solchen Situation reagieren würde. Picciotto macht deutlich, dass jede Vorstellungskraft versagen kann. Ständig erinnert er sich an sein Unvermögen, den Umfang der Katastrophe tatsächlich zu begreifen. Mitten in New York hielt er sich auf und kam sich doch vor wie gestrandet auf einem fremden Planeten. Wie Picciotto es in Worte fasst, glaubt man ihm das.
Bewusst beschränkt sich der Verfasser darauf, von „seinem“ 11. September 2001 zu berichten. Wie gesagt entstand „Unter Einsatz meines Lebens“ nur kurze Zeit später. Über die Hintergründe der Untat war da noch nicht viel bekannt. Um diese geht es auch gar nicht in Picciottos Buch. Er bedient diejenigen Leser, die es drängt, dem Unglück ein „Gesicht“ zu geben. So monumental war die Katastrophe jenes Septembertags, dass eines manchmal in Vergessenheit gerät: Jedes Opfer war ein Individuum, nicht nur Beiwerk eines schrecklichen Spektakels.
Ein lesenswertes Buch und auf seine Weise keinen „literarischen Schnellschuss“ auf der Jagd nach dem raschen Dollar hat Picciotto also verfasst. Einwände lassen sich dennoch gegen dieses Werk erheben. Aber „darf“ man das denn überhaupt? Gilt es nicht ehrfürchtig zu schweigen, wenn ein echter Held davon erzählt, wie er und seine Kumpels ihren „Job“ taten und dabei nicht nur an sich selbst, sondern vor allem an die ihnen zur Rettung anvertrauten Mitbürger dachten? „Sie nennen uns Helden, aber wir tun nur unsere Arbeit.“ – statt einer Widmung leitet dieses Zitat das Buch ein; derartig zur Schau gestellte Bescheidenheit kann durchaus als Koketterie ausgelegt werden. Am 11. September taten die Feuerwehrleute von New York weit mehr als ihre „Arbeit“.
Weiterhin berichtet der Autor vom Ende des World Trade Centers, jenes Gebäudekomplexes, der nach einem hochkriminellen Akt unentschuldbaren Terrors in Trümmer fiel und dessen „Ground Zero“ in einem zweiten Schritt – hier betreten wir den unsicheren Boden zwischen Sachlichkeit und wogenden Gefühlen – zur nationalen Weihestätte erhoben wurde.
Viel Schindluder wurde seither bekanntlich mit „11/9/2001“ getrieben. Jene, die trotz des Schocks zu Mäßigung bzw. Nachdenken rieten, wurden niedergeschrieen oder als „Landesverräter“ eingeschüchtert. Zusammen mit der Ungeheuerlichkeit des Geschehens entwickelte sich eine Art Reflex, der bei der Nennung von Reizworten wie „World Trade Center“ oder „Ground Zero“ zu bestimmten Reaktionen zwingt. Dazu gehört die Unterdrückung kritischer Fragen. „Unter Einsatz meines Lebens“ ist kein Produkt, sondern ein Bestandteil dieser Entwicklung. Als Picciotto schrieb, formierten sich die Fronten erst. Wir hören einen noch nicht indoktrinierten „WTC“-Zeugen. Das macht seine Worte besonders wertvoll.
Obwohl sich Picciotto um Sachlichkeit bemüht, misslingt es ihm – aber es misslingt ihm interessant bzw. viel sagend. Da ist auf der einen Seite das Zusammengehörigkeitsgefühl der Feuerwehrleute – sehr leicht nachvollziehbar, weil diese regelmäßig in Situationen geraten, die es lebenswichtig erscheinen lassen, sich auf die Kollegen verlassen zu können. Dieser Teamgeist wird indessen von Picciotto geradezu hollywoodlike überhöht. Eine New Yorker Feuerwache funktioniert wie ein Uhrwerk, der Vorgesetzte ist Kumpel, aber doch immer geachteter Chef. Feuerwehrleuten sind harte Jungs mit goldenen Herzen, die in ihrer Wache wohnen, schon Stunden vor dem Dienst dort erscheinen, eigentlich nur nach Hause fahren, um dort ihren Familien liebevoller Ehegatte und Vater zu sein, und sich auf jedes Feuer stürzen wie einst die US-Kavallerie auf widerspenstige Rothäute.
So geht es recht märchenhaft immer weiter. Picciotto übertreibt es völlig unnötig, denn die Taten der New Yorker Feuerwehrleute während des „World Trade Center“-Brandes sprechen eindeutig für sich und sie. Deshalb muss man wohl davon ausgehen, dass die Verklärung Absicht ist.
Mit Kritik hält sich Picciotto dagegen lange und überhaupt zurück. Man muss schon genau lesen, um zu erfahren, dass doch nicht alles Gold ist im US-Feuerwehr-Imperium. Die Männer sind schlecht bezahlt und unzureichend ausgerüstet, ihre Einsatzkoordination ist mangelhaft. Aber auch hier stützt sich Picciotto auf simple Schwarz/Weiß-Bilder: Während „an der Front“, d. h. in den Wachen und auf der Leiter, trotz aller Schwierigkeiten perfekte Arbeit geleistet wird, sitzt der „Feind“ – die Bürokratie – weit ab von jedem Feuer am Schreibtisch und zählt ohne Wissen und Verstand Erbsen, statt Entschlossenheit zu zeigen und die Geldbörse zu zücken. Wen präzise er damit meint, verrät uns Picciotto leider nicht; sein Mut reicht zwar aus, sich in ein brennendes Gebäude zu stürzen, aber mit der Stadtverwaltung legt er sich lieber nicht an.
So mischen sich mehr und mehr propagandistische Töne in Piciottos Schilderung. Er will mit seinem Bericht nicht nur informieren, sondern etwas erreichen: ein höheres Budget, mehr Entscheidungsfreiheit, weniger Gängelei. Das ist in Ordnung und wird zudem so offen und naiv vorgetragen, dass sich kein Leser manipuliert fühlen dürfte.
Dasselbe gilt für die unbeholfenen Patriotismen, die offenbar zur US-Mentalität gehören. Ein Feuer ist kein Feuer, sondern ein „Feind“, dessen unheilvolles Wirken Piciottos Mannen sehr persönlich nehmen. Lauter Individualisten verwandeln sich zu seiner Bekämpfung – und auch diese Bezeichnung ist hier ganz wörtlich zu nehmen – in ein Team, das alle an einem Strang ziehen lässt. Man kann das begeistertes Engagement nennen, man darf aber (ohne sich als europäischer Zyniker abqualifizieren zu lassen) auch leise Zweifel anmelden, ob dieses markig-idyllische Idealbild der Wirklichkeit entspricht.