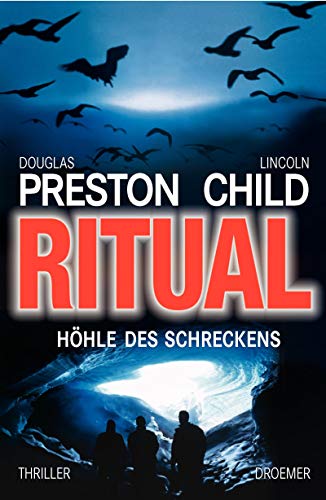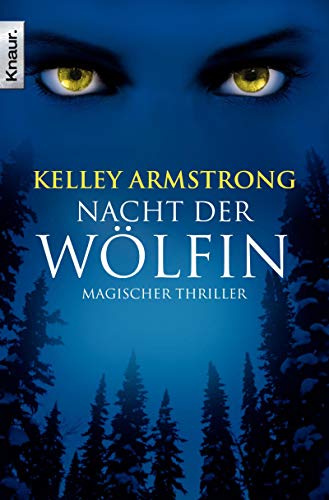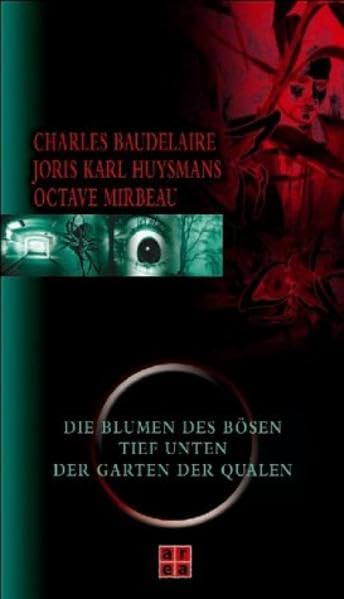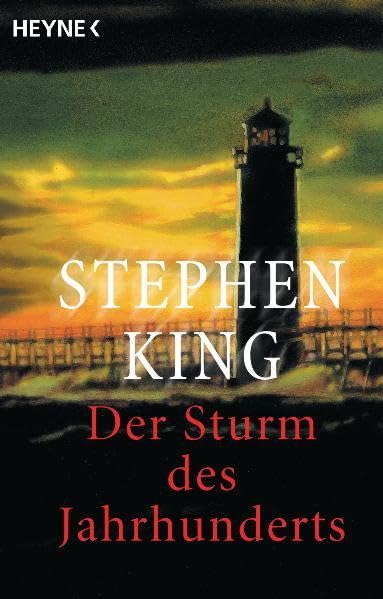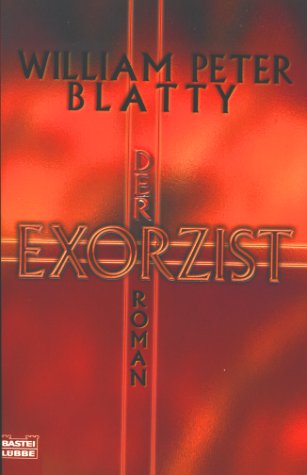Jean Ray – Die Gasse der Finsternis. Phantastische Erzählungen weiterlesen
Archiv der Kategorie: Horror & Unheimliches
F. Paul Wilson – Das Kastell
Im April des Jahres 1941 steht Nazi-Deutschland scheinbar vor dem „Endsieg“. In einer alten Bergfestung in den rumänischen Karpaten hat eine kleine Abteilung der Wehrmacht einen strategisch eher unwichtigen Kontrollposten eingerichtet. Major Klaus Wörmann, der Kommandant, wurde hierher strafversetzt, weil er, ein Soldat der alten Schule, sich nicht nur geweigert hatte, der SS beizutreten, sondern sogar Manns genug gewesen war, deren Gräueltaten in den besetzten Ostgebieten anzuprangern.
Zwei Soldaten auf heimlicher Schatzsuche wecken versehentlich ein unheimliches Wesen, das nun des Nachts die deutschen Besatzer abzuschlachten beginnt. In seiner Not ruft Wörmann Hilfe. Man schickt ihm SS-Mann Erich Kämpffer, den er nur zu gut kennt und verachtet; zu Recht, denn der ebenso ehrgeizige wie skrupellose Sturmbannführer beginnt sogleich die Einheimischen zu terrorisieren, die er für die Morde verantwortlich macht. Wörmann sucht und findet einen Mann, der mehr über die Festung weiß. Professor Theodor Cuza ist ein todkranker Mann – und er ist Jude, was ihn und seine Tochter Magda der Willkür Kämpffers aussetzt, der beide in die Karpaten verschleppen lässt. F. Paul Wilson – Das Kastell weiterlesen
Masterton, Graham – Rückkehr des Manitou, Die
_Das geschieht:_
Misquamacus, mächtiger indianischer Zauberer und seit Jahrhunderten erklärter Feind der Bleichgesichter, hat die peinliche Schlappe überwunden, die ihn vor einem halben Jahrzehnt zurück ins Geisterreich verbannte (s. „Der Manitou“/“The Manitou“, Bastei-Lübbe-Horrorbibliothek Nr. 70001), und setzt zur neuerlichen Attacke an. Es zieht ihn nach Bodega, ein Fischerdorf an der kalifornischen Küste. Dort brachte in den 1830er Jahren der berüchtigte „Bloody“ Allen Fenner Verderben über die friedfertigen Wappo-Indianer. Da Differenzierung nie seine starke Seite war, fährt Misquamacus‘ Geist (= Manitou) in Toby, den achtjährigen Sohn der gegenwärtigen Fenners.
Billy Ritchie ist als Dorforakel von Bodega über Misquamacus und dessen Versuche, den „Tag der dunklen Sterne“ anbrechen zu lassen, gut informiert: Dämonen aus der farbenprächtigen indianischen Hölle will der Manitou heraufbeschwören und so die Welt in Angst und Schrecken stürzen. Damit diese sich manifestieren können, muss in Tobys Kleiderschrank (!) ein Portal ins Jenseits errichtet werden. Außerdem ist die Unterstützung 22 geisterhafter Medizinmänner der wichtigsten nordamerikanischen Indianerstämme erforderlich.
Mit seinen Vorbereitungen ist Misquamacus gut beschäftigt und kann die Fenners nur nebenbei piesacken. Tobys Vater Neil bleibt Zeit zur Recherche. Als er erfährt, dass der böse Zauberer vor einigen Jahren in New York Tod und Verderben gesät hat, nimmt er Kontakt mit Harry Erskine auf, der damals dem Schrecken ein Ende bereiten konnte. Mit der Welt der Geister will Harry zwar nichts mehr zu tun haben, aber da Misquamacus angekündigt hat, sich auch an ihm rächen zu wollen, reist er mit seinem alter Kampfgefährte, der Medizinmann Singing Rain, nach Bodega. Gemeinsam mit den Fenners stellt man sich Misquamacus, doch der hat seine Hausaufgaben dieses Mal besser gemacht …
_Mancher Geist will nicht verschwinden_
„Der Manitou“ markierte 1975 Graham Mastertons Debüt als Autor. Mit dem stets finster gestimmten indianischen Zaubermeister fand er viele Leser. Dass er im Horror-Genre Fuß gefasst hatte, muss dem stolzen Verfasser noch deutlicher geworden sein, als kurze Zeit später Hollywood bei ihm vorstellig wurde. Allerdings wurde der „Manitou“-Film von 1976 ein arger Heuler, der in verzweifelten Karrierenöten gefangene Darsteller wie Tony Curtis, Stella Stevens, Ann Sothern oder Burgess Meredith als Geiseln des beschränkt begabten „Total Film-Maker“ (Regie, Buch, Produktion) William Girdler zeigte. Immerhin: Der Rubel rollte. Masterton schmiedete das Eisen, solange es heiß war, und ließ den bösen Misquamacus zurückkehren.
Es lässt sich freilich nicht leugnen, dass der Verfasser mit „Die Rückkehr des Manitou“ die Geschichte des Erstlings einfach noch einmal erzählt. Davon kann der neue Schauplatz nicht ablenken. (In Bodega ist man Kummer mit dem Übernatürlichen übrigens gewohnt, trieben hier doch Anfang der 1960er Jahre Hitchcocks „Vögel“ ihr Unwesen.) Immerhin macht „Die Rückkehr …“ deutlich, dass Masterton sich als Autor ein wenig weiterentwickelt hat. Fiel Misquamacus bei seinem ersten Auftreten eher durch seine bei aller Bösartigkeit erheiternde Beschränktheit auf – welcher halbwegs gescheite Rachegeist würde seinen Feldzug ausgerechnet in einem städtischen Krankenhaus starten? -, hat er nun ansatzweise dazugelernt.
|Konzentriere dich, Misquamacus!|
„Die Rückkehr …“ ist wie alle (frühen) Werke Mastertons Ex-und-hopp-Lektüre mit den drei grundsätzlichen Elementen flott, blutig und gradlinig. Trotzdem hatte der Verfasser begriffen, dass man einem Bösewicht Tiefe und damit Glaubwürdigkeit verleihen muss, will man ihn im Gedächtnis eines Publikums verankern. Misquamacus bekommt daher eine Vergangenheit, die zumindest ahnen lässt, wieso er so nachhaltig sauer auf den Weißen Mann ist.
Leider ist Masterton nicht konsequent; Misquamacus bleibt weiterhin ein (verblüffend schwatzhaft gewordener) Rächer, der zwangsläufig scheitern muss, weil er wie das Kutschenpferd von der vorgehaltenen Möhre jeder Kränkung eines Bleichgesichts magisch angezogen folgt. Da er jedem, der ihm zu nahe tritt, blutige Rache schwört, ist es kein Wunder, dass es mit der Eroberung der Welt wieder nichts wird, denn vor den Pforten der Hölle wartet geduldig eine lange und immer länger werdende Schlange von Leuten, mit denen Misquamacus, die dauerbeleidigte Leberwurst, vorher noch ein Hühnchen zu rupfen hat.
Wenig erfreulich ist erneut das Finale, auch wenn es nicht ganz so unglaubhaft und lächerlich ausfällt wie in „Der Manitou“. Trotzdem dürfte der neuerliche Auftritt des großen Cthulhu den armen H. P. Lovecraft in seinem Sarg in heftige Rotation versetzt haben.
|Ein Manitou gerät ins Schlingern|
Weiterhin hapert es in „Die Rückkehr …“ erheblich mit der Kontinuität der „Manitou“-Saga. Plötzlich hat Misquamacus beileibe nicht schon 1651 dauerhaft sein Domizil im Geisterreich aufgeschlagen, wie es noch im ersten Teil hieß. Das zu postulieren war wichtig, denn der Anachronismus des alten Bösewichts erklärte sehr gut sein Scheitern. Doch nun erfahren wir, dass Misquamacus die Welt der Lebenden in den vergangenen drei Jahrhunderten sehr viel öfter besucht hat. Da sollte man voraussetzen können, dass er mit der Gegenwart ein wenig besser vertraut ist!
Egal: „Die Rückkehr …“ ist eine trashige aber vergnügliche Lektüre. Und auch nach 1979 sollte Masterton, der nie den Nobelpreis für Literatur gewinnen wird, aber bei aller Hast und den dabei unvermeidlichen Schlampigkeiten durchaus ein guter Geschichtenerzähler ist, sein Talent besser in den Dienst der jeweiligen Story stellen.
|Deutschland bleibt Manitou-Diaspora|
Leider können wir Freunde des Unheimlichen uns in Deutschland davon nur sporadisch überzeugen; wenige Masterton-Romane fanden und finden den Weg in dieses unser Land. Dabei gilt z. B. Misquamacus dritter Streich („Burial: A Novel of the Manitou“, 1992) als bester Teil der Serie, zumal der Verfasser hier seine Leser mit einem Kniff zu fesseln weiß, den er zu einem persönlichen Markenzeichen entwickelt hat: der Verknüpfung einer fiktiven Handlung mit realen historischen Ereignissen, hier der Schlacht am Little Big Horn, an deren Verlauf Misquamacus nicht ganz unbeteiligt war.
Dass Masterton seinen ersten Anti-Helden nicht vergessen hat, bewies er 2005, als er Misquamacus nach 13-jähriger Pause überraschend zurückkehren ließ: Weiterhin ist der Manitou nicht zimperlich ist, wenn es gilt, seinen altbekannten Zielen böse Taten folgen zu lassen, und immer noch folgt auf jede Niederlage eine Wiederkehr. Auf diese Weise kann Misquamacus noch lange sein (lukratives) Unwesen treiben.
_Autor_
Graham Masterton, geboren am 16. Januar 1946 im schottischen Edinburgh, ist nicht nur ein sehr fleißiger, sondern auch ein recht populärer Autor moderner Horrorgeschichten. In Deutschland ist ihm der Durchbruch seltsamerweise nie wirklich gelungen. Nur ein Bruchteil seiner phantastischen Romane und Thriller, ganz zu schweigen von seinen historischen Werken, seinen Thrillern oder den berühmt berüchtigten Sex Leitfäden, haben den Weg über den Kanal gefunden.
Besagte Leitfäden erinnern übrigens an Mastertons frühe Jahre. Seine journalistische Ausbildung trug dem kaum 20 Jährigen die die Position des Redakteurs für das britische Männer Magazin „Maifair“ ein. Nachdem er sich hier bewährt hatte, wechselte er zu Penthouse und Penthouse Forum. Dank des reichlichen Quellenmaterials verfasste Masterton selbst einige hilfreiche Werke, von denen „How To Drive Your Man Wild In Bed“ immerhin eine Weltauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erreichte.
Ab 1976 schrieb Masterton Unterhaltungsromane. Riss er sein Debütwerk „The Manitou“ (dt. „Der Manitou“) noch binnen einer Woche herunter, gilt er heute als kompetenter Handwerker, dem manchmal Größeres gelingt, wenn sein Geist schneller arbeitet als die Schreibhand, was freilich nur selten vorkommt.
|Die Misquamacus-Serie:|
(1975) |The Manitou| (dt. „Der Manitou“) – Bastei Horror-Bibliothek Nr. 70001
(1979) |Revenge of the Manitou| (dt. „Die Rückkehr des Manitou“) – Bastei Horror-Bibliothek Nr. 70014
(1992) |Burial| (kein dt. Titel)
(2005) |Manitou Blood| (kein dt. Titel)
(2009) |Blind Panic| (kein dt. Titel)
|Taschenbuch: 189 Seiten
Originaltitel: Revenge of the Manitou (London : Sphere 1979)
Übersetzung: Rosemarie Hundertmarck
Deutsche Erstausgabe: 1979 (Bastei-Lübbe-Verlag/Horror-Bibliothek Nr.
ISBN-13: 978-3-404-01279-4|
[Autorenhomepage]http://www.grahammasterton.co.uk
[Verlagshomepage]http://www.luebbe.de
(Michael Drewniok)
Richard Dalby (Hg.) – Geister zum Fest. Weihnachtliche Gruselgeschichten

Richard Dalby (Hg.) – Geister zum Fest. Weihnachtliche Gruselgeschichten weiterlesen
Masterton, Graham – Manitou, Der
_Das geschieht:_
Klein aber fein ist das Privatkrankenhaus „Schwestern von Jerusalem“ in New York City. Die folglich gut situierte, noch sehr junge Karen Tandy kann sich daher mit Recht vertrauensvoll an Dr. Hughes wenden, gilt er doch als Koryphäe seines Metiers. Besonders als Fachmann für Tumorerkrankungen hat er sich einen guten Namen gemacht. Trotzdem ist er erschrocken, denn im Nacken seiner Patientin wuchert eine Schwellung, die nicht im Lehrbuch findet. Der ‚Tumor‘ ist eine Art Embryo, der sich im Zeitraffertempo entwickelt und seine Wirtin schon bald auch geistig unterjocht.
An einem weniger eleganten Ort der Stadt fristet Harry Erskine, der alten Damen die Zukunft aus den Karten liest und dabei den echten Kontakt zum Reich der Geister durch Fantasie und Erfindungsreichtum ersetzt, sein bescheidenes aber zufriedenes Dasein. Dann kommt der Tag, an dem ihn die Nichte einer alten Stammkundin aufsucht: Karen Tandy, die nicht nur unter besagtem Tumor, sondern auch unter seltsamen Träumen leidet.
Harry verliebt sich ein wenig in seine Besucherin. Er bemüht eine alte Freundin, die über echte parapsychische Fähigkeiten verfügt. Bei einer Seance taucht der Geist eines Indianers auf, dessen Attacken die Anwesenden nur mit knapper Not entkommen. Kurz darauf ist Karens Tumor fast so groß wie der Körper seiner Wirtin geworden. In dieser Situation ist Dr. Hughes geneigt Harry Gehör zu schenken, der die bevorstehende Wiedergeburt eines indianischen Rachegeistes ankündigt.
Ein Fachmann muss her! Medizinmann Singing Rain (der eigentlich im Immobiliengeschäft tätig ist) erkennt den Gegner: Misquamacus ist der vielleicht mächtigste Zauberer seines Volkes, der mit dem Weißen Mann noch eine Rechnung offen hat, seit ihn holländische Siedler Mitte des 17. Jahrhunderts in den Tod getrieben haben. Nun ist Misquamacus wieder da – orientierungslos und wie immer äußerst schlecht gelaunt. Es stimmt ihn nicht versöhnlicher, dass verschwenderisch eingesetzte Röntgenstrahlen seinen neuen Körper schwer geschädigt haben. Der erzürnte Geist setzt seinen Zauber ein, um sich zu rächen …
_Eiliger Horror mit trivialem Charme_
Graham Masterton ist nicht nur ein sehr fleißiger, sondern auch ein in seiner amerikanischen Heimat (eigentlich ist er Schotte) recht populärer Autor moderner Horrorgeschichten. In Deutschland ist ihm der Durchbruch dagegen seltsamerweise nie wirklich gelungen. Nur ein Bruchteil seiner phantastischen Romane und Thriller, ganz zu schweigen von seinen historischen Werken (oder den berühmt-berüchtigten Sex-Leitfäden) haben den Weg über den Großen Teich gefunden, wo sie sich unter denen, die das Phantastische lieben, zu begehrten Sammelobjekten entwickelt haben.
„Der Manitou“ markiert Mastertons Debüt als Autor, was zu berücksichtigen ist, wenn man diesen Roman beurteilen möchte – dies und das Wissen, dass Masterton ihn 1974 binnen einer einzigen Woche niederschrieb. Das erklärt eine Menge; die anspruchslose Handlung oder die schlichte Figurenzeichnung beispielsweise. Auf der anderen Seite verspricht Masterton nie mehr als er zu halten bereit ist: Horror der handfesten Art! „Der Manitou“ ist schnell, durchaus witzig und gespickt mit drastischen Effekten. Auf kaum mehr als 170 Seiten wird die Story ohne Pausen vorangetrieben.
|Geist mit schlechtem Planungsstand|
Probleme gibt es immer dort, wo Masterton einhält, um der Handlung Tiefe zu verleihen. Er bildet sich offensichtlich viel ein auf sein Wissen um die indianische Kultur und Mythologie, kommt aber trotzdem niemals über die peinlichen Roter Mann = Guter Mann-Plattitüden hinweg, die als politisch korrekt gelten.
Zwar angesprochen aber nie wirklich beantwortet wird außerdem die Frage, wieso der angeblich so schlaue Misquamacus eigentlich volle dreieinhalb Jahrhunderte übersprungen hat, um ausgerechnet in der Welt des ausgehenden 20. Jahrhunderts aufzutauchen. Wäre es nicht ein Zeichen echter Intelligenz gewesen schon nach fünf oder zehn Jahren zurückzukehren? Für einen Geist, der außerhalb der Gesetze von Raum und Zeit steht, legt Misquamacus ein bemerkenswert schlechtes Gefühl für Timing an den Tag. Da hat es schon etwas rührend Hilfloses, die magische Eroberung der Welt ausgerechnet in einem Krankenhaus zu starten … Aber natürlich sollte man über Sinn & Unsinn solcher für den raschen Konsum bestimmten Unterhaltungsliteratur lieber nicht intensiver nachdenken.
|Ein Medizinmann spukt im Kino|
„Der Manitou“ erschien zwar zunächst in Großbritannien, war aber später auch in den USA überraschend erfolgreich. Bald wurde Hollywood bei Masterton vorstellig, doch dies leider nur in der Gestalt des jungen William Girdler, dessen Filmografie bis dato nur Sch(l)ock-Klassiker wie „Asylum of Satan“ (1972) oder „Three on a Meathook“ (1973) auflistete. Aber Masterton liebt das Abwegige, und so stand Misquamacus= Zelluloid-Zauberschlacht nichts mehr im Wege. „Manitou“, der Film von 1978, ist mit Tony Curtis (!), Stella Stevens, Ann Sothern und Burgess Meredith erstaunlich gut besetzt. Ganz offensichtlich wandelt „Der Manitou“ hier auf den Spuren der „Exorzisten“ und „Omen“-Reihen, die Mitte der 1970er Jahre Geldfluten in die Kinokassen spülten.
Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass sich die genannten Darsteller 1978 gerade in einem Karrieretief befanden, welches in den meisten Fällen andauerte: War das der Fluch des Manitou? Die ohnehin schlichte Story wurde durch kein geniales Drehbuch geadelt (um es höflich auszudrücken), und Girdler ist nicht Orson Welles (und sollte es auch niemals werden; nachdem „Der Manitou“ ein bescheidener Erfolg geworden war, recherchierte Girdler 1978 auf den Philippinen für seinen ersten Big Budget-Hollywood-Film – und stürzte prompt mit dem Hubschrauber ab; ein neues Opfer des Misquamacus?).
So blieben wie so oft im phantastischen Film nur die Spezialeffekte, die dem Streifen Kontur verliehen. Sie sind ordentlich, können aber aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr überzeugen. „Der Manitou“ erfreut sich in Amerika trotzdem noch eines gewissen Rufes, weil er den dauerpubertierenden US-Boys den erregenden Anblick blanker Busen in einem ‚richtigen‘ Spielfilm beschert.
|Misquamacus geht in Serie|
In Deutschland war des Manitous Wiedergeburt auf der Kinoleinwand immerhin Anlass genug, mit Misquamacus die 1978 ebenfalls im Zeichen der phantastischen Renaissance ins Leben gerufene „Horror-Bibliothek“ des Bastei-Lübbe-Verlages prominent einzuleiten. Heute dürfen sich die wohl nicht gerade zahlreichen Besitzer dieses Bändchens glücklich schätzen – über ein hübsches Sammlerstück und die wehmütige Erinnerung an eine Zeit, da jeder deutsche Taschenbuch-Verlag mindestens einen einschlägigen Titel pro Monat auf den Markt brachte.
Misquamacus ließ der unverhoffte Erfolg seines ersten Auftretens übrigens nie lange im Geisterreich verweilen. Schon 1979 war er wieder da; die Chronik seiner neuen Untaten trug hierzulande den sinnigen Titel „Die Rückkehr des Manitou“ und signalisierte schon dadurch, dass dieser seit dem letzten Mal wenig dazugelernt hatte.
|Deutschland bleibt Manitou-Diaspora|
Leider können wir Freunde des Unheimlichen uns in Deutschland davon nur sporadisch überzeugen; wenige Masterton-Romane fanden und finden den Weg in dieses unser Land. Dabei gilt z. B. Misquamacus dritter Streich („Burial: A Novel of the Manitou“, 1992) als bester Teil der Serie, zumal der Verfasser hier seine Leser mit einem Kniff zu fesseln weiß, den er zu einem persönlichen Markenzeichen entwickelt hat: der Verknüpfung einer fiktiven Handlung mit realen historischen Ereignissen, hier der Schlacht am Little Big Horn, an deren Verlauf Misquamacus nicht ganz unbeteiligt war.
Dass Masterton seinen ersten Anti-Helden nicht vergessen hat, bewies er 2005, als er Misquamacus nach 13-jähriger Pause überraschend zurückkehren ließ: Weiterhin ist der Manitou nicht zimperlich ist, wenn es gilt, seinen altbekannten Zielen böse Taten folgen zu lassen, und immer noch folgt auf jede Niederlage eine Wiederkehr. Auf diese Weise kann Misquamacus noch lange sein (lukratives) Unwesen treiben.
_Autor_
Graham Masterton, geboren am 16. Januar 1946 im schottischen Edinburgh, ist nicht nur ein sehr fleißiger, sondern auch ein recht populärer Autor moderner Horrorgeschichten. In Deutschland ist ihm der Durchbruch seltsamerweise nie wirklich gelungen. Nur ein Bruchteil seiner phantastischen Romane und Thriller, ganz zu schweigen von seinen historischen Werken, seinen Thrillern oder den berühmt berüchtigten Sex Leitfäden, haben den Weg über den Kanal gefunden.
Besagte Leitfäden erinnern übrigens an Mastertons frühe Jahre. Seine journalistische Ausbildung trug dem kaum 20 Jährigen die die Position des Redakteurs für das britische Männer Magazin „Maifair“ ein. Nachdem er sich hier bewährt hatte, wechselte er zu Penthouse und Penthouse Forum. Dank des reichlichen Quellenmaterials verfasste Masterton selbst einige hilfreiche Werke, von denen „How To Drive Your Man Wild In Bed“ immerhin eine Weltauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren erreichte.
Ab 1976 schrieb Masterton Unterhaltungsromane. Riss er sein Debütwerk „The Manitou“ (dt. „Der Manitou“) noch binnen einer Woche herunter, gilt er heute als kompetenter Handwerker, dem manchmal Größeres gelingt, wenn sein Geist schneller arbeitet als die Schreibhand, was freilich nur selten vorkommt.
|Taschenbuch: 173 Seiten
Originaltitel: The Manitou (London : Neville Spearman 1975/New York : Pinnacle Books 1976)
Übersetzung: Rosmarie Hundertmarck
ISBN-13: 978-3-404-01043-1|
[Autorenhomepage]http://www.grahammasterton.co.uk
[Verlagshomepage]http://www.luebbe.de
(Michael Drewniok)
Suzuki, Kôji – Dark Water
Prolog (S. 7-12): An den Ufern der Bucht von Tokio erteilt eine alte Frau ihrer Enkelin eine Lebenslektion. Sie bereitet ihre Botschaft vor, indem sie an jedem Abend der folgenden Woche eine seltsame Geschichte erzählt.
Dunkles Wasser (S. 13-54): In einem kaum bewohnten Hochhaus mehren sich für eine allein erziehende Mutter die schrecklichen Beweise dafür, dass die vor Jahren spurlos verschwundene Tochter einer Vormieterfamilie zumindest des Nachts sehr wohl noch zu den Nachbarn gehört …
Die einsame Insel (S. 55-98): Auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio findet ein Besucher den lebenden Beweis für eine bizarre Beziehungsgeschichte, mit der ihn ein Freund vor vielen Jahren in Verwirrung gestürzt hat …
Strafe (S. 99-146): Ein ungehobelter Fischer muss erstens die Feststellung machen, dass er mehr über den Verbleib seiner verschwundenen Frau weiß als ihm lieb ist, während sich zweitens das Meer nachdrücklich weigert, als Mantel der Verschwiegenheit über seine Untat gezogen zu werden …
Traumschiff (S. 147-182): Kurz vor dem rettenden Hafen stößt ein kleines Segelboot auf einen traurigen Geist, der in seiner Einsamkeit die Passagiere einfach nicht mehr gehen lassen möchte …
Die Flaschenpost (S. 183-218): Auf hoher See findet die Besatzung einer Jacht eine Flasche mit ganz besonderem Inhalt, der mit seiner Grundstimmung – mörderischer Hass – überaus freigiebig umgeht …
Wassertheater (S. 219-246): In einer leer stehenden Diskothek beobachten den Schauspieler, der eine lecke Toilette reparieren will, aus einer nur scheinbar leeren Kabine höchst interessierte Zuschauer …
Der unterirdische See (S. 247-288): Ein allzu wagemutiger Forscher strandet in einer Höhle, die er nur durch einen unterirdischen Fluss verlassen kann, der womöglich in einer Sackgasse endet …
Epilog (S. 289-303): Die alte Frau hat ihre Geschichten erzählt. Die letzte betraf sie selbst, denn ein merkwürdiger Zufall hatte den Abschiedsbrief des Höhlenforschers in ihre Hände geraten lassen.
Wasser ist ein Element, ohne das wir Menschen nicht leben können. Gleichzeitig kann es auch unser schlimmster Feind sein. Wir benutzen es, wir verbrauchen es, aber wir kennen es nicht wirklich. Was das Meer angeht, so befahren die Menschen seit Jahrtausenden seine Oberfläche. Darunter gehen indessen Dinge vor, von denen wir auch heute nur wenig verstehen. Deshalb fürchten wir uns seit jeher vor dem tiefen, dunklen Wasser, versuchen es mythisch zu beschwören, was sich natürlich primär an jene Bewohner wendet, die dort mutmaßlich auf uns lauern, wenn wir uns allzu vertrauensvoll oder unvorsichtig in Tiefen vorwagen, in denen wir nichts zu suchen haben.
Kôji Suzuki widmet dem Wasser einen Reigen lose miteinander verbundener Geschichten. Ihnen gemeinsam ist der Ort des Geschehens – die Bucht von Tokio, eine Wasserwildnis, die direkt vor den Toren einer Hightech-Millionenstadt beginnt. Dieser Gegensatz ist Suzuki aufgefallen. Die Grenzlinie zwischen den beiden Sphären ist dünn. Immer wieder stolpern unglückselige Zeitgenossen unverhofft in eine archaische Urwelt, der sie sich hochkonzentriert stellen müssten. Dass ihnen dies nie gelingt, ist oftmals ihr Untergang.
Wobei „Wasser“ nicht einmal identisch mit „Meer“ sein muss. Das Grauen sickert in „Dunkles Wasser“ aus einem simplen Hahn. Allerdings gilt es die Details zu beachten, die Suzuki, der sich ansonsten einer sehr nüchternen Sprache bedient, fast beiläufig einstreut: Das Haus, in dem besagte verfluchte Badewanne steht, wurde auf Müll errichtet, mit dem man einen Teil der Bucht von Tokio aufgeschüttet hat. Da ist es also wieder, das Symbol des wilden Wassers, das sich von der Zivilisation nie wirklich bändigen lässt.
„Echter“ Spuk macht sich übrigens eher rar in Suzukis Geschichten. Höchstens „Traumschiff“ und „Die Flaschenpost“ können mit Gästen aus dem Jenseits rechnen, die indessen nur eine Nebenrolle spielen, quasi nur im Augenwinkel aufscheinen und dadurch um so nachdrücklicher wirken, wenn man sich denn auf dieses Spiel einlässt. „Wassertheater“ präsentiert einfach eine groteske Geschichte, deren „Auflösung“ vor allem deshalb überrascht, weil sie mit den Mitteln der Phantastik erzählt wird. „Der unterirdische See“ ist pures psychologisches Grauen. Hier wandelt Suzuki in der Tat auf den Spuren von Stephen King- und dessen Schuhe sind ihm beileibe nicht zu groß!
Menschen unter Druck und in Ausnahmesituationen sind es, von denen Suzuki erzählt. Sie stecken latent bereits in einer Krise, deren Ursprünge in die Vergangenheit reichen. Wir treffen sie zu jenem Zeitpunkt, an dem der Seelenkessel überkocht. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Die labile Mutter aus „Dunkles Wasser“ verbeißt sich förmlich in ihre Theorie, von einer untoten Wasserleiche verfolgt zu werden, die sie sich – Suzuki bleibt da meisterlich vage – durchaus nur einbilden kann. Der unzufriedene Lehrer aus „Die einsame Insel“ bastelt sich sein „Gespenst“ ebenfalls in der Werkstatt seiner angeschlagenen Psyche. Die „Strafe“ ereilt einen Fischer, der nicht nur das Opfer seiner brutalen „Erziehung“ wurde, sondern in dessen Familie eine erbliche Geisteskrankheit grassiert.
Auf die Höllen, die sich diese Menschen schaffen, kann ein böser Geist eigentlich nur neidisch sein. Selbst ein halbwegs handfester Spuk wie der unfreundliche Gast im „Flaschenschiff“ kann sich darauf beschränken, vorhandene Dissonanzen der Seele zu verstärken; für Horror und Tod sorgen die Betroffenen dann selbst. „Wassertheater“ und „Der unterirdische See“ kommen sogar gänzlich ohne Gespenster aus; in der letzten Geschichte erweckt Suzuki nicht einmal den Anschein, es ginge nicht mit rechten Dingen zu. Ein verzweifelter Mann in einer grabesdunklen Höhle – das reicht ihm uns, seine Leser, in Angst & Schrecken zu versetzen.
Anmerkung 1: „Dark Water“ multimedial
Die Veröffentlichung einer japanischen Sammlung phantastischer Geschichte ist wahrlich keine Alltäglichkeit auf dem hiesigen Buchmarkt. „Dark Water“ verdankt seine deutsche Inkarnation dem unverhofften Ruhm des Kôji Suzuki, der mit dem Multimedia-Phänomen der „Ring“-Saga einen echten Kult ins Leben rief. Nachdem auch Hollywood aufmerksam geworden war und den ersten Teil erfolgreich neu verfilmte (Fortsetzung folgt), dauerte es nicht lange, bis in der Hoffnung auf eine weitere Scheibe vom Kuchen auch Suzukis übrige Werke übersetzt wurden. (Allerdings greift |Heyne| für „Dark Water“ wieder einmal auf die US-amerikanische, d. h. die ihrerseits schon aus dem Japanischen übersetzte Fassung zurück …)
„Dark Water“, die deutsche Version, weist sich mit einem Aufkleber als Träger der „Originalvorlage zum großen Kino-Schocker“ aus. Wahr ist immerhin, dass „Dunkle Wasser“ ein Drehbuch inspirierte, das 2002 „Ring“-Regisseur Hideo Nakata in Japan unter diesem Titel verfilmte. 2004 folgte unter der Regie von Walter Salles erneut eine US-Fassung mit Jennifer Connelly, Tim Roth und Shelley Duvall, was den |Heyne|-Verlag dazu veranlasste, auf den „Ring“-Zauber zu setzen, der hoffentlich erfreuliche Verkaufszahlen für das „Buch zum Film“ (das eigentlich nur das „Buch mit einer Geschichte zum Film“ ist) bedingt …
Anmerkung 2: „Dark Water“ mangatisch
Nicht enthalten sind in der deutschen Fassung von „Dark Water“ übrigens die Illustrationen des Künstlers Meimu, der in seiner japanischen Heimat als Superstar der dortigen Manga-Szene gilt. Besagter Meimu hat auch eine reine Manga-Version von „Dark Water“ gestaltet, die in Deutschland der |Egmont|-Verlag 2005 auf den Markt bringt.
Anmerkung 3: „Dark Water“ verwässert
Eine besondere Erwähnung „verdient“ die unrühmliche Gestaltung, die der |Heyne|-Verlag „Dark Water“ angedeihen ließ. Hier sollte sehr offensichtlich ein ursprünglich recht schmales Buch „auf Umfang gebracht“ werden. Durch breite Ränder und den sehr großzügigen Einsatz von Vorsatzblättern zu den einzelnen Kapiteln wird der Band mehr schlecht als recht auf knapp über 300 Seiten gepumpt, wo 200 vermutlich gereicht hätten. Die Kosten für die Differenz übernimmt wohl oder übel der Leser …
Kôji Suzuki, der „Stephen King aus Japan“ (ein Etikett der Werbestrategen) wurde 1957 in Hamamatsu (Präfektur Shizuoka) geboren. Bereits in jungen Jahren begann er zu schreiben und gewann 1990 als Absolvent der |Keio University| in Tokio einen (japanischen) „Fantasy Novel Award“ für seinen Roman „Rakuen“, was aber seiner dümpelnden Karriere kaum Auftrieb gab. Das änderte sich erst, als Suzuki 1991 die Welt der Phantastik um ein verfluchtes Videoband bereicherte: Die „Ring“-Saga war geboren. Aus einem Geheimtipp wurde Gruselvolkes Eigentum, als Regisseur Hideo Nakata 1998 den Roman verfilmte. Trotz vieler Veränderungen wurde „Ring“ zum Erfolg, der selbstverständlich mehrfach fortgesetzt wurde sowie die übliche verwässerte Hollywood-Interpretation erfuhr.
Suzuki selbst erweiterte den „Ring“-Erstling zur Romantrilogie, der er noch einen vierten Band mit Kurzgeschichten folgen ließ. Acht Millionen Exemplare soll er inzwischen verkauft haben, was zweifellos auch der geschickten Vermarktung zu verdanken ist: Suzukis Werke sind als Buch, Film und Manga quasi allgegenwärtig.
Dean R. Koontz – Nackte Angst / Phantom

Preston, Douglas / Child, Lincoln – Ritual – Höhle des Schreckens
Medicine Creek, Cry County, ist ein sterbendes Städtchen im US-Staat Kansas. Hier lebt man mehr schlecht als recht von der Landwirtschaft. Riesige Maisfelder prägen das Bild; sie werden von großen Konzernen betrieben, während immer mehr örtliche Farmer aufgeben müssen.
Deshalb ist auch das eher fragwürdige Angebot einer Universität, ein Versuchsfeld mit genmanipuliertem Mais anzulegen, sehr willkommen, denn Geld und Arbeitsplätze winken. Dass es gute Gründe geben könnte, wieso die im Sold der Pharmaindustrie stehenden Forscher sich in einem möglichst entlegenen Winkel ansiedeln möchten, reden sich die verzweifelten Bürger schön.
Noch ist die Entscheidung für Medicine Creek nicht gefallen. Zwischenfälle sind daher höchst unwillkommen. Sheriff Dent Hazen, der energische, aber etwas denkfaule Sheriff, soll sie gefälligst verhindern oder vertuschen. Doch das gelingt nicht mit dem grausigen Mord, der auch überregional für Aufruhr sorgt: In einem Maisfeld findet man aufgebahrt zwischen toten Krähen die grässlich verstümmelte Leiche einer Frau.
Die mysteriösen, geradezu übernatürlich anmutenden Umstände der Untat locken den mit Spuk und Serienmord vertrauten FBI-Agenten Pendergast nach Medicine Creek. Der eigenwillige Mann schafft sich mit seiner Ankündigung weiterer Morde keine Freunde. Leider behält er Recht. Die nächsten Leichen sehen sogar noch schlimmer aus.
Spuren weisen zurück in die Vergangenheit. 1865 haben wütende Cheyenne-Indianer die berüchtigten Marodeure der „Fünfundvierziger“-Bande bei Medicine Creek überfallen und abgeschlachtet. Kehren sie oder ihre Opfer aus dem Jenseits zurück? Oder landen nachts Außerirdische in den Maisfeldern, um mit den Erdmenschen zu „experimentieren“?
Sheriff Hazen verdächtigt eher Neider, die den Genforschern Medicine Creek verleiden wollen. Er stellt Pendergast kalt und verfolgt lieber Mörder von dieser Welt. Unabhängig voneinander richten der Sheriff und der FBI-Agent ihre Augen auf Kraus‘ Kavernen, ein gewaltiges Höhlensystem, das sich unter der Erde wer weiß wohin erstreckt. Sie behalten beide Recht, was aber unkommentiert bleibt, als unter Tage ein Kampf auf Leben & Tod entbrennt …
Wobei die eigentliche Erklärung dem Rätsel von Medicine Creek wieder einmal nicht gewachsen ist. Sie soll angeblich überraschen, worauf man als Leser freilich lieber nicht wetten sollte, da „Ritual“ zwar jederzeit spannend, aber niemals verblüffend ist.
Die schier endlosen Maisfelder des Mittleren US-Westens haben seit jeher etwas Magisches und Unheimliches an sich. Der nüchterne Betrachter sieht nur öde Pflanzungen, aber der Romantiker fühlt sich verloren und beengt zwischen den übermannshohen, raschelnden, stickig riechenden Stauden, in deren Schutz sich unerfreuliche Besucher unbemerkt anschleichen können. Stephen King siedelte die Menschen opfernden „Kinder des Zorns“ im Mais an, M. Night Shyamalan ließ in „Signs“ die Außerirdischen dort landen, zuletzt sprang Jason Vorhees mit seiner Machete aus dem Mais, um eine Horde haltloser Teenager niederzumetzeln („Freddy vs. Jason“).
Von oben betrachtet, wirken diese Maiswälder wie ein Meer, unter dessen Oberfläche sich allerlei verbergen kann. Preston/Child bedienen sich zusätzlich, aber wenig innovativ der Historie, die in Kansas vergleichsweise unspektakulär ablief. Man blickt allerdings auf die Indianerkriege zurück – keine ruhmreiche Episode, aber eine, die in vielen Köpfen präsent ist und die sich in einen Gruselplot einbauen lässt.
Zur Abwechslung sind es nicht die Indianer, die hingeschlachtet wurden und als rächende Geister zurückkehren. Politisch korrekt hat es einst weiße Strolche erwischt, die ihr wüstes Ende wohl verdient hatten. Ob sie es sind, die Medicine Creek heimsuchen, soll hier nicht verraten werden.
Ohnehin gehen die Verfasser auf Nummer Sicher. Die Rache aus der Vergangenheit wird mit möglichen Drohungen aus dem All konterkariert. Berühmt (und berüchtigt) sind die Kornkreise geworden, mit denen die Besucher vom Planeten Schizophrenia VI ihren Kumpanen signalisieren, dass hier auf der Erde reiche Beute lockt, die man erschrecken, in ihre Fliegenden Untertassen entführen und schwängern kann. (Bordfunk scheint in fremden Welten unbekannt zu sein.) Deshalb könnten es auch gar nicht spukige, doch deshalb nicht weniger unheimliche Gestalten sein, die des Nachts durch die Feldfurchen stolpern. (Wieso sie dabei wie eine Kuh brüllen, fällt aber nicht nur dem überschlauen Pendergast ziemlich früh ein, sondern auch dem Leser, wie man den Verfassern leider vorwerfen muss.)
Medicine Creek ist eine überschaubare Kulisse: ein Flecken mit 150 Einwohnern, umgeben von Maisdschungeln. Weiterhin gibt’s eine alte Begräbnisstätte und eine Höhle, so dass es nicht schwer fällt zu raten, wo sich denn das Grauen verbirgt. Nur die Anwohner sind, wie es sich gehört, mit Blind- und Blödheit geschlagen. Um dem Finale die gebührende Bildgewalt zu verleihen, bricht selbstverständlich das schlimmste Unwetter des Jahrhunderts los. Die Auflistung weiterer Grusel-Bausteine sei den Lesern hier erspart, aber sie seien versichert: Preston/Child graben sie alle aus!
Spannend ist das Garn dennoch, das unser Verfasserduo hier spinnt. Preston und Child sind Profis darin, die immer identischen Module ihrer Spannungsgeschichten neu zu arrangieren. Wirklich spannend im Sinne von überraschend ist das nie, aber es liest sich angenehm und selten langweilig. Um zu diesem günstigen Urteil zu kommen, muss man freilich die Erkenntnis verdrängen, dass „Ritual“ über weite Strecken nichts als ein 1:1-Remake von „Relic“ ist, dem ersten und weiterhin besten Werk von Preston/Child.
Rein gar nichts mit der Medicine-Creek-Handlung haben diverse Kapitel zu tun, die in New York und in den Gewölben des Kuriositätenkabinetts spielen, das Schauplatz des Preston/Child-Thrillers „The Cabinet of Curiosities“ (2002; dt. [„Formula – Tunnel des Grauens“ 192 ) war. Damals waren noch einige Fragen offen geblieben, was vor allem die merkwürdigen familiären Hintergründe und Verwicklungen des Agenten Pendergast in das mörderische Geschehen betraf. Offenbar wollen die Autoren eine Pendergast-Saga entwickeln. Gut und schön, aber die sollte dann integraler Bestandteil der Story und dieser nicht aufgepfropft sein!
Agent Pendergast soll nach dem Willen seiner geistigen Väter eine ebenso faszinierende wie fremdartige Person (bzw. Persönlichkeit) sein. Dunkel und von Geheimnissen umwittert ist seine Vergangenheit, exzentrisch sein Verhalten. Als Ermittler ist er genial, übersieht keine Spuren, durchschaut Verdächtige auf Anhieb, bricht unentwegt Lanzen für unverstandene Außenseiter der Gesellschaft. Anders ausgedrückt: Pendergast ist eine hundertprozentige Kunstfigur und ein übler und reichlich arroganter Besserwisser, wie er uns aus tausend Hollywood-Blockbustern mehr als bekannt ist.
Seine Schnurren sind zu zahlreich und übertrieben, werden einfach behauptet, statt begründet zu werden; offenbar bleibt dies zukünftigen Bänden der Pendergast-Serie vorbehalten. Auf Biegen und Brechen, aber mit einfachsten Mitteln soll die Hauptfigur „interessant“ gemacht werden. Meist geht der Schuss nach hinter los. Wir ertragen Pendergast, aber er ist uns völlig gleichgültig.
Ähnlich durchsichtig ist die Figur der Corrie Swanson angelegt: Sollte „Ritual“ dereinst verfilmt werden, benötigt das Drehbuch unbedingt eine Identifikationsfigur für die jüngere Zuschauerschaft, die besonders kopfstark in die Kinos drängt. Also erleben wir eine völlig absurde „Assistentin“, die wieder einmal brachial den unverstandenen und (in Maßen) aufmüpfigen Teen mimen muss. Ungewöhnlich ist indessen, dass es außer Corrie keine weibliche Hauptrolle gibt und diese kein „love interest“ ist – eine Liebesgeschichte bleibt aus und wird in einer Geschichte dieses Kalibers auch gar nicht vermisst.
Ansonsten tummelt sich niveaugerecht allerlei US-Landvolk im Geschehen. Das angebliche „Salz der Erde“ gibt sich rollentypisch bodenständig, fremdenfeindlich, konservativ und drischt mehr markige Sprüche als Mais. Dent Hazen ist der bärbeißige Sheriff par excellence – vierschrötig, engstirnig, aber irgendwie doch tüchtig und sympathisch in seiner selbstgerechten Emsigkeit. Journalisten sind die Pest, Politiker notorisch verlogen, Firmenbosse wirtschaften in die eigenen Taschen; auch hier ist der Leser vor Überraschungen gefeit.
Douglas Preston wurde 1956 in Cambridge, Massachusetts geboren. Er studierte ausgiebig, nämlich Mathematik, Physik, Anthropologie, Biologie, Chemie, Geologie, Astronomie und Englische Literatur. Erstaunlicherweise immer noch jung an Jahren, nahm er anschließend einen Job am |American Museum of Natural History| in New York (!) an. Während der Arbeit an einem Sachbuch über „Dinosaurier in der Dachkammer“ – gemeint sind die über das ganze Riesenhaus verteilten, oft ungehobenen Schätze dieses Museums – arbeitete Preston bei |St. Martin’s Press| mit einem jungen Lektor namens Lincoln Child zusammen. Thema und Ort inspirierten das Duo zur Niederschrift eines ersten Romans: „Relic“.
Wenn Preston das Hirn ist, muss man Lincoln Child, geboren 1957 in Westport, Connecticut, als Herz des Duos bezeichnen. Er begann schon früh zu schreiben, entdeckte sein Faible für das Phantastische und bald darauf die Tatsache, dass sich davon schlecht leben ließ. So ging Child – auch er studierte übrigens Englische Literatur – nach New York und wurde bei |St. Martins Press| angestellt. Er betreute Autoren des Hauses und gab selbst mehrere Anthologien mit Geistergeschichten heraus. 1987 wechselte Child in die Software-Entwicklung. Mehrere Jahre war er dort tätig, während er nach Feierabend mit Douglas Preston an „Relic“ schrieb. Erst seit dem Durchbruch mit diesem Werk ist Child hauptberuflicher Schriftsteller.
Selbstverständlich haben die beiden Autoren eine eigene Website ins Netz gestellt. Unter http://www.prestonchild.com wird man großzügig mit Neuigkeiten versorgt (und mit verkaufsförderlichen Ankündigungen gelockt).
Inzwischen gehen Preston und Child schriftstellerisch auch getrennte Wege. 2002 verfasste Child „Utopia“ (dt. „Das Patent“), 2004 zog Preston mit „Codex“ nach. Die Unterschiede zum Gemeinschaftswerk sind eher marginal. Weiterhin stellt sich heraus, dass die Alleinautorenschaft in beiden Fällen keineswegs mit dem Drang zur Originalität einher geht. Wiederum gemeinsam ging es 2004 mit „Brimstone“ weiter, dem nächsten Pendergast-Spektakel.
Douglas Preston ist übrigens nicht mit seinem ebenfalls schriftstellernden Bruder Richard zu verwechseln, aus dessen Feder Bestseller wie „The Cobra Event“ und „The Hot Zone“ stammen.
Pelot, Pierre – keltische Grab, Das
An der Universität von Rennes möchte Chloé Séverin Geschichte und Ethnologie studieren. Der Ort ist gut gewählt, denn just haben im geheimnisvollen Wald von Brocéliande groß angelegte Ausgrabungen begonnen. Ein gewaltige keltische Kultstätte wurde dort gefunden. Vor zwei Jahrtausenden haben Druiden an diesem Ort ihre mysteriösen Zeremonien abgehalten.
Was die Wissenschaftler (noch) nicht ahnen: Besagte Druiden geboten einst über einen okkulten Wachschutz. Bei Bedarf erweckten sie gegen ihre Feinde einen urzeitlichen Dämonen: die fürchterliche Furie Morrigane. Der gefiel es noch nie in ihrer privaten Hölle, die sie gar zu gern verlässt, um Mord & Schrecken über die Menschen zu bringen.
Chloé sieht sich zu ihrem Schrecken in diverse unheimliche Ereignisse verwickelt. Vor ihren Augen wird des Nachts ein irischer Gelehrter von einem Ungeheuer in Stücke gerissen. Die Polizei kann keine Spuren entdecken und tippt sich viel sagend an den Kopf. Das Monster verfolgt anschließend Chloé; besser gesagt: Es bewacht sie.
Die junge Frau hat inzwischen Freunde gefunden und macht sich daran, das Rätsel zu lüften. Der berühmte Professor Brennos scheint weitaus mehr zu wissen als er bereit ist zuzugeben. Die Archäologen der Universität finden im Fort von Brocéliande immer mehr Spuren, die zur Beunruhigung Anlass geben.
Immer deutlicher werden für Chloé die Hinweise auf ein schreckliches Geschehen, in dem sie die Hauptrolle spielt. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November berühren sich die Welten der Lebenden und der Toten: Samhain, heute Halloween genannt, ist blutige Realität. Morrigane benötigt ein letztes Menschenopfer, dann wird sie ihre Schreckensherrschaft antreten. Wer diese Rolle übernehmen soll, erfährt Chloé, als es für sie beinahe zu spät ist …
Manche Horrorromane gleichen den Spukgestalten, von denen sie erzählen: Es sollte sie eigentlich gar nicht geben, aber trotzdem existieren sie, denn sie sind verflucht. Gespenster, Dämonen und andere Bewohner der Unterwelt sind freilich unterhaltsamer als dieses Buch. Das ist außerordentlich überflüssig weil langweilig, vorhersehbar und in seiner dunklen Liebe zum abgedroschenen Klischee wahrhaft höllisch.
Grundsätzlich ist es lobenswert, dass sich europäische Unterhaltungsautoren auf ihr reiches mythologisches und historisches Erbe berufen. Der alte Kontinent birst praktisch vor fabelhaften Geschichten. Die Kelten sind ideal als Ausgangspunkt – ein hoch zivilisierter, aber immer noch wenig bekannter, fremd wirkender Verbund von Stämmen, deren kultisches Treiben heutzutage überaus bizarr und grausam anmutet.
Leider bleibt davon in der literarischen oder filmischen Umsetzung allzu oft nur das Bild hakennasiger Druidenpriester mit Rauschebart im Wallewallelaken („Modell Miraculix“), die kreischende Gefangene auf Altarsteine zwingen und mit der Sichel aufschlitzen, während wohlgestalte Tempeldienerinnen heidnisch nackt die Szene umtanzen. Auch bei Pierre Pelot läuft es letztlich genau darauf hinaus.
Bis es so weit ist, reihen sich langweilige Ankündigungen drohenden Unheils aneinander, die selbst im Halbschlaf als solche zu erkennen sind und ganz & gar nicht fesseln können. Wie üblich gibt sich die Heldin ausgesprochen dämlich; sie bleibt irgendwie die einzige, die einfach nicht begreifen will, was sich da abspielt.
Sie ist eine schreckliche Nervensäge, die arme Chloé. Ihr bleibt gar keine Alternative, denn sie muss die übliche Rolle des schönen Opfers im minderbemittelten Gruselschocker übernehmen. Chloé ist folglich vom Schicksal arg gebeutelt, trotzdem überaus reizvoll anzuschauen, aber ein „gutes Mädchen“, das viele wertvolle Gedanken (die sie den Lesern leider nicht vorenthält) bezüglich der Frage wälzt, mit wem sie denn ihr schmales Studentenlager teilen könnte. Kurz und schlecht: Chloé ist eine fade und langweilige Figur, der man schließlich insgeheim wünscht, dass ihr Schädel die Kultstätte von Brocéliande schmücken möge.
Wer sich sonst noch dort oder auf dem Campus von Chloés Uni herumdrückt, wurde ebenfalls nach Schema F geformt. Die Schurken in dem trüben Schauspiel bleiben nur für Chloé unerkannt, und dass ihre angeblichen „Freunde“ bis zum Hals im keltischen Komplott stecken, ist auch nur für sie eine Überraschung.
Was Morrigane will in der Welt des 21. Jahrhunderts, muss ihr Geheimnis bleiben. So ist das oft mit heraufbeschworenen Ungeheuern: Ihnen bleibt keine Zeit, sich über moderne Zeiten zu wundern, denn in letzter Sekunde werden sie von heldenhaften Geisterjägern zurück in die Hölle befördert. So auch dieses Mal – und das ist kein Spoiler, der erwartungsvollen Lesern den Spaß verderben könnte, sondern die traurige Realität einer Geschichte, deren Ablauf schon nach den ersten fünf Seiten absolut klar ist, bis sie in ein jämmerliches Finale mündet, das an Lächerlichkeit schwer zu übertreffen ist.
„Brocéliande“ ist das Buch zum gleichnamigen Spielfilm, der 2002 in Frankreich entstand. Unter dem Titel „Pakt der Druiden“ ist dieser auch in einer deutschen Fassung erhältlich. Regisseur Doug Headline (= Jean Manchette) schuf einen Gruselstreifen, der daheim in den Kinos floppte und in Deutschland gleich auf DVD bzw. Video veröffentlicht wurde; dort gehört er auch hin, denn da ist rein gar nichts, das dieses Werk aus der Flut ähnlicher Horrorfilme ragen lässt.
Pierre Pelot (geb. 1945) ist ein Veteran der Unterhaltungsliteratur, der sich seit vier Jahrzehnten in allen Genres tummelt. (Wer der französischen Sprache mächtig ist, findet seine sehr interessante Website unter http://perso.club-internet.fr/ppelot/index.htm.) Dass er sich nicht zu schade ist, Filmdrehbücher in Romane umzusetzen, bewies er u. a. mit dem Buch zum ungleich gelungeneren Horrorfilm „Der Pakt der Wölfe“. Vermutlich ist der Erfolg dieser Geschichte, die auch in Deutschland erschien, der Grund für die Veröffentlichung des neuen Machwerks, welches hoffentlich wie die Morrigane bald wieder vom Erdboden verschwunden ist.
Grin, Alexander / Gilbert, Stephen / Howart, Harald / Alpers, Hans Joachim – Tod durch Ratten
Ratten haben ein schlechtes Image. Sie sind weder possierlich noch niedlich, sondern gelten als gerissen und hinterhältig. Sie leben zu Tausenden in den Großstädten und führen dennoch ein schattenhaftes Dasein. Ihr Äußeres wirkt abstoßend, und gerade ihr langer, nackter Schwanz sorgt beim menschlichen Betrachter für Ekelgefühl. Ihre Existenz, ihre schiere Zahl sorgt beim Menschen für instinktive Angst, nicht zuletzt, weil Ratten als Krankheitsüberträger gelten und im Mittelalter die Pest verbreiteten. Als kuscheliges Haustier ist die gemeine Ratte also kaum geeignet, doch als Protagonist in einem Horrorroman macht sie sich ausgesprochen gut. Gilt die Ratte doch als überaus intelligent – vielleicht intelligent genug, um es mit dem Menschen aufzunehmen?
Vier Romane hat der |area|-Verlag in „Tod durch Ratten“ vereint (wobei es sich nur bei zwei Texten tatsächlich um Romane handelt), um auf nicht weniger als 800 Seiten beim Leser unbehaglichen Grusel vor dem Nager auszulösen. Dabei können nicht alle Geschichten vollkommen überzeugen, auch wenn die Anthologie mit einem echten Knaller beginnt. Alexander Grins atmosphärische Novelle „Der Rattenfänger“ kommt zunächst einmal ganz ohne das unleidliche Getier aus. Ein verarmter Russe kommt, nachdem er seine Wohnung verloren hat, für kurze Zeit im verlassenen Gebäude der Zentralbank unter. Vollkommen allein in dem einsamen, labyrinthischen Geflecht von Räumen, bleiben die ersten Gruselschauer beim Protagonisten nicht lange aus. Zwar findet er durch Zufall einen Schrank, der prall gefüllt ist mit köstlichsten Lebensmitteln, doch aus ihm springt eine ganze Anzahl (naturgemäß gut genährter) Ratten. Bald vernimmt er Geräusche und undeutliches Gemurmel, wird von einer körperlosen Stimme durch die Räume gelockt und wirft schlussendlich einen Blick auf ein unheiliges Fest im Saal des Gebäudes. Grins Novelle ist der Höhepunkt von „Tod durch Ratten“. Sie gleich an den Anfang zu setzen, muss zwangsläufig dazu führen, dass die restlichen Geschichten abfallen und weit hinter der Meisterschaft des Russen zurückbleiben. Grins Darstellung der Zentralbank mit ihren endlosen Korridoren und Zimmern etabliert beim Leser einen subtilen Schauer und lässt ihn bar jeden sicheren Wissens nach der Lektüre zurück.
Weiter geht es mit Stephen Gilberts Roman „Aufstand der Ratten“, einer etwas behäbigen Geschichte über den Rachefeldzug (oder auch „Rattenfeldzug“) eines Verlierertypen, die auch unter dem Titel „Willard“ (USA, 1971 und Neuverfilmung des Stoffes 2003) verfilmt worden ist. Der Ich-Erzähler beginnt, Ratten zu zähmen und zu dressieren, natürlich, ohne jemandem davon zu erzählen, da er die Ratten ursprünglich als Ungeziefer vernichten sollte. Da ihm jegliches soziales Leben fehlt, werden die Ratten bald zu seinen einzigen Bezugspunkten. Er setzt seine Rattenarmee zunächst für einige Überfälle ein, um an Geld zu kommen. Doch dann werden seine Angriffe zunehmend persönlicher und er beginnt, die Ratten einzusetzen, um für ihm widerfahrene Ungerechtigkeiten tödliche Rache zu üben. Gilberts Ich-Erzähler ist naturgemäß kein sympathischer Typ. Eigenbrötlerisch, geheimniskrämerisch und hinterhältig, vergräbt er sich in seinem verunkrauteten Garten und plant seine Rache an der Gesellschaft. Zwar gelingt es Gilbert, die Ratte Ben als wirklich teuflisches und vernunftbegabtes Tier darzustellen, das im Geheimen seinen Ausbruch aus menschlicher Führerschaft plant, doch über weite Strecken tritt die Geschichte auf der Stelle und kann erst zum Ende hin etwas an Fahrt gewinnen. Auf jeden Fall bleibt „Aufstand der Ratten“ nach der Lektüre von Grins „Rattenfänger“ seltsam eindimensional.
Die dritte Geschichte, Harald Howarts „Tod durch Ratten“, variiert Gilberts Thema vom Menschen, der sich der intelligenten Ratte für die persönliche Rache bedient. Sein Protagonist Kreutzkamm ist ein kleines Licht an der Universität. Seit Jahren wird ihm (unberechtigerweise, wie er findet) der Professorentitel versagt. Doch nun ist ihm der Durchbruch gelungen, denn er kann mittels eines Apparates die Gehirnsströme von Ratten beeinflussen und sie so „fremdsteuern“. Sein Chef hält die Vorführung des Vorgangs für eine ausgefeilte Dressur und feuert Kreutzkamm kurzerhand, nachdem dessen cholerisches Temperament hervorgebrochen ist. Mit seinen Laborratten in der eigenen Wohnung festsitzend, plant dieser nun seine Rache an den Köpfen der Universität. Howarts Kreutzkamm ist fast schon zu böse, um noch glaubwürdig zu sein. Sein Charakter ist so auf Größenwahn und Egozentrismus ausgerichtet, dass für andere Eigenschaften kein Platz mehr bleibt. So bleibt der Autor auch Überraschungen in der Storyline schuldig. Kreutzkamms Rachefeldzug geht seinen geplanten Gang, bis der moralische Zeigefinger Howarts einschreitet, der den Schluss des Romans eher lustlos und überhastet zu Papier bringt. „Tod durch Ratten“ ist dynamischer als der Vorgänger „Aufstand der Ratten“, doch auch Howarts Roman kann nicht auf ganzem Wege überzeugen.
Die letzte Erzählung, Hans Joachim Alpers’ „Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich“, schreitet flotter voran. Der nach mysteriöser Krankheit im Rollstuhl sitzende Christoph lebt mit seiner Freundin Miriam zurückgezogen in einem kleinen Dorf. Eines Tages erhält er die Nachricht vom Tod seines alten Freundes Patrick, zusammen mit einem Packen Briefe, die ihm dieser kurz vor seinem Tod geschrieben, jedoch nie abgesendet hat. Die Staatsanwaltschaft vermutet, Patrick habe den Verstand verloren und so sein Ende herbeigeführt, denn in den Briefen wird Unglaubliches berichtet. Ratten seien auf einmal in seinem Haus gewesen, die nur er sehen konnte. Seine Freundin habe Ungeziefer in sein Essen gemischt und schließlich seinen Mord geplant. Christoph ist bei der Lektüre der Briefe hin- und hergerissen. Ebenso wie der Leser mag er mal an Wahnsinn, mal an eine übernatürliche Erklärung glauben. Alpers arbeitet sein Sujet überzeugend aus, lässt einige Informationen fallen und versucht den Leser auf falsche Fährten zu führen. Die Auflösung rundet die straff durcherzählte Handlung konsequent ab und weist Alpers als routinierten Erzähler aus.
Ein ganzes Buch nur mit dem Thema Ratten zu füllen, ist eine originelle Idee, doch schwankt die Qualität der Geschichten zu stark, um an dem Buch durchweg Spaß zu haben. Alexander Grins Novelle „Der Rattenfänger“ ist ohne Frage die beste Geschichte in der Sammlung und lohnt die Lektüre in jedem Fall. Stephen Gilberts „Aufstand der Ratten“ dagegen bildet qualitativ das Schlusslicht und erscheint zu bieder, um durchgehend unterhalten zu können.
Hawkes, Judith – kalte Hauch des Flieders, Der
Für David und Sally Curtiss geht ein Traum in Erfüllung. Die jungen Parapsychologen haben anscheinend ein „richtiges“ Spukhaus gefunden. Ist dies der Durchbruch für die viel belachte und verspottete „Wissenschaft von Dingen, die es nicht geben kann, aber trotzdem gibt“? Im Auftrag eines privaten Forschungsinstituts sollen sie den Gerüchten um Geistererscheinungen im Gilfoy-Haus auf den Grund gehen.
„Ihr“ Haus steht in Skipton, einer kleinen, verträumten Stadt im Westen des neuenglischen US-Staates Massachusetts. Auf den ersten Blick wirkt sein Anblick ernüchternd; es wurde zwar in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut, aber Samuel Collins Gilfoy, der Bauherr, war ein sachlich denkender Mann, der für den überladenen Stil des viktorianischen Zeitalters nichts übrig hatte.
Die Recherchen lassen sich zäh an. Das Gilfoy-Haus stand lange leer, bevor sich David und Sally vor zwei Wochen dort eingemietet hatten. Frühere Bewohner sind verstorben oder unbekannt verzogen oder weigern sich, von ihren Erlebnissen im Haus zu berichten. Die wenigen Zeugen liefern vielversprechende, aber einander widersprechende Aussagen. David und Sally selbst fanden noch kein einziges Anzeichen für übernatürliche Ereignisse, obwohl sie das Haus vom Keller bis zum Dachboden untersucht und überall modernste technische Aufzeichnungsgeräte aufgestellt haben. Sally, die über hellseherische Fähigkeiten verfügt, hat allerdings bereits einige Unstimmigkeiten bemerkt, die sie David indessen verschweigt; mit der Ehe der beiden Wissenschaftler steht es nicht zum Besten, doch sie lassen den Konflikt schwelen, statt sich auszusprechen.
David lädt Rosanna, ein weibliches Medium, ins Gilfoy-Haus ein, und während einer Séance gelingt es endlich, Kontakt zu einem der „Hausgeister“ aufzunehmen. Wer es ist, bleibt aber unklar; die Indizien weisen auf Julian Gilfoy hin, der 1906 in jungen Jahren und unter ungeklärten Umständen im Haus zu Tode kam.
Endlich mehren sich die Zeichen für einen echten Spuk im Gilfoy-Haus. Während David dies mit wachsender Begeisterung registriert, keimt in Sally Besorgnis auf. Der Geist des Hauses scheint langsam Besitz von David zu ergreifen, der dies entschieden abstreitet. Sein Interesse verwandelt sich langsam in eine Obsession. Schließlich verlässt Sally das Gilfoy-Haus, während ihr Ehemann zurückbleibt. Kurze Zeit später ruft er sie an und teilt ihr mit, er habe das Haus ‚gereinigt‘. Sally kehrt zurück, doch als sie das Haus betritt, weiß sie nicht, wer sie dort empfängt – David oder Julian …
Das verwunschene, von Geistern heimgesuchte Haus – eines der ältesten Sujets der fantastischen Literatur und ein Dauerbrenner bis auf den heutigen Tag. Mitten im eigenen Heim, dort, wo man sich sicher glaubt und Zuflucht vor den Beschwernissen des Alltags sucht, wird man von übernatürlichen, unsichtbaren Kräften geplagt – ein Albtraum, der in zahllosen Büchern und Filmen, Comics und Computer-Spielen eifrig heraufbeschworen wird.
Im Subgenre der Geisterhaus-Literatur gibt es einige geradezu klassische Themen. Sehr beliebt ist die Geschichte von der harmlosen Durchschnitts-Familie, die ahnungslos in ein Spukhaus einzieht, um dort aus dem Jenseits gepiesackt zu werden (das „Poltergeist“/“Amityville“-Muster). Hawkes greift ein zweites, ebenso beliebtes Motiv auf: Eine Gruppe von Wissenschaftlern untersucht ein heimgesuchtes Haus. Anfangs noch skeptisch und mit allem ausgerüstet, was Labors und Forschungsstätten hergeben, müssen sie auf die harte Tour lernen, dass es tatsächlich Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die sie (bzw. die Schulweisheit) nicht erklären können.
„Der kalte Hauch des Flieders“ ragt aus der Flut der Spukhaus-Romane zunächst ein gutes Stück heraus. Hawkes geht recht sachlich an das Thema heran. Von vornherein vermeidet sie es, mit billigen Tricks Spannung zu erzwingen. Es gibt keine in Gefahr zu bringenden Kinder (allerdings einen niedlichen Hund …), keinen verrückten, missgestalteten „Gast“, der sich im Keller oder auf dem Dachboden versteckt, keine verbotene Liebe, die einst tragisch endete und aus dem Jenseits fortgesetzt wird, oder was der abgegriffenen Klischees mehr sind. Die Autorin hat ausführliche Recherchen über das Thema PSI in allen seinen schillernden Farben angestellt. Ihre Kenntnisse lässt sie oft und gern in die Geschichte einfließen, aber solche Exkurse wirken nicht aufgesetzt, sondern informativ.
Überhaupt verschweigt Hawkes niemals die vielen Schwierigkeiten, der sich moderne „Geisterjäger“ ausgesetzt sehen. Die Parapsychologie ist ein junger und höchst ungeliebter Seitentrieb am Baum der Wissenschaft, dem die meisten „seriösen“ Forscher zu gern mit einer scharfen Axt zu Leibe rücken würden. Die Erforschung des Jenseits ist eine undankbare Aufgabe, da die Geister, so es sie denn gibt, leider keinerlei Interesse daran haben, sich der Welt der Lebenden unter Bedingungen zu präsentieren, die Betrug, Fehlinterpretation oder Halluzination definitiv ausschließen. Die Folge: Obwohl es die Anhänger des Okkulten vehement abstreiten, ist es bisher niemals gelungen, schlüssige und wirklich überzeugende Beweise für „das Jenseits“ zu erbringen. (Den Quantenphysikern geht es übrigens ebenso, aber das scheint seltsamerweise niemanden zu stören …)
Die Ausgewogenheit, mit der sich Hawkes ihrem Thema nähert, bedingt denn auch die gravierende Schwäche des Buches: Die Autorin konnte sich niemals wirklich entscheiden, ob sie nun einen „echten“ PSI-Roman oder einen Psycho-Thriller schreiben sollte. Spukt im Gilfoy-Haus nun der Geist des unglücklichen Julian umher? Ist das Haus nur eine „Batterie“, welche Wut und Unglück seiner längst verstorbenen Bewohner gespeichert hat? Haben sich David und Sally so sehnsüchtig einen „echten“ Geist gewünscht, dass sie ihn quasi selbst erst ins Leben gerufen haben? Interpretieren sie Vorkommnisse als Botschaften aus dem Geisterreich, für die es bei nüchterner Betrachtung völlig natürliche Ursachen gibt? Hawkes hält sich alle Optionen offen; der Leser soll selbst entscheiden. Leider bleibt dadurch auf den letzten zweihundert Seiten die Spannung allmählich auf der Strecke. Ein echter Höhepunkt bleibt aus.
Natürlich ist es klug, die subtil entwickelte Atmosphäre nicht durch ein Pandämonium urplötzlich aus allen Mauerritzen und Parkettspalten hervorquellender Gespenster zu zerstören, aber so läuft die Handlung einfach allmählich aus. Der eigentliche Schluss ist zwar logisch, andererseits aber doch nicht so neu oder originell, dass er dies ausgleicht. „Der kalte Hauch des Flieders“ (der Titel widerspricht übrigens entschieden dem Anspruch auf subtilen Tiefgang, den der Rowohlt-Verlag erhebt – „Julians Haus“ wäre korrekt und angemessen gewesen, doch offensichtlich traut man dem dummen deutschen Grusel-Fan nicht zu, ein Buch mit diesem Namen aus dem Regal zu ziehen) ist aber auf jeden Fall eine schöne Abwechslung von den Dampfhammer-Schockern à la King, Koontz oder Hohlbein, die seit einigen Jahren zumindest in den großen Verlagshäusern die Programmplätze für fantastische Literaturtitel blockieren.
Kelley Armstrong – Die Nacht der Wölfin
Sie sind schon ein rares Völkchen: Etwa 35 Werwölfe nur durchstreifen die Welt, doch da es keine Meldepflicht gibt, wissen sie es selbst nicht ganz genau. Eines ist allerdings sicher: Unter ihnen weilt nur eine einzige Werwolf-Frau, denn das entsprechende Gen wird ausschließlich in der männlichen Linie vererbt. Allerdings lässt auch der Biss des Werwolfs eines dieser mystischen Wesen entstehen, die sich in regelmäßigen Abständen in einen Wolf verwandeln müssen, der des Nachts Tiere und hier und da auch einen Menschen jagt. Üblicherweise überlebt das Opfer die Verwandlung zum Werwolf nicht oder wird getötet, doch Clayton hat den Kodex seiner Art stets recht flexibel ausgelegt. Liebe und Selbstsucht – die Übergänge sind bei einem Werwolf reicht fließend – brachten ihn vor nun über zehn Jahren dazu, seine damalige Verlobte Elena Michaels auf die beschriebene Weise zu seinesgleichen zu machen – für die junge, nach einer furchtbaren Kindheit ohnehin labile Frau der Beginn eines Martyriums, das mit dem Schrecken der ersten Verwandlung nur begann.
Ihr Überleben und Einfinden in die neue Existenz verdankt Elena Jeremy Danvers, dem gewählten Anführer oder „Alpha-Wolf“ des „Rudels“, dem die meisten Werwölfe Nordamerikas angehören. Hier finden sie Rat und Hilfe in der Not, hier werden sie aber auch an die Kandare genommen, sollten sie allzu heftig über die Stränge schlagen, denn das oberste Gebot lautet: Vermeide die Aufmerksamkeit des Menschen! Jeremy hat ein schweres Amt angetreten; längst nicht alle Werwölfe gehören zum Rudel oder fühlen sich seinen Regeln unterworfen. Die „Mutts“ oder Streuner sind Einzelgänger, die nicht selten von ihrem Jagdtrieb überwältigt werden und dann vom Rudel zur Ordnung gerufen – oder ausgeschaltet werden müssen. Elena verwaltete bis vor einem Jahr das Archiv des Rudels. In Stormhaven, der palastartigen, streng abgeschirmten Zentrale im abgelegenen Norden des US-Staates New York, behielt sie die Population der Werwölfe im Auge. Doch der innere Konflikt und die Hassliebe zum besitzergreifenden Clayton ließen sie mit dem Rudel brechen. Inzwischen hat sich Elena im kanadischen Toronto eine Existenz als Journalistin aufgebaut und lebt sogar in einer festen Beziehung mit dem Geschäftsmann Philip, der es gelernt hat, sich mit den Marotten seiner Lebensgefährtin abzufinden, die des Nachts gern lange, einsame Spaziergänge unternimmt …
Doch nun ereilt Elena erneut der Ruf des Rudels: Gefahr droht durch den charismatischen, aber moralisch verkommenen Karl Marsten, der die Mutts zur Rebellion anstachelt. Unter seiner Führung sollen sie das Rudel auslöschen, so dass er allein das Territorium beherrscht. Jeremy hat die Bedrohung allzu lange nicht erkannt. Marsten blieb Zeit genug, seine Streitmacht zu formieren. Mit brutaler Zielstrebigkeit heuert er Lust- und Serienmörder an, bietet ihnen ein zweites Leben als Werwolf an und hetzt sie dann auf das Rudel. Die meisten Angreifer können abgewehrt werden, doch einige sind allzu erfolgreich. Als der Krieg der Werwölfe endgültig ausbricht, ist das Rudel bereits arg zusammengeschmolzen. Elena sieht sich auf Gedeih und Verderb an der Seite ihrer Gefährten, denn auch sie steht auf Marstens Liste: als exotische Sklavin an seiner Seite – oder als Todeskandidatin, sollte sie sich ihm in den Weg stellen …
Wer hätte das gedacht: Manchmal geschehen nicht nur Zeichen und Wunder, sondern es erscheint hierzulande in einem Großverlag ein fest gebundener Horrorroman, der nicht Stephen King, Dean Koontz oder Anne Rice aus der Feder geflossen ist. Weil dies so selten vorkommt, hungert der echte Gruselfan nach Abwechslung, und hier wird sie ihm endlich einmal geboten. Noch besser: Armstrong nervt nicht mit telepathisch begabten Serienmördern, trügerisch liebreizenden Teufelskindern oder pseudoerotisch-dekadenten Neo-Vampiren, die man alle längst so satt hat. Stattdessen treten ganz klassische Gestalten ins Rampenlicht: Werwölfe, die – es wird immer besser – nicht als Projektionsgestalten spätpubertärer Mädchenträume verheizt, sondern in eine echte Handlung versetzt werden.
Daher vergesse man den nichts sagenden oder in die völlig falsche Richtung weisenden deutschen Titel möglichst umgehend: Hier steht nicht wie in den unfreiwillig grausigen Werwolf-Romanen der Alice Borchardt die mit den Elementen des Schauerromans notdürftig verbrämte Beschwörung des ungezähmten, wilden Weiblichen (kombiniert natürlich mit der diesem Prozess eigentlich diametralen, schwülstig-romantischen Suche nach Mr. Right) im Mittelpunkt, das sich ungehemmt anscheinend nur nach Mitternacht und im Gewand diverser Fabelgestalten entfalten kann. Stattdessen gibt es eine echte Story (mit dem Biss des Originaltitels), der die inneren Konflikte und Alltagsprobleme eines Werwolfs im 21. Jahrhundert untergeordnet bleiben bzw. klug an geeigneter Stelle in den Fluss des schwungvollen Geschehens eingeflochten werden.
Dabei ist diese Story – Rebellion im Reich der Wolfsmenschen – nicht gerade originell, aber sie wird flott und abseits allzu ausgetretener Pfade präsentiert. In gewisser Weise ist „Die Nacht der Wölfin“ Stephen Kings „Brennen muss Salem“ („Salem’s Lot“, 1975) vergleichbar (oder Kathryn Bigelows „Near Dark“-Film von 1987). Während Meister King einst den Vampir vom schweren Staub seiner literarischen Vorgeschichte befreite, widmet sich Armstrong nunmehr ebenso erfolgreich der Restauration des Werwolfs. Sie kippt endlich die tot erzählte Mär vom stets tragischen Schicksal des in einer Vollmondnacht im dunklen Wald gebissenen Nachwuchs-Werwolfs auf den Schuttplatz der lykanthropischen Literaturgeschichte und entwirft eine geheime, doch keineswegs verstohlene Gemeinschaft, die zwar strikt ihren eigenen Regeln folgt, sich aber trotzdem in die Welt der Menschen integriert hat (auch wenn diese davon nichts ahnen). Diese Werwölfe leben ganz im Hier und Jetzt – und sie leben gut, denn sie vergeuden ihre animalische Energie längst nicht mehr darauf, ausdrucksstark den Mond anzuheulen, sondern schlagen sich wacker im Big Business, lieben den Luxus und wissen nicht nur den des Nachts selbst gefangenen Hasen, sondern auch ein Fünf-Sterne-Menü zu schätzen.
Das angenehme Leben hat freilich seinen Preis: Armstrongs Werwölfe fürchten nicht nur Silberkugeln; jeder gut gezielte Schuss kann sie verletzen oder das Leben kosten. Wolfsmenschen im buchstäblichen Sinn sind sie trotzdem geblieben. Armstrong gelingt es auch hier, alte Zöpfe abzuschneiden. Die Gruppendynamik eines realen Wolfsrudels projiziert sie geschickt auf ihre Werwölfe, die dadurch als solche dem Leser wesentlich plastischer vor das geistige Auge treten. Für eine Heldin im politisch korrekten, weichgespülten Unterhaltungsroman der Gegenwart ist Elena Michaels erstaunlich unkonventionell geraten. Sie lügt, tötet und geht fremd, ohne sich darüber allzu viele graue Haare wachsen zu lassen; in einer zukünftigen Hollywood-Verfilmung würde dieser Aspekt werwölfischen Wesens garantiert unter den Tisch fallen.
Wie dies besonders für Debütwerke typisch ist, lässt die Handlung gewisse Rückschlüsse auf die Biografie der Verfasserin zu. Kelley Armstrong lebt im ländlichen Südosten des kanadischen Bundesstaates Ontario, wo sie ein ihrer Heldin insofern ähnliches Leben führt, als sie des Tages einem eher unspektakulären Job als Programmiererin nachgeht und erst in der Nacht ihren (schriftstellerischen) Gelüsten frönt. Inzwischen hat die Mutter dreier Kinder Blut geleckt und ihrem Erstling (natürlich) eine Fortsetzung („Stolen“, 2002) folgen lassen; das dritte Elena-Michaels-Abenteuer ist bereits in Arbeit – eine Ankündigung, die aber den lesenden Gruselfreund eher erfreut als erschreckt, was eine angenehme Abwechslung ist.
Der deutsche Nachfolger, „Rückkehr der Wölfin“, ist für November 2004 als Broschur bei |Knaur| angekündigt.
Baudelaire, Charles / Huysmans, Joris-Karl / Mirbeau, Octave – Blumen des Bösen, Die / Tief unten / Der Garten der Qualen
Es gibt Klassiker der unheimlichen Literatur, welche heute nur noch selten ihren Weg zu den Lesern finden, da die Autoren zumeist vergessen sind und nur noch Kenner der Phantastik aus literaturhistorischem Interesse heraus versuchen, antiquarische Exemplare zu ergattern. Löblicherweise erscheinen nun im |area|-Verlag einige dieser Werke im edlen Hardcover zu moderaten Preisen.
Im vorliegenden Band sind drei Werke vereint, welche bislang – bis auf eine Ausnahme – selten lieferbar waren. Es sind dies die Gedichtsammlung „Die Blumen des Bösen“ von Charles Baudelaire, „Tief unten“ von Joris-Karl Huysmans und „Der Garten der Qualen“ von Octave Mirbeau.
_Charles-Pierre Baudelaire_ (1821 – 1867) ist den Phantastik-Kennern als Poe-Übersetzer bekannt. Baudelaire hat die Poe-Rezeption in Frankreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angestoßen und damit auch für die Verbreitung der Poe’schen Werke in Deutschland viel Gutes getan, nachdem E. A. Poe einige Zeit zu Unrecht vergessen war. Seine eigenen Werke stecken – wie bei Poe – voller rätselhafter, verschrobener Charaktere und behandeln die Themen Tod, Verwesung, Gewalt. Dies ist auch in der viel gelobten Gedichtsammlung „Die Blumen des Bösen“ („Les Fleurs du mal“, 1857) der Fall. In nahezu hundert Gedichten beschwört Baudelaire eine Welt voller Wahnsinn und Zerfall, und das in einer poetischen Sprache, die voller betörender Bilder ist. Diese Sammlung gilt zu Recht als ein Meilenstein in seinem Werk und ist schwer zu übersetzen. Die Ausgabe des |area|-Verlages wurde von Terese Robinson übersetzt, welche mit großer Akribie daran ging, den Rhythmus des französischen Originals und seine Bildsprache auch im Deutschen beizubehalten. Das Ergebnis ist gelungen.
„Tief unten“ („Là-bas“, 1891) von _Joris-Karl Huysmans_ (1848 – 1907) ist ein Roman, der das Thema Satanismus in aller Breite und Ausführlichkeit schildert. Die Hauptfigur des Romans ist Durtal, ein Schriftsteller, der als ein Dandy des |Fin de Siècle| geschildert wird. Er recherchiert für eine Biographie über Gilles de Rais, besser bekannt als „Blaubart“. Gilles de Rais hatte sich der Legende nach ganz dem Satanismus verschrieben und versuchte die Gunst des Teufels zu erringen, in dem er u. a. Kinder auf grausamste Weise ermordete. Durtal ist auf dunkle Art fasziniert von seinen Ergebnissen und nimmt an Schwarzen Messen teil. Doch davon ist er angewidert und wendet sich ab, um wieder die Einsamkeit eines Dandys zu leben.
Das Werk ist eine Mischung aus Essay und Roman und zeigt vor allem den historischen Satanismus des |Fin de Siècle| als eine Sinnsuche in einer für die damaligen Künstler als sinnlos empfundenen Welt.
_Octave Mirbeau_s „Der Garten der Qualen“ wendet sich dem Thema Sadismus zu. In China erlebt ein französischer Exilant, wie Gefangene in einem Straflager, das einem Garten nachempfunden ist, zu Tode gequält werden. Die Methoden sind dabei dermaßen perfide, dass sich ein Clive Barker hiervon inspirieren lassen und diese nicht extremer schildern könnte. In bester Tradition eines Marquis de Sade schildert Mirbeau (1848-1917) die Qualen als Mittel zum sexuellen Genuss der Betrachterin, einer schottischen Adeligen. Am Ende jedoch überwältigt auch sie das Gesehene und sie fällt in eine Ohnmacht, wobei klar ist, dass die Adelige wieder und immer wieder zu Besuch in den „Garten der Qualen“ gehen wird. Dieser Roman diente Kafka als Vorlage für „In der Strafkolonie“.
Alle drei Werke sind wahre Klassiker der unheimlichen Literatur und jedem empfohlen, der sie noch nicht kennt. „Der Garten der Qualen“ ist normalerweise besonders schwer zu erhalten, demnach sollte man nicht zögern zuzugreifen, vor allem, da der Preis für ein Hardcover wirklich günstig ist.
_Markus K. Korb _
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Steve Alten – Höllenschlund
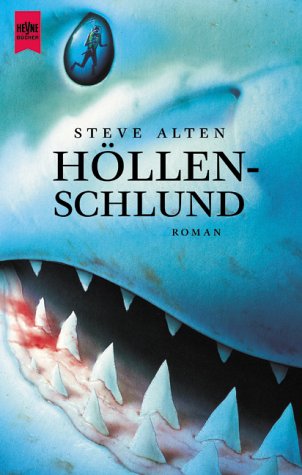
Steve Alten – Höllenschlund weiterlesen
Stephen King – Der Sturm des Jahrhunderts
Das Leben ist entbehrungsreich und hart auf der kleinen Insel Little Tall Island, gelegen vor der Küste des US-Staates Maine. Seit jeher bildet der Fischfang die Lebensader der 200-Seelen-Gemeinde, doch reich ist niemand dadurch geworden. Man kennt seine Nachbarn und kommt miteinander aus, und es gibt wenige Geheimnisse, die tatsächlich geheim bleiben könnten.
Ausgerechnet dieses kleine Dorf am Ende der Welt wird vom Teufel heimgesucht; vielleicht nicht vom Gottseibeiuns persönlich, aber von einem seiner Dämonen. Wie man es aus diversen Märchen kennt, ist dieser Dämon – er trägt hier den Namen Andre Linoge und tritt nicht unerwartet in der Gestalt eines Fischers auf – darauf aus, Unheil und Unfrieden unter den Menschen zu säen, sie ins Verderben zu locken und sich ihrer Seelen zu bemächtigen.
Der Blick auf seinen Stock mit dem Wolfskopf-Knauf weckt das Böse in seinen Opfern. Dann genügt eine sachte Anregung Linoges – der außerdem Gedanken lesen kann -, und schon fallen die verblendeten, aufgehetzten Einwohner von Little Tall Island übereinander her. Sollten Linoges Anregungen einmal nicht auf fruchtbaren Boden fallen, scheut er nicht davor zurück, seinem Gegenüber mit dem Stock den Schädel zu spalten.
Böse Geister treten häufig unter Blitz und Donner auf. Linoge bedient sich wenig einfallsreich aber effektvoll der typischen Winterwitterung dieser Küstenregion: Während er sein tödliches Netz um Little Tall Island spinnt, braut sich der heftigste Schneesturm des Jahrhunderts zusammen. Er wird die Insel auf Wochen von ihrer Umwelt abschneiden – Zeit genug für Linoge, die kleine Gemeinde buchstäblich in die Hölle auf Erden zu verwandeln. Systematisch treibt er die Menschen ihrem Untergang entgegen. Schließlich lässt der Dämon die Maske fallen und stellt den Menschen von Little Tall Island ein Ultimatum: Er fordert ein Opfer, damit er die Stadt verlässt, ohne sie endgültig zu zerstören – und es muss ein Kind sein, das mit ihm geht …
Resteverwertung fürs Fernsehen
Böser Dämon sucht idyllische Kleinstadt heim, bringt die heile Welt zum Einsturz und mästet sich an dem Unheil, das er über die Menschen bringt: Kommt einem diese Geschichte nicht bekannt vor? Kein Wunder, denn schließlich hat Stephen King sie schon einmal (1991) erzählt: „Needful Thing“ (dt. „In einer kleinen Stadt“) hieß sie damals. Die Parallelen sind mehr als auffällig. Man könnte meinen, jener Teufel in Menschengestalt, der 1989 Little Tall Island unter dem Namen Andre Linoge terrorisierte, ist zwei Jahre später auf die Erde zurückgekehrt, um Kings literarische Lieblingsstadt Castle Rock als Leland Gaunt heimzusuchen.
Zwar bedient sich King gern bei eigenen, früheren (und besseren) Werken, aber dies ist dennoch ein starkes Stück. Ist ihm dies selbst aufgefallen, und wählte er deshalb den Weg, den „Sturm des Jahrhunderts“ nicht als ‚richtigen‘ Roman, sondern als Drehbuch niederzuschreiben? Wortgewaltig beschwört der gewandte Autor in seinem Vorwort zum vorliegenden Buch den Moment herauf, als ihn der Blitz der Erkenntnis durchzuckte: Der „Sturm“ ist eine Geschichte, die nur auf dem Bildschirm erzählt werden kann! Das musman ihm glauben – oder lässt es bleiben. Unter dem Strich überwiegen wohl die Argumente für die zweite Entscheidung.
Der „Sturm“ beruht also auf einer bereits bekannten und durchgespielten Idee. Auch die Tarnung als Drehbuch kann die Ähnlichkeiten nicht verschleiern. Wohlweislich hat King es vermieden, seine Geschichte in Romanform zu gießen. Man kann ihn durchaus bewundern für seinen Einfallsreichtum, mit dem er sich unermüdlich bemüht, neue Wege zur Vermarktung seiner Werke zu finden. Man kann ihn aber mit einfach dreist nennen und ihm unterstellen, einen alten Hut zu recyceln.
Unterhaltung als Routine-Job
Um es anders auszudrücken: King hat einen Idee für einen (Fernseh-) Film gehabt, ein Original-Drehbuch dafür geschrieben und dieses anschließend ohne zusätzliche Arbeit als Buch in den Handel gebracht. Er kommt damit durch, denn er ist Stephen King, der sich einmal selbst rühmte, auch eine Liste von Telefonnummern in einen Bestseller verwandeln zu können. Erfolg korrumpiert also wirklich, denn eine dürftige Ansammlung von Regieanweisungen und Dialogen ist definitiv kein Werk, das eine Veröffentlichung verdient hätte!
Werfen wir einen Blick auf die Geschichte. Das ist im Wortsinn möglich, denn der Film bzw. die TV-Mini-Serie zum Drehbuch existiert ja seit 1999: „Stephen King‘s Storm of the Century“. Ignorieren wir zunächst, dass ihn ein konturloser Regie-Routinier (Craig R. Baxley) mit ebensolchen Darstellern (Timothy Daly, Deborah Farentino, Colm Feore u. a. – US-amerikanische TV-Gesichter, die man vergessen hat, sobald sie vom Bildschirm verschwunden sind) in Szene gesetzt hat. Autor King war im Einklang mit dem ausstrahlenden Sender zufrieden mit dem Ergebnis. Ausdrücklich bescheinigte er dem Regisseur, seine Vorlage originalgetreu umgesetzt zu haben. Eine doppeldeutige Äußerung, die den scharfen Blick auf „Storm of the Century“, den TV-Film, geradezu herausfordert.
Dieses Urteil fällt doppelt hart aus: „Der Sturm“ als TV-Movie ist eine vierstündige, lähmend langweilige Angelegenheit, dessen sorgfältige aber einfallslose Inszenierung und einige gute Tricks nicht für die gewaltigen Längen und Löcher entschädigt, die diese Geschichte aufweist und die nun erbarmungslos offengelegt werden. Verantwortlich ist dafür in erster Linie Autor Stephen King, denn er hatte, wie er im bereits erwähnten Vorwort stolz erklärt, weitgehend die Kontrolle über die Verfilmung.
Kein Akt gelungener Selbsteinschätzung
So herausragend er als Schriftsteller in der Regel ist: Der Drehbuchautor Stephen King kann mit dem Romancier nicht mithalten. Das machte er vor dem „Sturm“ bereits mit der TV-Neuverfilmung von „The Shining“ deutlich. King hatte es missfallen, wie Stanley Kubrick 1980 mit der Vorlage umgesprungen war. Die Mini-Serie „The Shining“, bei der endlich er das Sagen hatte, legte 1997 allerdings auf peinliche Weise offen, wie genial Kubrick wirklich war. Sein „Shining“ wird ein Klassiker des (phantastischen) Films bleiben, wenn Kings ehrgeiziges Opus längst zu einer Fußnote geworden ist.
King wäre besser beraten gewesen, eine ganz andere Geschichte verfilmen zu lassen. Er hatte schon einmal das Böse über eine Insel vor der Küste von Maine hereinbrechen lassen: „Home Delivery“ (1989, dt. „Hausentbindung“), erschien u. a. 1993 in der King-Kollektion „Nightmare & Dreamscapes“ (dt. „Albträume“). Sie blieb weitgehend unbekannt; King selbst betrachtete sie als Auftragsarbeit, mit der er dem von ihm verehrten Regisseur George A. Romero seine Reverenz erweisen wollte.
„Hausentbindung“ beschreibt die furchterregende Geschichte einer kleinen Insel („Deer Isle“ geheißen), die von mordlüsternen Zombies belagert wird – eine düstere, mit groben Effekten nicht sparende aber höllisch spannende und mit den typischen King-Momenten überzeugender Menschlichkeit in Zeiten höchster Not veredelte Schauermär.
Das Medium als Hindernis
Für das Fernsehen wäre „Hausgeburt“ freilich kaum zu verwirklichen gewesen. Die vergnüglichsten Momente hat „Der Sturm des Jahrhunderts“, wenn King im Vorwort seine Erfahrungen mit den gestrengen hauseigenen Zensoren des TV-Networks ABC schildert. Die beschämend bigott-prüde Geisteshaltung, welche die nur scheinbar so weltoffenen US-Amerikaner an den Tag legen, wird selten so deutlich offenbart wie durch diese Institution, die ihre oft (und zu Recht) verfluchte deutsche ‚Schwestern‘, die „Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft“ (FSK) und ihre Ableger, wie Speerspitzen der sozialen Avantgarde aussehen lassen.
Es bleibt das eindeutige Fazit: „Der Sturm des Jahrhunderts“ ist ein überflüssiges Buch, wenn man es denn als solches überhaupt bezeichnen möchte. Von Interesse ist es höchstens für einige Film-Historiker, die sich indes darüber beklagen dürften, dass es weitaus wichtigere Werke gibt, die auf diese Weise gewürdigt werden sollten.
Andererseits tauchte der „Sturm“ sogar in den deutschen Bestseller-Listen auf und hielt sich dort einige Zeit. Ein Mirakel, oder verkauft sich tatsächlich alles wie Schnittbrot, wenn nur der Name King darauf steht? Oder ist eine Lesergeneration herangewachsen, welche – ‚geschult‘ – durch ständige Werbepausen im TV, das Videoclip-Gewitter der Musiksender oder das Internet – die Widernatürlichkeit eines ‚Drehbuch-Romans‘ längst nicht mehr stört?
Autor
Normalerweise lasse ich an dieser Stelle ein Autorenporträt folgen. Wenn ich ein Werk von Stephen King vorstelle, pflege ich dies zu unterlassen, wie man auch keine Eulen nach Athen trägt. Der überaus beliebte Schriftsteller ist im Internet umfassend vertreten. Nur zwei Websites – die eine aus den USA, die andere aus Deutschland – seien stellvertretend genannt: www.stephenking.com und www.stephen-king.de bieten aktuelle Informationen, viel Background und zahlreiche Links.
Taschenbuch: 506 Seiten
Originaltitel: The Storm of the Century (New York : Pocket Books 1999)
Übersetzung: Peter Robert
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 


Blatty, William Peter – Exorzist, Der
Washington, um 1970: Während sie in der Hauptstadt der USA Außenaufnahmen für einen neuen Film dreht, hat sich die erfolgreiche Schauspielerin Chris MacNeil in einem vornehmen alten Haus im ruhigen Stadtteil Georgetown eingemietet. Die geschiedene Frau und allein stehende Mutter bewohnt das weitläufige Anwesen mit ihrer zwölfjährigen Tochter Regan und einem Dienerpaar aus der Schweiz.
Die Karriere läuft gut für Chris MacNeil, doch privat gibt es einigen Ärger. Regan scheint ihren Vater zu vermissen, der sich nie um seine Tochter gekümmert hat. Außerdem kommt sie in die Pubertät, was mit ein Grund sein könnte, dass sie seit kurzem unruhig, übernervös und gleichzeitig verschlossen ist.
Das Haus der MacNeils liegt ganz in der Nähe der Universität von Georgetown. Außerdem gibt es ein Jesuitenkolleg, dessen Mitglieder zum Teil an der Hochschule lehren. Pater Damien Karras ist ein neues Gesicht in dieser Runde. Eigentlich ist er Psychiater und medizinischer Berater für die Angehörigen seines Ordens. Doch privates Unglück hat ihn aus der Bahn geworfen und an seiner Berufung zweifeln lassen. Seinen Vorgesetzten erscheint es ratsam, ihn einige Zeit „leichten Dienst“ verrichten zu lassen.
So kann Karras seinen jesuitischen Brüdern nicht zur Seite stehen, als diese von der Polizei um Hilfe angegangen werden. In Georgetown häufen sich neuerdings die Hinweise auf schwarze Messen! Kirchen des Stadtteils werden des Nachts blasphemisch geschändet. Was für die Polizei jedoch nur Auswüchse einer dekadenten „Mode“ sind, beunruhigt die Geistlichkeit naturgemäß stärker. Dennoch glaubt hoch im 20. Jahrhundert niemand mehr daran, dass hinter diesem Treiben der Teufel persönlich steckt – mit einer Ausnahme: Pater Merrin ist ein Kirchenmann von altem Schrot und Korn, der fest davon überzeugt ist, dass das Böse existiert und Dämonen durchaus |in persona| auf Erden wandeln können. Seit Jahrzehnten erforscht er überall auf der Welt alte Mythen und historische Überlieferungen und hat zahlreiche Beweise für seine Theorien gefunden, die von der aufgeklärten Wissenschaft, aber auch von seinen Vorgesetzten indes mit Skepsis aufgenommen werden.
Seit kurzem nun meint Merrin deutliche Hinweise auf die Wiederkehr eines ganz besonders höllischen Widersachers gefunden zu haben: Pazuzu, die Personifizierung des Süd-Westwindes und dämonischer Herr über Krankheit und Elend, steht schon in den Startlöchern, die Welt wieder einmal als biblische Heimsuchung zu plagen. Er fährt ausgerechnet in die kleine Regan MacNeil. Mit dem Erzeugen von Klopfgeräuschen, dem Verrücken von Möbeln und dem Verschwindenlassen von Kleidungsstücken läuft sich Pazuzu warm für größere Übeltaten, die alsbald folgen: Regan sprengt eine Party im Hause MacNeil, indem sie auf den Teppich pinkelt. Ihren Wortschatz hat sie mit bemerkenswerten Obszönitäten bereichert. Alles nur die Nerven, beruhigt der in Amerika stets fast zur Familie gehörende Psychiater, aber als Regan dann des Nachts über ihrem Bett zu schweben beginnt, kann Chris diese Erklärung nicht mehr zufrieden stellen. Die Ärzte – bald in Kohortenstärke um Regans Krankenlager versammelt – sind ratlos, bis einer zaghaft vorschlägt, man könne es doch mit einem Exorzisten versuchen … natürlich nur aus streng medizinischen Gründen, um Regans böser Hälfte ihrer gespaltenen Persönlichkeit einen tüchtigen Schrecken einzujagen.
In ihrer Not und obwohl Atheistin, wendet sich Chris MacNeil an Pater Karras, den sie vom Campus der Universität flüchtig kennt. Karras merkt bald, dass ihm alle Schulweisheit nicht helfen wird, Regan zu „heilen“. Die ständige Anwesenheit des penetranten Inspektors Kinderman von der Mordkommission erinnert zudem alle Mitwirkenden dieses Dramas daran, dass Regans Besessenheit möglicherweise bereits ein Todesopfer gefordert hat. Erst als Pater Merrin auf der Fährte Pazuzus nach Washington und ins Haus der MacNeils kommt, scheint sich das Blatt zu wenden. Gemeinsam machen sich die beiden Priester daran, Pazuzu auszutreiben – zu exorzieren – und zurück in die Hölle zu jagen. Aber der Dämon denkt gar nicht daran zu weichen, und die beiden Exorzisten sind ein wenig eingerostet. Als Pazuzu auch noch merkt, dass Pater Karras im Glauben schwankend geworden ist, bekommt er endgültig Oberwasser, und das alte Haus in Georgetown wird Schauplatz eines wahren Pandämoniums …
Was könnte man an dieser Stelle nicht alles schreiben über ein Buch, das vor über drei Jahrzehnten in aller Munde war und weltweit die Bestsellerlisten gestürmt hat! Erst heute wird deutlich, was die unheimliche Literatur und selbstverständlich der Film William Peter Blatty und seinem „Exorzisten“ verdanken! Nach drei Jahrzehnten ist in Vergessenheit geraten, wie viele mehr oder minder abgewandelte Gruselgeschichten auf dieses eine Buch zurückgehen. Das wäre wohl auch so geblieben, wenn nicht ein unerhörtes und so vorher noch nie da gewesenes Ereignis das Interesse am gedruckten „Exorzisten“ neu oder – bei den „Nachgeborenen“ – überhaupt zum ersten Mal belebt hätte: Der Film zum Buch, immerhin auch schon stolze 28 Jahre alt, kehrte – aufpoliert und durch eine Reihe niemals zuvor gesehener Szenen ergänzt – 2000 in die Kinos zurück – und stürmte erneut die Charts!
Das ist (um an dieser Stelle einmal kurz abzuschweifen) auch kein Wunder, denn unabhängig von der ulkigen Kleidung und den bescheuerten Frisuren der Darsteller ist „Der Exorzist“ zwar wahrlich keine große Kunst, aber ein fabelhaftes, zeitloses Stück Unterhaltung. In etwas eingeschränktem Maße trifft das auch auf die Romanvorlage zu, die ja nicht als „Buch zum Film“, sondern als selbstständige Geschichte konzipiert wurde.
William Peter Blatty, ein zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise unbekannter Autor, hatte sich große Mühe gegeben. Er war tief in die Materie eingestiegen, hatte über den Teufel in Geschichte und Religion, über Satanismus, die Kirche und den Exorzismus, über Besessenheit und Geisteskrankheiten recherchiert – kurz gesagt: Er hatte seine Geschichte ernst genommen, und das war höchst ungewöhnlich in einer Zeit, in der Horror (wie übrigens auch Science-Fiction) für albernen Kinderkram gehalten wurde. Blatty bewies, dass dem keineswegs so sein musste – mit durchschlagendem Erfolg. Ihm gelang ein Klassiker; mehr noch: Er schuf einen modernen Mythos, dessen Kultfaktor und Langlebigkeit irgendwo zwischen Bram Stokers „Dracula“ und Peter Benchleys „Der weiße Hai“ anzusiedeln sind.
Der Scherz liegt nahe und sei an dieser Stelle trotzdem nicht gemieden: Die Geister, die er rief, wurde Blatty nicht mehr los. Niemals wieder sollte ihm ein auch nur annähernder Erfolg beschieden sein. (Dasselbe Schicksal traf übrigens auch William Friedkin, den Regisseur des Kino-„Exorzisten“, oder Linda Blair, die Darstellerin der Regan MacNeil.) Vom „Exorzisten“ kam er aber auch nicht los. Wie wir aus den Medien erfahren können, trauerte er um „seinen“ Film, den Friedkin seiner Ansicht nach rüde verschnitten hatte, und piesackte den ohnehin gebeutelten Regisseur dreißig Jahre lang mit Hinweisen darauf, was er (Friedkin) versaubeutelt und er (Blatty) besser gemacht hätte.
Blatty bekam übrigens die seltene Chance, seine eigene Vision zu realisieren, nur ist das nur den hartgesottenen Freunden des Unheimlichen aufgefallen: Es gibt nicht nur e i n e Fortsetzung des „Exorzisten“ (ein eindeutig fluchbeladenes Unternehmen …), sondern noch eine weitere, deren Romanvorlage Blatty 1983 nicht nur verfasst hatte, sondern deren Verfilmung er sieben Jahre später höchstpersönlich inszenieren durfte! Hatte er sein angelesenes Wissen eingesetzt, um Hollywood in seinen Bann zu zwingen? Dann erreichte seine Macht allerdings nicht das zahlende Publikum. 1990 war definitiv kein besonders gutes Jahr für den Teufel (und Blatty kein übernatürlich talentierter Regisseur …), so dass „Der Exorzist III“ eher ein Schattendasein in Videotheken und später im Nachtprogramm des Fernsehens fristen musste.
Doch kehren wir zurück zur literarischen Teufelshatz von 1971. Wenn man „Der Exorzist“ heute aufmerksam liest, fällt durchaus auf, dass der Roman gealtert ist. Die moderne medizinischen Psychoanalyse war um 1970 sichtlich etwas Neues, und so reitet Blatty im Urteil seiner durch die Medien und besonders das Fernseher besser geschulten Lesern des 21. Jahrhunderts ein wenig zu ausführlich auf diesem Thema herum. Auch Pater Karras’ ausgiebiges Ringen mit seinen religiösen Zweifeln, die schließlich zu seinem Untergang führen, sind aus heutiger Sicht ein wenig langatmig geraten und dürften außerdem auf ein Publikum, das erleben konnte, wie Arnie Schwarzenegger den Fürsten der Finsternis mit seiner großkalibrigen Kanone Mores lehrte, nicht mehr überzeugend wirken.
Vieles, das noch unerhört oder wenigstens neu für Blattys Leser war, ist heute so selbstverständlich geworden, dass es bei der Lektüre gar nicht mehr zur Kenntnis genommen wird. Das betrifft nicht einmal unbedingt die Szenen, in der die besessene Regan ihre wahrhaft teuflische Vorstellung gibt – die haben es allerdings auch heute noch in sich! Aber Chris MacNeil ist beispielsweise nicht nur eine allein lebende Frau und allein erziehende Mutter, sondern eine beruflich und privat erfolgreiche Frau und Mutter, die auch der Teufelsspuk zwar biegen, aber nicht brechen kann – um 1970 beileibe noch keine Selbstverständlichkeit.
So darf man also froh sein, dass die Wiederaufführung des Kino-„Exorzisten“ auch das Buch zurückgebracht hat. Wer sich darüber hinaus dafür interessiert, wie Blatty die Geschichte später weiterentwickelt hat, sollte versuchen, sich die Romanvorlage zum weiter oben erwähnten dritten Teil antiquarisch zu beschaffen: Sie ist in Deutschland anno 1991 im Goldmann-Verlag unter dem (nichts sagenden) Titel „Das Zeichen“ (TB-Nr. 8088) erschienen.
Bunson, Matthew – Buch der Vampire, Das
Bekanntlich treten sich auf der britischen Insel Geister und Gespenster heute noch auf die Lakensäume, und Graf Dracula höchstpersönlich ist im ehrwürdigen London (wieder-)geboren worden; literarisch jedenfalls. Da scheint es nur angemessen, dass sich ein Bürger dieses nebligen Eilandes der geliebten Spukgestalten annimmt und endlich einmal Ordnung in das ektoplasmatische Getümmel bringt!
Wer kann schon ahnen, dass sich hinter dem Schriftsteller mit dem urenglischen Namen „Matthew Bunson“ ein schnöder Kolonialbrite von jenseits des großen Teiches verbirgt? Den Amerikanern ist zweifelsohne ein Primat des Wissens zuzubilligen, wenn es um radioaktiv erzeugte Monster aus der Wüste von Nevada oder das Ungeheuer vom Amazonas geht. Sobald Vampire ins Spiel kommen, wird der Kenner jedoch skeptisch.
Und richtig – das „Buch der Vampire“, wie es im Deutschen (mit Absicht?) vorsichtig heißt (erst im zweiten Untertitel wird von einem „Lexikon“ gesprochen), entpuppt sich fast durchweg als Sammlung recht wahllos zusammengetragener Informationshäppchen, die sich nur einem einzigen Ordnungsprinzip unterordnen: dem alphabetischen nämlich. Das Vorwort gibt da einen ersten Vorgeschmack, denn man kann es wohlwollend als „knapp“, aber genauso gut als „nichts sagend“ bezeichnen.
Schlimmer noch: Bunsons Vampir-Enzyklopädie erreicht nur das Jahr 1993 – wen wundert’s, denn das ist das Veröffentlichungsdatum der Originalausgabe. Nun ist sogar die Welt der Untoten in den seither verstrichenen Jahren nicht stehen geblieben. Es sind auch nach Francis Ford Coppolas bahnbrechender „Dracula“-Verfilmung von 1992 wichtige Beiträge zum Genre erfolgt – und das betrifft nicht nur den Film! Was ist zum Beispiel von einem „Lexikon“ zu halten, das 2001 erscheint und sich über das „Dracula“-Jubiläum von 1997 völlig ausschweigt? Schließlich ist in diesem Jahr sogar die „offizielle“ Fortsetzung des 100-jährigen Kultschockers erschienen (von Freda Warrington; dieses Buch ist auch in Deutschland auf den Markt gekommen – glücklicherweise ziemlich unbemerkt, denn seine Lektüre kann leicht die Sehnsucht wecken, der Autorin mit Holzpfahl und Silberkugel – hilft auch gegen Vampire; Bunson, S. 246 – zu Leibe zu rücken …). In Maßen hätte eine Überarbeitung bzw. Aktualisierung des Bunson-Werkes daher Not getan; sie unterblieb – zweifellos aus Gründen falsch verstandener Sparsamkeit, aber nicht ohne berechtigte Hoffnung, der geblendete Vampirfan werde zumindest bis nach der Entrichtung der Kaufsumme die Rosstäuscherei nicht bemerken.
Bei näherer Betrachtung relativiert sich das düstere Bild glücklicherweise. Machen wir die Probe aufs Exempel – schlagen wir das „Lexikon“ beim Eintrag „Lee, Christopher“ auf. Muss nicht selbst dem Neuling auf dem Feld des Unheimlichen dieser Name wie Donner in den Ohren hallen? Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also dann: Lee ist nach Max Schreck (Murnau! „Nosferatu“!) und Bela Lugosi wohl d e r Kinovampir der Filmgeschichte! (Außerdem hält Lee den Guiness-Rekord für den Schauspieler mit der umfangreichsten Filmografie eines noch lebenden Darstellers in der westlichen Hemisphäre – Nr. 250 rückt allmählich in Reichweite; womöglich hat Lee die Rolle des unsterblichen Blutsaugers also nicht nur gespielt …) Siehe da, Bunson gelingt es tatsächlich, Leben und Werk Lees auf gerade einer halben Seite ganz ordentlich in Worte zu fassen. (Seit 1947 ist Lee nonstop im Einsatz? Nun ja; siehe oben …)
Zugegeben: Über die Auswahl der präsentierten Stichwörter lässt sich streiten. Außerdem fallen dem etwas versierteren Leser nicht gerade selten ungenaue oder gar falsche Aussagen auf. Ein beliebig herausgegriffenes Beispiel: Wie um Himmels willen konnte Glenn Strange den „bekanntesten Horrorfilmstars“ zugeschlagen werden? Den zweifelhaften Höhepunkt seiner obskuren Karriere hat dieser Darsteller mit der Rolle des schmirgelpapiergesichtigen Barkeepers Sam in der Endlos-Fernseh-Western-Serie „Gunsmoke“/“Rauchende Colts“ (dessen Hauptdarsteller James Arness alias Matt Dillon allerdings mit der Hartnäckigkeit eines echten Vampirs immer wieder der TV-Gruft entsteigt; hier schließt sich der Kreis …) erreicht, während er unter der Schminke des Frankenstein-Monsters höchstens den echten Kennern des Horrorfilms bekannt geworden ist.
Absolut überflüssig; nein, sogar eindeutig dämlich ist eine ebenso endlose wie nichts sagende Liste deutscher Vampirfilm-Titel auf den Seiten 89-98. Was soll das denn dem Leser nützen, zumal Vampirfilme ihren Titel hierzulande sogar noch öfter wechseln als der Mond seine Phasen? Aber man kann auf diese Weise natürlich ein Menge Seiten schinden … (Eine Ausnahme bildet allerdings auf S. 287 die Liste der Maßnahmen, die man schon vorbeugend gegen das Auftreten von Vampiren treffen kann – damit lässt sich jede Beerdigungsfeier zu einem für alle Beteiligten garantiert unvergesslichen Erlebnis aufwerten!)
Aber das sind Nebensächlichkeiten, sobald man sich von der Erwartung frei machen konnte, Autor Bunson würde tatsächlich ein „Lexikon“ vorlegen. Selbst für den scheinbar ausgewiesenen Fachmann in Sachen Vampire gibt es hier nämlich einiges zu lernen. Wie entstehen beispielsweise überhaupt Untote? In Albanien glaubt(e) man beispielsweise, es reiche schon aus, dass ein wildes Tier über ein Grab springt (S. 11). Angesichts der akuten Karnickelplage auf deutschen Friedhöfen könnte man ob dieser Information leicht ins Schwitzen geraten …
Wer hätte gewusst, dass man nur eine Herde Gänse über einen Friedhof jagen muss, auf dem man einen Blutsauger vermutet? Schon vor den Toren des Gottesackers beginnt das Federvieh erbärmlich zu schnattern und verrät dem Van-Helsing-Jünger, was er wissen muss. (Es könnte natürlich auch sein, dass man statt auf einen Vampir auf eine Gruppe raublustiger Gallier trifft … Achtung: Dies ist ein Gag für Leser mit leicht klassischer Bildung.)
Ist der verdächtige Finsterling etwa bereits aus dem Grab heraus und macht sich während einer Party an die oder den Liebste/n heran? Bunsons Liste der Merkmale, die ihn verraten (S. 78f.), ist unfehlbar: Außer „Fangzähnen“ und „roten Augen“ lesen wir da u. a. von „haarigen Handflächen“, „Mundgeruch“ und „merkwürdiger Kleidung“ – mein Gott, die Welt steckt offensichtlich voller Vampire!
Und hat man den Bösewicht gestellt und in die Enge getrieben, versäume man es nicht, einen Blick auf seine Leber zu werfen – bei einem Vampir ist sie nämlich nicht rötlich-braun (oder säufer-gelb), sondern weiß!
So kann man schließlich doch einiges Vergnügen aus dem angeblichen „Lexikon“ ziehen. Übrigens ist es erstaunlich preisgünstig für ein großformatiges Paperback, das sogar mit einer ganzen Reihe qualitativ hochwertiger Schwarzweiß-Fotos aufwartet (selbst wenn die Auswahl – gelinde gesagt – beliebig ist). Deshalb ist es zu guter Letzt leicht, milde über dieses Werk zu urteilen, das nichts wirklich Neues bieten, aber durchaus unterhalten kann.
Matthew Gregory Lewis / E. T. A. Hoffmann – Der Mönch / Die Elixiere des Teufels
„Der Mönch“
Ambrosio wurde als Säugling auf den Stufen des Klosters gefunden. Die Mönche erzogen ihn, und so war es nicht weiter verwunderlich, dass er selbst die Kutte ergriff. Inzwischen hat das einstige Findelkind sich zu einem Mönch gemausert, der in Madrid zu einer Berühmtheit avanciert, die heutzutage eigentlich nur Popstars genießen. Doch diese Berühmtheit hat einige Nebenwirkungen – unter anderem die, dass Luzifer persönlich auf den frommen Mann aufmerksam wird …
Matthew Gregory Lewis / E. T. A. Hoffmann – Der Mönch / Die Elixiere des Teufels weiterlesen
H. P. Lovecraft – Schatten über Innsmouth
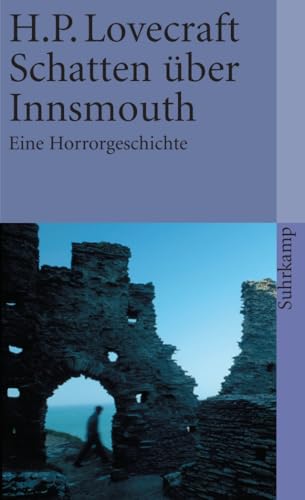
H. P. Lovecraft – Schatten über Innsmouth weiterlesen
Richard Matheson – Echoes: Stimmen aus der Zwischenwelt
Es beginnt als Spiel unter Nachbarn und Freunden, die eine lahme Party in Gang bringen möchten: Tom Wallace, Mitarbeiter einer Werbeagentur, erklärt sich bereit, das Versuchskaninchen für Philip, den jüngeren Bruder seiner Ehefrau Anne, zu spielen. Der junge Psychologiestudent möchte seinen Schwager hypnotisieren. Wider Erwarten gelingt das Experiment, und Tom macht sich zur Belustigung der Gäste durch allerlei suggerierte Mätzchen lächerlich.
Tom hat längst vergessen, dass sein Großvater als Medium bekannt und gefürchtet war. Nun tritt der Enkel unfreiwillig in seine Fußstapfen und entwickelt sich zum Gedankenleser, was nicht nur Anne oder Söhnchen Richard missfällt. Tom leidet unter seiner Gabe, denn wer möchte schon wissen, was seine Mitmenschen wirklich denken; besonders, wenn diese in der Nachbarschaft wohnen und unsympathisch wirken wie Harry Sentas, der grobschlächtige Hausvermieter, oder Frank Wannamaker, der seine Ehefrau Elizabeth nicht nur betrügt, sondern wahrscheinlich auch schlägt. Richard Matheson – Echoes: Stimmen aus der Zwischenwelt weiterlesen