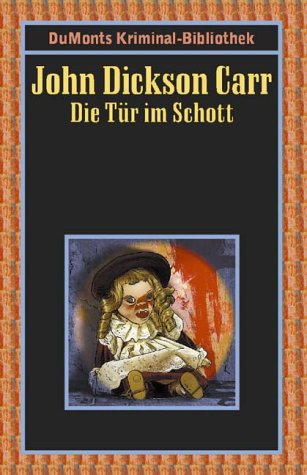In Mallingford, einem Dörflein in der englischen Grafschaft Kent, üben Sir John Farnleigh, Baronet von Mallingford und Soane, und seine Gattin, die liebliche Lady Molly, mit starker aber gütiger Hand das ihnen von Gott und König verliehene Privileg aus, dem Volk Führung und Schutz vor den zweifelhaften Segnungen des 20. Jahrhunderts angedeihen zu lassen. Die Idylle platzt, als den fernen USA ein Mann namens Patrick Gore auftaucht, der sich erdreistet, Sir John Titel, Besitz und sogar den Namen streitig zu machen!
Als Jüngling ein Satanist (!) und Wüstling, wurde dieser John Farnleigh 1912 vom Vater verstoßen und in die ehemaligen Kolonien. Eingeschifft wurde der missratene Spross auf einem Dampfer namens „Titanic“. Bevor deren Reise vorzeitig an einem Eisberg endete, lernte Jung-John einen heimatlosen Zirkus-Artisten gleichen Alters kennen und schätzen: den wahren Patrick Gore nämlich, der dem faszinierten Adelssohn vorschlug, die Identitäten zu tauschen, um die Karten ihrer zukünftigen Leben neu zu mischen.
Den neuen Freund verschlang das Meer, und John lebte als Patrick zufrieden in den Vereinigten Staaten, bis ihn die Nachricht vom Tode des ungeliebten Vaters erreichte. Nun erscheint der erzürnte/verlorene/echte Sohn und fordert sein Recht. Wer ist der echte Sir John Farnleigh? Auch der derzeitige Träger des Titels ist erst vor zwei Jahren aus dem Ausland nach Mallingford gekommen. Womöglich könnte Kennet Murray, Johns Hauslehrer, helfen: Als begeisterter Hobby-Detektiv hat er einst von seinem Schüler Fingerabdrücke genommen! Diese hat er aufbewahrt sowie seinen alten Bekannten Dr. Gideon Fell, Ermittler für Scotland Yard, um Unterstützung gegeten.
Die mit Spannung erwartete Konfrontation endet mit einem Mord, der allen Gesetzen der Logik spottet. Es ist an Gideon Fell, hinter den Kulissen nach Indizien zu suchen. Dabei stellt sich heraus, dass Schwarze Magie und Hexerei ihren gespenstischen Teil zur Lösung des Dramas beizutragen scheinen …
Ein Genre auf dem Gipfel
Der britische Landhaus-Krimi – vom Fachmann gern „Cozy“ genannt, weil es meist außerhalb der verderbten Stadt auch in Sachen Mord stets sehr gemütlich zugeht – wurde von seinen Kritikern gern mit Spott. Wenn es ein Genre gibt, das direkt und unverblümt auf die Heile-Welt-Sehnsucht seines Publikums zielt, dann ist es wohl der „Whodunit“. In der Tat geschieht dies oft auf recht plumpe Weise, und ärgerlicherweise lässt sich eine entsprechend gepolte Leserschaft allzu einfach mit stumpf nach Schema F (distinguierter Lord, plakativfeministische Amateurdetektivin, bodenständiger Polizist, verschrobener Pfarrer, steifer Butler usw.) gedrechselter Dutzendware abspeisen.
Dabei ist der „Cozy“ mehr als eine künstlich am Leben gehaltene, weil einträgliche literarische Leiche: nämlich ein Bote aus längst vergangener, angeblich einfacherer Zeit, deren reales Ende in Großbritannien mit dem I. Weltkrieg gekommen war. Insofern reiste bereits John Dickson Carr mit „Die Tür im Schott“ bereits auf der Nostalgie-Schiene: 1938 ging es auch in der englischen Provinz schon anders zu als der Verfasser uns dies hier vorgaukelt.
Doch John Dickson Carr durfte sich gegen den Vorwurf kalkulierter Gemütlichkeit gefeit fühlen, denn er verfügte über jene Gabe, mit der die Mehrzahl seiner Epigonen nicht gesegnet wurden: Talent heißt sie, und sie mischte sich mit einem enzyklopädischem Wissen um den Kriminalroman und war gepaart mit einem unbändigen Vergnügen, Regeln gleichzeitig strikt zu beachten und gleichzeitig außer Kraft zu setzen. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es für einen gesunden, einfallsreichen Carr keine blutleeren literarischen Fingerübungen. „Die Tür im Schott“ macht da keine Ausnahme.
Ein Fest der unterhaltsamen Verwirrung
Hier gibt es keine schnulzige Liebesgeschichte, nach der zumindest die weibliche „Cozy“-Klientel offenbar hungert. Mit Liebe und Leidenschaften hatte Carr wenig am Hut, es sei denn, ihnen entsprangen skurrile Morde. Auf diese konzentrierte er seine ganze Aufmerksamkeit, was sicherlich den Amateur-Psychologen interessiert. Dem Leser ist’s gleichgültig. Er pfeift auf den Vorwurf, Carr-Krimis seien sauber aber herzlos konstruierte, wie ein Uhrwerk ablaufende Kabinettstückchen, passend bevölkert mit Reißbrett-Figuren und voller absurder Hintertüren, Taschenspielertricks und grotesker Auflösungen. Darin steckt viel Wahres, aber es mindert den Lese-Spaß nicht im Geringsten!
Ein Meister auf der Höhe seiner Schaffenskraft hat sich ans Werk gemacht. Carr hat es nicht nötig, die Krimi-Handlung durch Seiferoper-Elemente aufzupolstern. „Die Tür im Schott“ ist der destillierte Carr: ein Krimi ohne Längen und Lücken. Stattdessen gibt es auf jeder Seite neue Überraschungen. Wieder und wieder schlägt die Handlung Haken, präsentiert neue Verdächtige, entlastet alte, wirft plötzlich alles scheinbar Gesicherte und bisher Gelesene über den Haufen.
Dabei spielt der Verfasser stets mit offenen Karten. Das war ihm wichtig, denn die Kunst eines Krimiautoren maß Carr auch daran, dass er dem Leser einerseits deutliche Hinweise auf die Täterin oder den Täter gibt, während er andererseits die Spannung bis zur letzten Seite aufrecht erhält. In „Die Tür im Schott“ spart Carr keineswegs und beinahe provokant mit entsprechenden Andeutungen. Liest man schon länger Kriminalromane, fallen sie durchaus auf. Man schenkt ihnen nur lange keinen Glauben geschenkt, weil der einfallsreiche Verfasser mit immer neuen Kniffen und Volten verunsichert. Allein die Kunst, mit der Carr immer wieder die Unsicherheit schürt, wer denn nun der echte Sir John Farnleigh ist, verdient neidvolle Anerkennung!
Irgendwo im Dunkel liegt Occams Rasiermesser
Da passen auch Hexerei und die „Titanic“ wunderbar ins Gesamtbild. Zeit seines Lebens war John Dickson Carr vom Schaurigen und Seltsamen fasziniert. Auch „Die Tür im Schott“ ist reich an solchen Handlungssträngen, die scheinbar das Eingreifen übernatürlicher Mächte andeuten. Sir Johns unfromme Neigung zur Schwarzen Magie, der spukhafte Menschautomat von Farnleigh Close und zwergenhafte Meuchelmörder in der Nacht bieten stimmungsvolle Anklänge an ‚richtige‘ Gruselgeschichten. Sie werden selbstverständlich als Täuschung entlarvt, denn wo John Dickson Carr vielleicht das eine oder andere echte Gespenst auftreten lassen würde, kann Dr. Gideon Fell das Übernatürliche niemals dulden.
Dieser Dr. Fell ist ein echtes Unikum. Er gehört zu den großen Gestalten des Kriminalromans, aber leiden konnte und kann ihn eigentlich niemand; selbst der kühle Sherlock Holmes hat demgegenüber seine Fans! Das ist kaum verwunderlich, denn Fell ist ein poltriger Besserwisser, der eifersüchtig sein Wissen hortet, um dann im großen Finale großspurig der Polizei, dem Täter, den atemlos lauschenden Randfiguren und dem Leser gleichermaßen sein Können unter die Nase zu reiben.
Davon konnte oder wollte Carr nicht lassen; über ein halbes Jahrhundert und eine endlose Reihe gesichts- und charakterloser Möchtegern-Helden später kann seine Entscheidung akzeptieren: Gideon Fell mag ein arroganter Mistkerl sein, aber wenigstens ist er einer, an den man sich erinnert! Das verdankt er wunderbaren Romanen wie diesem, die dazu anspornen, noch viele weitere Carr-Werke auszugraben; je älter sie sind, desto mehr sind sie es wert!
Autor
John Dickson Carr (1906-1977), der so wunderbare englische Kriminalromane schrieb, wurde im US-Staat Pennsylvania geboren. Europa hatte es ihm sofort angetan, als er 1927 als Student nach Paris kam. Carrs lebenslange Faszination richtete sich auf alte Städte, verfallene Schlösser, verwunschene Plätze. Die fand er nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland und Großbritannien, die von ihm eifrig bereist wurden.
1933 siedelte sich Carr in England an, wo er bis 1965 blieb. Volker Neuhaus weist in seinem Nachwort zur „Die schottische Selbstmordserie“ (DuMont’s Kriminal-Bibliothek Bd. 1018) darauf hin, dass seine Kriminalromane so lebendig und scharf konturiert wirken, weil hier ein Fremder seine neue Heimat erst entdecken musste und ihm dabei Dinge auffielen, die den Einheimischen längst zur Selbstverständlichkeit geworden waren.
Carr fand schnell die Resonanz, die sich ein Schriftsteller wünscht. Ihm kam dabei zugute, dass er nicht nur gut, sondern auch schnell arbeitete. Obwohl ihm kein ausgesprochen langes Leben vergönnt war, verfasste Carr ungefähr 90 Romane – übrigens nicht nur Thriller. Seine Biografie des Sherlock-Holmes-Vaters Arthur Conan Doyle wurde 1950 sogar mit einem Preis ausgezeichnet. Da hatte man ihn bereits in den erlesenen „Detection Club“ zu London aufgenommen, wo er an der Seite von Agatha Christie, G. K. Chesterton (der übrigens das Vorbild für Gideon Fell wurde) oder Dorothy L. Sayers thronte. 1970 zeichneten die „Mystery Writers of America“ Carr mit einem „Grand Master“ aus; die höchste Auszeichnung, die in der angelsächsischen Krimiwelt vergeben wird.
Zu John Dickson Carrs Leben und Werk gibt es eine Unzahl oft sehr schöner und informativer Websites; an dieser Stelle sei daher nur auf diese verwiesen, die dem Rezensenten ganz besonders gut gefallen hat.
Taschenbuch: 285 Seiten
Originaltitel: The Crooked Hinge (New York : Harpers 1938/London : Hamish Hamilton 1938)
Übersetzung: Manfred Allié
http://www.dumont-buchverlag.de
eBook: 1531 KB
ISBN-13: 978-3-8321-8674-6
http://www.dumont-buchverlag.de
Der Autor vergibt: