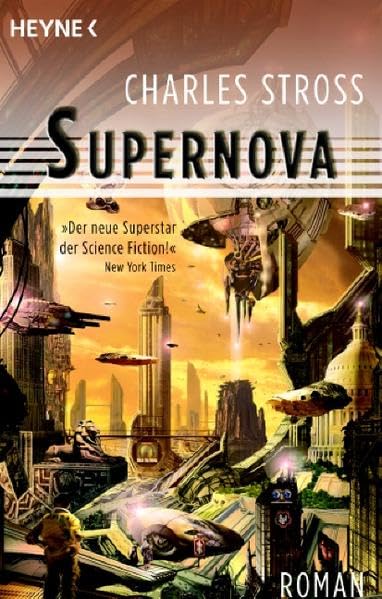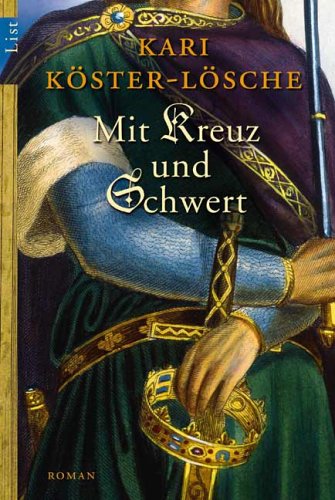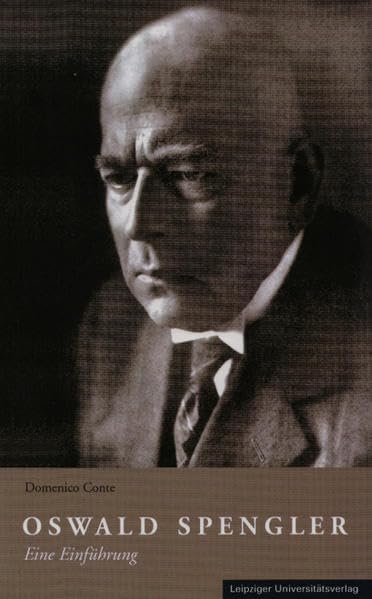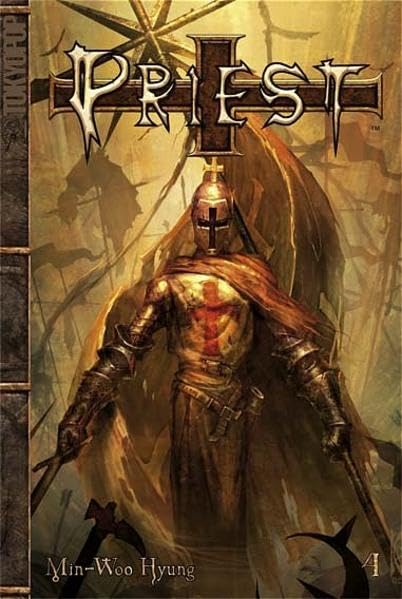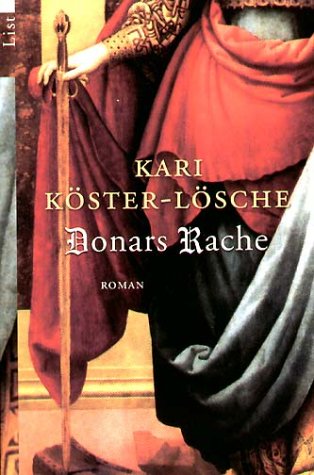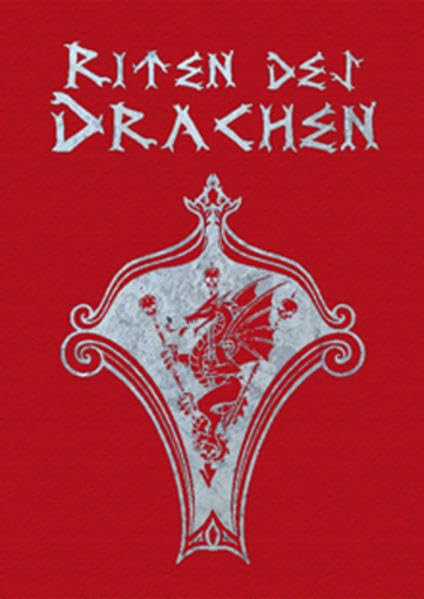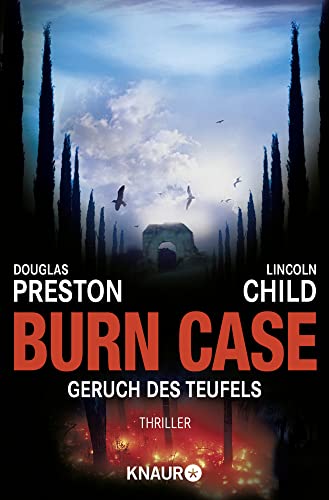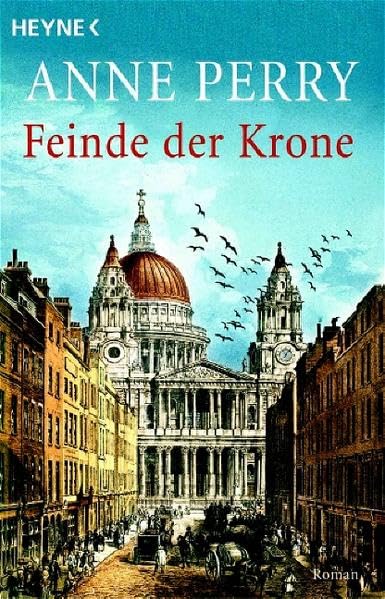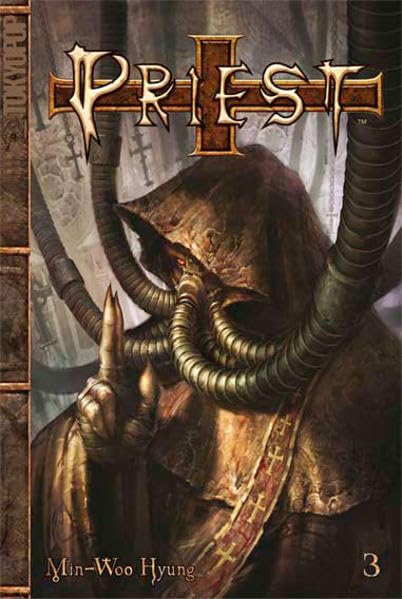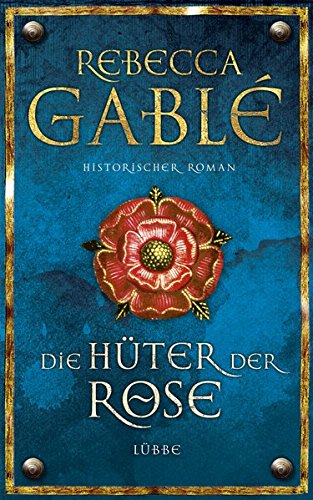
Festa, Frank (Hg.) – Necrophobia – Meister der Angst
Diese Buchbesprechung könnte sich der Rezensent sehr einfach machen. Zwanzig Horrorgeschichten präsentiert uns Herausgeber Festa. Es gibt kein Thema („Spukende Friedhofskaninchen“, „Zombie-Verschwörer aus dem Vatikan“ o. ä.), unter das diese Storys gestellt wurden. Auch eine chronologische Reihenfolge fehlt; „Necrophobia“ deckt etwa ein Jahrhundert phantastischer Kurzliteratur ab. Der Kitt, der diese Erzählungen zusammenhält, ist laut Frank Festa allein ihr Unterhaltungswert. Auf eine Vorstellung der einzelnen Geschichten wird an dieser Stelle deshalb verzichtet; sie wäre wenig sinnvoll und würde den Rahmen dieser Besprechung sprengen.
Den Puristen, der seinen Lesestoff systematisch gegliedert vorzieht, mag die scheinbare Beliebigkeit stören, doch wieso eigentlich? Das eigentlich Verblüffende an „Necrophobia“ ist die reine Existenz dieser Sammlung. Es ist schon eine Weile her, dass Kollektionen wie diese regelmäßig erschienen. Ihr „Sinn“ besteht darin, dem Freund des Phantastischen im Guten wie im Schlechten das Spektrum „seines“ Genres vor Augen zu führen. Die jüngere Generation von Horrorfreunden (und –freundinnen) ist weitgehend in einer Monokultur aufgewachsen. King, Koontz, Hohlbein, Rice – das soll angeblich moderner Horror sein.
Von den alten Meistern ganz zu schweigen. H. P. Lovecraft ist noch präsent, aber William Hope Hodgson, der Verfasser grandioser Seespuk-Storys? Oder Clark Ashton Smith? Wer weiß, dass Bram Stoker nicht nur „Dracula“, sondern auch ausgezeichnete Kurzgeschichten geschrieben hat? Oder ein Gustav Meyrink zumindest symbolisiert, dass es auch in Deutschland eine echte Geschichte klassischer Gruselliteratur gibt?
Zugegeben: Objektiv ist die Auswahl natürlich nicht. Guter Horror entsteht seit jeher nicht nur im angelsächsischen Sprachraum. Die im |Festa|-Verlag veröffentlichten Autoren dominieren auch „Necrophobia“. Aber würden ohne besagten Verlag Namen wie Richard Laymon, Jeffrey Thomas oder Brian Lumley hierzulande überhaupt einen Klang besitzen? Diese und andere |Festa|-Hausautoren weiten das Feld der Phantastik für die deutschen Leser. Das zählt stärker als jeder potenzielle „Vorwurf“ einer selektierenden Eigenwerbung.
Zumal „Necrophobia“ auch haptisch ein echtes Geschenk an sein Publikum ist. Mehr als 400 eng bedruckte Seiten für weniger als 10 Euro – das ist ein echtes Schnäppchen in der heutigen Hochpreis-Ära. Die Übersetzungen lesen sich flüssig, das Cover macht neugierig. Nein, auch hier gibt es keinen Grund zur Klage.
Was die Kriterien der Auswahl angeht, so ließe sich natürlich ausgiebig diskutieren. Storys wie „Die Stimme in der Nacht“ (W. H. Hodgson), „Pickmans Modell“ (H. P. Lovecraft), „Die Rückkehr des Hexers“ (C. A. Smith) oder „Die Squaw“ (B. Stoker) gelten mit Recht als zeitlose, bewährte Meisterstücke des Genres. Sie sind es wert, wieder einmal gedruckt und vor dem Vergessen bewahrt zu werden.
Die modernen Gruselgarne müssen sich ihre Sporen noch verdienen. Seien wir ehrlich: Den meisten wird es kaum gelingen. Das Zeug zum echten Klassiker haben u. a.
– „Summertime“ (S. P. Somtow mit einer wirklich üblen Story über ein psychopathisches Vater-Sohn-Serienmördergespann);
– „Der Mann, der Clive Barker sammelte“ (K. Newman mit einer schwarzhumorigen Satire auf Bücherfreunde, die ihr Hobby allzu ernst nehmen);
– „Puppen“ (R. Campbell mit einer Geschichte, die von einer Hexen- und Hexerschar in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts erzählt; selten wird die übliche Differenzierung zwischen Christentum = „gut“ und Teufelsglaube = „böse“ so überzeugend in Frage gestellt).
Ansonsten regiert das Mittelmaß, was hier keineswegs als Abwertung zu verstehen ist: Michael Marshall Smith, Brian McNaughton oder Graham Masterton sind einfach viel zu gute Horror-Handwerker, als dass ihre Storys den eigentlichen Zweck zu unterhalten nicht erfüllen könnten. Es ist zum Weinen, mit welcher Leichtigkeit die vorgestellten Autoren die deutschen Grusel-„Schriftsteller“ sogar dann deklassieren, wenn es „nur“ um das Abspulen eines ganz einfach gestrickten Gruselgarns geht. „Trentino Kid“ (J. Ford mit einer wunderbaren Spuk-auf-See-Geschichte), „Schluck die üble Saat“ (S. Clark variiert das uralte Thema des unausweichlichen Fluchs) oder „Die Hütte im Wald“ (R. Laymon mit einer richtig guten und unaufdringlichen Hommage an H. P. Lovecraft) seien als Lesetipps hervorgehoben. Aber auch Brian Lumley („Die dünnen Leute von Barrows Hill“) kann überraschen: Wenn er sich nicht gerade als zweitklassiger Lovecraft-Imitator („Titus-Crow“-Reihe) versucht oder als „Totenhorcher“-Fließbandautor tätig ist, bringt der Mann wirklich Lesbares zustande! Das gilt auch für Paul Busson, der die kürzeste Story dieser Sammlung („Rettungslos“) schrieb und uns mit seiner 1903 (!) entstandenen Schauermär vom lebendig Begrabenen und einem wirklich haarsträubenden Schlussgag in Angst & Schrecken versetzt.
Selbst Fehlschläge wie „In der letzten Reihe“ (B. Lumley versucht uns einen Uralt-Schlussschock anzudrehen, den noch der dümmste Leser bereits nach wenigen Absätzen erahnt), „Von Heiligen und Mördern“ (B. Hodge – lang & langweilig) und vor allem „Eine Halloween-Überraschung“ (F. Paul Wilson mit einem ganz legitim auf Ekel und Provokation setzenden, doch lächerlichen Machwerk; wie man Kotzgrusel richtig inszeniert, zeigt G. Masterton mit „Ein gefundenes Fressen“, seiner boshaft witzigen Story vom besessenen Hausschwein) ändern nichts am positiven Eindruck von „Necrophobia“. Es ist wirklich für jede/n etwas dabei – und die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden.
„Necrophobia“ – das ist übrigens nicht nur diese Sammlung von Kurzgeschichten, sondern auch der Titel einer Hörbuch-Reihe aus dem Hause |Festa|. Einige der nun gedruckt vorliegenden Storys gibt es – neben anderen – auch professionell vorgelesen auf zwei Doppel-CDs. Viel Potenzial also für eine Fortsetzung des „Necrophobia“-Projekts – als Hör- und Lesebuch.
Die Hörbücher:
[Necrophobia 1 1103
[Necrophobia 2 1073
Charles Stross – Supernova
„Supernova“ ist der Titel der direkten Fortsetzung von Charles Stross‘ Debütroman „Singularität“. Der Planet Moskau liegt mit Neu-Dresden in einem wirtschaftlichen Konflikt. Anscheinend steckt Neu-Dresden hinter der Attacke, die die Sonne Moskaus in eine Supernova verwandelt und ein Volk auslöscht. Eine etwas brachiale Methode der Konfliktlösung, möchte man meinen. Und natürlich streitet Dresden alles ab, sieht sich sogar selbst als Ziel des Rückschlags: Planetenbomber liegen unsichtbar auf Kurs.
Aus „Singularität“ ist bekannt, was eine „Verbotene Waffe“ ist: Kausalitätsverletzende Tätigkeiten, darunter fallen auch Waffen, können der Wesenheit „Eschaton“ gefährlich werden, sogar seine Existenz gefährden. Es ist also sein höchstes Bestreben, derartige Fälle zu verhindern; dabei greift es bei Bedarf auch hart, aber auf gewisse Weise humorvoll durch. Seit der Singularität, dem Entstehen des Eschaton, steht die Menschheit unter dessen Geboten, jegliche Kausalitätsverletzung zu unterlassen.
Nun beginnt „Supernova“ mit einer ebensolchen, hervorgerufen durch eine Verbotene Waffe. Ein Sonnensystem wird zerstört, ein bevölkerter Planet verdampft. Das wirft sofort die Frage auf, warum das Eschaton nicht eingegriffen hat?!
Versammlungsort: Weltraum
Wednesday Child
Wednesday, ein etwa neunzehnjähriges Mädchen, wird in den Fall verwickelt. Seit früher Kindheit steht sie mit Hermann, dem uns bekannten „Agenten“ des Eschaton, in Verbindung. Hermann brachte sie dazu, die verschiedenen Fertigkeiten der Spionage zu erlernen, so dass sie die dem Moskausystem vorgelagerte Raumstation, ihre Heimat, kennt wie unsereins den Inhalt seines Kühlschranks. Bei der Zwangsräumung der Station als Folge der Supernovabedrohung stößt Wednesday mit Hermanns Hilfe auf geheime Unterlagen, die brisante Informationen über die Schuldigen an der Katastrophe enthalten. Nun steht sie selbst im Fadenkreuz der Täter. Sie flüchtet über ein Luxusraumschiff, von Hermann mit den finanziellen Mitteln ausgestattet.
Die Übermenschen
Es existiert eine Organisation, die sich selbst als „Übermenschen“ bezeichnet. Ihre Mitglieder werden militärisch höchst effizient ausgebildet, ihre Fähigkeiten über Implantate verstärkt und ihre Emotionen kontrolliert. Ziel der Übermenschen ist es, das Eschaton zu vernichten und einen eigenen Gott zu entwickeln, in den der Geist aller verstorbenen Menschen zu seiner Entwicklung eingehen soll. Zu diesem Zweck sammeln die Übermenschen mit einer geheimen Technik Geistesinhalte ihrer Mitglieder, sobald diese gegen Vorschriften verstoßen – eine geeignete Kontrolle. Diese Tätigkeit sowie ihre hinterhältigen Eroberungsfeldzüge sind allgemein unbekannt, so dass sie weitgehend ungestört arbeiten können und der Allgemeinheit höchstens unheimlich sind.
Planetenregierungen übernehmen sie, indem sie die Mitglieder in Marionetten verwandeln, zu einer Volksrevolution treiben und sich schließlich als Hilfe anbieten, so dass sie ganz „legal“ an die diktatorische Macht kommen. Dass es daraus resultierende „Erziehungslager“ gibt, in denen brutal gewirtschaftet wird, ist weitgehend unbekannt.
An Bord des Luxusraumschiffs befindet sich eine kleine Gruppe der Übermenschen, die eine als Jugendfahrt getarnte Rundreise über jene Planeten unternehmen, auf denen Exminister der Moskauer Regierung sind, die über eine ultimative Vergeltungswaffe – die Planetenbomber – verfügen. Merkwürdigerweise gibt es unerklärliche Mordfälle an diesen Ministern, die zeitlich mit der Anwesenheit des Luxusschiffes zusammenfallen.
Die UN
Auf dem Schiff befindet sich auch die Geheimdienstlerin der Vereinten Nationen Rachel Mansour, die letztens den Konflikt in der Neuen Republik (vgl. „Singularität“) klärte, mit ihrem Mann Martin Springfield, der in selbigem Fall als Agent des Eschaton arbeitete (sein Verbindungsmann war ebenfalls Hermann, der sich jetzt um Wednesday kümmert). Sie sollen versuchen, die Mordserie aufzuklären und weitere Morde zu verhindern, um die Planetenbomber nicht in fremde Hände fallen zu lassen und sie von ihrem jetzigen Vergeltungsschlag gegen Neu-Dresden abzubringen.
Konfliktlösung
Stross befleißigt sich einer klareren Ausdrucksweise als im Vorgänger, so dass sich der Übersetzer weniger mit langen Anmerkungen zu arbeiten genötigt sah. Dadurch wird zumindest eine höhere Lesbarkeit erreicht und gleichzeitig das Augenmerk des Lesers auf den Inhalt gerichtet, wohin es gehört (das ist vielleicht der Unterschied zwischen der deutschen und der Originalausgabe von „Singularität“, das ja in englischsprachigen Ländern ein großer Erfolg war). Statt übermäßig vielen Anspielungen auf gesellschaftliche Begebenheiten der Heimat, unverständlich für Ausländer, und große physikalische Erklärungen entwickelt Stross eine mehrschichtige, spannende Handlung, die auch in „normaleren“ Bahnen abläuft als „Singularität“. Dabei bleiben leider einige interessante Aspekte als lose Fäden hängen, wobei die Hoffnung auf Auflösung in späteren Romanen begraben werden muss: In einem Interview für die SF-Zeitschrift „Locus“ soll sich Stross von den beiden Romanen distanziert haben. Er würde die Sache nicht weiter verfolgen, da ihm einige Inkonsistenzen durchgegangen seien. So werden wir wohl leider weder das Festival näher kennen lernen noch uns mit dem Eschaton und der großen Bedrohung für es auseinander setzen können.
Nochmal die Übermenschen
Davon abgesehen, kreiert Stross in Supernova wieder Spitzencharaktere mit vielfältigen Eigenarten und Hintergründen, die die Eigenarten glaubwürdig machen. Höchst interessant ist die Darstellung der Organisation der Übermenschen als brutal organisierte und gedrillte Sekte. Die Mitglieder lösen sich möglichst von den groben menschlichen Emotionen, alle Taten werden von dem großen Ziel geleitet, das Eschaton zu vernichten, um der eigenen Gottheit Willen. Dabei wagt sich Stross auf ein Terrain von großem Konfliktpotenzial: Die Übermenschen erinnern mit ihrer stolzen Logik und Überheblichkeit an die Darstellung der deutschen Nazis in Hitlers Gefolgschaft. Verstärkt wird der Eindruck durch deutsche Namen für die Handelnden; so heißt die Führerin passender Weise „Hoechst“, die Soldaten Karl, Paul und Mathilde begleiten sie. Ihren Namen voran wird ein U. gestellt, was ihre Zugehörigkeit zu den „Uebermenschen“ symbolisiert. Das Wort allein ist eine Übersetzung der Herrenrasse, der Arier. Ihre Handlungen sind von ähnlicher Abscheulichkeit: In den „Erziehungslagern“ werden Menschen umerzogen, Gehirne gewaschen, Menschen erniedrigt und gequält (was wiederum nicht an die Öffentlichkeit zu kommen bestimmt ist) -> Konzentrationslager der Zukunft.
Die Ideologie wird radikal und konsequent umgesetzt – die Frage dabei ist nur die nach Stross‘ Motivation diesbezüglich. Wenn man eine Verbindung zwischen dieser Organisation und den Nazis finden kann, erhält man sofort eine vorgebildete Meinung über die Mitglieder und die Glaubwürdigkeit von gemäßigten Aussagen und Standpunkten. Eine Vereinfachung der Charakterisierung für Stross, einfach Teil seines Zukunftsbildes oder steckt mehr dahinter? Natürlich gibt es auch hier Abtrünnige, wie es diese auch zu jeder Zeit in jedem diktatorischen Reich gibt und gab.
Das Eschaton
Was verbindet „Supernova“ mit „Singularität“? Die Protagonisten Mansour und Springfield (wobei Letzterer eine sehr viel geringere Rolle innehat) sowie der Eschatonagent Hermann und das Eschaton selbst, schließlich natürlich Bezüge wie die Erwähnung der „Neuen Republik“. Das Eschaton offenbart eine Schwäche und ein paar Eigenschaften, Dinge, die zu den interessantesten Themen dieses Universums zählen. Es existiert auf verschiedenen Zeitebenen und schickt seinen „jüngeren“ Ichs Informationen aus der Zukunft, vor allem, was die Gefahr von Kausalverletzungen angeht. Dadurch müsste es eigentlich Geschehnisse wie die Supernova des vorliegenden Bandes mittels Verbotener Waffen frühzeitig erkennen und verhindern können. Dass es das nicht konnte, deutet auf eine Schwäche oder einen mächtigen Gegner hin – mächtiger, als Hermanns Meinung nach die Übermenschen sind, die eigentlich mit ihrer ideologischen Planung eines „ungeborenen Gottes“ dem Eschaton noch längst nicht gefährlich werden können.
Sind die Übermenschen etwa doch mächtiger und dem Eschaton bereits ebenbürtig, war die verbotene Supernova doch ein Zufall (herbeigeführt durch unverstandene Experimente) oder existiert noch ein Gegner im Hintergrund, den Stross erst später vorstellen wollte? Fragen, die leider wohl keine Antwort mehr finden werden, soll man den Gerüchten um sein Interview glauben.
Fazit
Supernova ist weit besser lesbar als sein Vorgänger, die Kreativität der Geschichte ist beeindruckend und verlangt eigentlich nach Fortsetzung, in dieser Unabgeschlossenheit reicht es noch nicht zur vollen Befriedigung. Immerhin besteht die Hoffnung, dass Stross seine Ideen in anderer Richtung entfalten wird.
Der Autor vergibt: 



Köster-Lösche, Kari – Mit Kreuz und Schwert (Sachsen-Trilogie, Band 3)
[Das Blutgericht 1719
[Donars Rache 1729
Ich habe es in den vorangegangenen Rezensionen zur „Sachsen-Saga“ bereits anklingen lassen, dass mich die aktuelle Reihe von Kari Köster-Löscher nicht sonderlich aus den Schuhen gehauen hat, was vor allem mit ihrem recht abgehackten Schreibstil und dem verminderten Aufbau von echter Spannung zu tun hat. Dementsprechend wusste ich nun nicht, worauf ich mich beim dritten und letzten Band am meisten freuen sollte – auf das Buch an sich, oder doch mehr auf das Ende der Reihe, durch die ich mich anfangs wirklich gequält habe … 318 Seiten später weiß ich, dass die Wahrheit für mich persönlich wohl irgendwo dazwischen liegt, denn „Mit Kreuz und Schwert“ ist einerseits keine solch herbe Enttäuschung wie „Das Blutgericht“, andererseits aber auch nicht so gut und einigermaßen spannend erzählt wie „Donars Rache“. Dennoch werden Fans der Serie hier sicherlich ihre Freude haben, zumal sie bis zu diesem August ungefähr ein Jahr auf den letzten Teil der „Sachsen-Saga“ haben warten müssen.
_Story:_
Die Vergangenheit in der Zukunft ist für Gunhild scheinbar bewältigt, denn mittlerweile fühlt sie sich im Sachsen der Vergangenheit weitaus wohler als in der Kölner Siedlung, in der sie einmal gelebt hat. Nach einer erfolgreichen Flucht aus dem Lager der Franken, dem Glaubenskampg an der Seite von Gerowulf und der finalen Gerechtigkeit hat sie sich nun in ihrem neuen Heim niedergelassen und genießt das schlichte Leben in Sachsen. Ihr Geliebter Gerowulf ist seit einiger Zeit ihr Ehemann, und ihr gemeinsamer Sohn Helco entwickelt sich prächtig. Dennoch sind die Krisenzeiten keineswegs vorbei, denn nach wie vor kämpfen die Franken mit aller Macht um das noch nicht verloren geglaubte Sachsen. Doch auch in der Ehe von Gunhild und Gerowulf läuft nicht mehr alles zum Besten. Hinterlistige Intrigen und ein übler Verrat stellen das gemeinsame Leben auf eine harte Probe, und Gunhild zweifelt mehr und mehr daran, ob sie wirklich den Rest ihres Lebens mit Gerowulf in Sachsen verbringen möchte, oder ob sie doch lieber mit ihrem Sohn Helco in die Zukunft zurückkehren soll. Gunhild steht vor einer schweren Entscheidung, mit der sie sich nicht mehr lange Zeit lassen kann …
_Bewertung:_
Stand die Glaubensfrage in den ersten beiden Bänden noch deutlich vor der Liebesgeschichte zwischen Gunhild und Gerowulf, so nimmt diese in „Mit Kreuz und Schwert“ eine viel gewichtigere Rolle ein. Selbst die Tatsache, dass Gunhild sich bereits nach ihrer ersten Rückkehr in die heutige Zeit weiterhin nach Gerowulf sehnte, wurde von Kari Köster-Lösche nur recht knapp abgehandelt; jetzt jedoch, wo die Beziehung ersnthaft bedroht ist, ist sie das Hauptthema des ganzen Buches und degradiert den Kampf um Sachsen fast gänzlich zum Nebenschauplatz. Das wäre ja nicht weiter schlimm, nur hat die Autorin ersnthafte Probleme dabei, die aufkochenden Emotionen in Worte zu fassen und hält sich trotz der Dominanz des Themas mit Schilderungen über Gefühle ziemlich nüchtern zurück. Das erschwert wiederum den Zugang zum Buch, denn etwas Zwischenmenschliches so trocken zu beschreiben, langweilt phasenweise und wirft auch die zuletzt noch gelobte Spannung wieder zurück, denn diese ist in Teilen mal wieder kaum vorhanden.
Ebenso wird der Zwiespalt, in dem Gunhild sich zum Ende des Buches hin befindet, nur gerade mal ausreichend beschrieben. Der innerliche Konflikt, der ja nach außen hin ganz klar vorhanden ist, lässt emotionale Details vermissen, und bevor Gunhild dann richtig mit dem eigenen Gewissen zu ringen beginnt, ist die Sache auch schon wieder aufgelöst. Genau dieser hölzerne Stil ist es schließlich auch wieder, der mich an einigen Stellen der aufkeimenden Begeisterung beraubt und mich schließlich auch zu dem Urteil kommen lässt, dass Köster-Lösche mit diesem Buch eine recht durchschnittliche Serie mit einem gleichermaßen durchschnittlichen Band zu Ende gehen lässt. Ich kenne jedenfalls mehrere Dutzend lohnenswerterer HistoFantasy-Reihen, auch wenn sie sich thematisch nicht immer an tatsächlichen Begebenheiten orientieren. Die Autorin hat ihre Chance gehabt, ein solch gewagtes Thema für drei bewegende Romane zu verwenden, und meiner Meinung nach hat sie diese kaum genutzt.
Sara Paretsky – Die verschwundene Frau
Auf dem Heimfahrtüberrollt Privatdetektivin Vic Warshawski zu später Stunde in einem verrufenen Viertel ihrer Heimatstadt Chicago beinahe den leblosen Körper einer jungen Frau, die mitten auf der Straße liegt. Die Polizei scheint mit Warshawskis Schilderung zunächst zufrieden zu sein. Doch am nächsten Tag wirft man ihr plötzlich vor, den Tod verschuldet zu haben. Ganz offensichtlich sucht die Polizei einen Sündenbock. Die Leiche verschwindet, der Unfallbericht wird gefälscht. Der korrupte Detective Lemour wird Warshawski auf den Hals gehetzt, um sie einzuschüchtern.
Aus purer Not beginnt die Detektivin in eigener Sache zu ermitteln. Trotz der Verschleierungstaktik bringt sie in Erfahrung, dass es sich bei der Frau um die junge Immigrantin Nicola Aguinaldo handelt, die man fast tot geprügelt hatte, bevor man sie ihr vor das Auto legte. Nicola arbeitete als Kindermädchen für Robert Baladine, den Eigentümer von „Carnifice“, eines Sicherheitsdienst-Imperiums mit 3000 Beschäftigten, zu dem sogar eine eigene Haftanstalt vor den Toren der Stadt gehört. Hier saß Nicola als Gefangene ein, nachdem sie Eleanor, Baladines Gattin, ein wertvolles Schmuckstück gestohlen hatte. Auf mysteriöse Weise gelang es ihr später scheinbar zu fliehen. Sara Paretsky – Die verschwundene Frau weiterlesen
Nibelungen-Festspiele Worms
Uns ist in alten maeren
Wunders viel geseit
Von helden lobebaeren
Von grozer arebeit
Von freuden, hochgeziten
Von weinen und von klagen
Von küener recken striten
Muget ihr nun wunder hoeren sagen.
Aus dem Nibelungenlied
Vor vier Jahren begann Worms damit, Nibelungenfestspiele (http://www.nibelungenfestspiele.de) durchzuführen und wurde im ersten Jahr bundesweit als Provinz noch sehr belächelt. Ab dem zweiten Festspieljahr sah das schon anders aus und in diesem Jahr lief es bislang am besten: Alle 13 Vorstellungen der Hebbel-Inszenierung vor dem Nordportal des Wormser Doms waren ausverkauft. Mehr als ausverkauft geht nun einmal nicht, aber über eine künftige Verlängerung von zwei auf drei Wochen wird nun nachgedacht.
Die rund 19.000 Zuschauer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz bejubelten das Stück von Karin Beier sowie das Starensemble um Maria Schrader, Joachim Król, Manfred Zapatka, André Eisermann, Götz Schubert und Wiebke Puls. „Eine solche Resonanz wie in diesem Jahr haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Die Festspiele 2005 verliefen sehr positiv, ich bin rundum zufrieden“, sagt Festspielintendant Dieter Wedel.
Worms kann stolz auf seinen Glanz und Glimmer sein, denn vor fünf Jahren war es ein großes Wagnis, ohne Staatstheater und entsprechende Infrastruktur Festspiele in dieser Größe zu starten. Die Organisation, die im Vergleich zu anderen Festspielstädten nur von wenigen Machern betrieben wird, läuft reibungslos. Die Wormser sind stolz auf ihre Festspiele und das ist wichtig, denn wenn Steuergelder ausgegeben werden, ist es notwendig, dass solch große Events von der Bevölkerung breit unterstützt werden.
Das Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr stark aufgewertet und mit hochkarätigen Namen besetzt. Zu den Höhepunkten zählten Veranstaltungen mit Manfred Krug, Christian Quadflieg, Otto Sander und dem Kabarettisten Werner Schneyder. Die Besucherzahlen übertrafen alle Erwartungen: Knapp 6.000 Gäste kamen zu den Lesungen, Konzerten und den Theaterbegegnungen. Das Herrnsheimer Schloss wurde als zweite Festspielstätte hervorragend angenommen.
Die Vorhaben, Worms durch die Nibelungen touristisch aufzuwerten, sind vollkommen aufgegangen. Durch die Festspiele und auch die Nibelungen-Thematik, die sich durch das ganze Jahr hindurchzieht, kommen mehr und mehr Touristen in die Stadt.
In eine riesige VIP-Lounge verwandelte sich der romantische Heylshofpark rund um den Dom: Bunte Lichter, Wasserfontänen, der dunkelrote Drachenblutbrunnen und klassische Klänge sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre vor und nach den Aufführungen. Das elegante Ambiente zog
jeden Abend hunderte Besucher an. „Einfach sagenhaft“, lautete das Urteil der Gäste. Und mittlerweile zieht auch es auch viele Prominente von Salzburg über Bayreuth nunmehr regelmäßig nach Worms. Das Ambiente vorm Dom ist auch einzigartig. Die erscheinende Prominenz, die zu den Festspielen über sämtliche Aufführungen hinweg anreist, befindet sich natürlich auch immer im Blickpunkt der lokalen Presse, aber diese hier ausführlich zu benennen, erscheint mir nicht relevant. Jedenfalls gibt es bereits bei der Premiere, wie auch sonst allenorts üblich, einen breiten roten Teppich und jede Menge VIPs, umlagert von Fotografen. Der Medienrummel von rund 200 Medienvertretern bei der Premiere war schon sehr ungewöhnlich, zumal es sich ja „nur“ um eine Wiederaufführung der Hebbel-Inszenierung gehandelt hatte. Die Party nach der Premiere im festlich geschmückten, an den Dom grenzenden Heylspark ist mit all seinen Lichtern und Fackeln ein unvergleichliches Erlebnis, das man so nicht anderweitig zu sehen bekommt – weder in Salzburg noch in Bayreuth. Diese Party ging bis morgens um acht Uhr.
Trotz des verregneten Sommers blieb es in Worms während der Aufführungen die meiste Zeit trocken. Nicht eine einzige Vorführung mussten die Veranstalter – im Gegensatz zum Vorjahr – wegen schlechten Wetters absagen. Der Kampf mit dem Wetter – das zudem abends sowohl für die Schauspieler auf der Bühne als auch auf der hohen, windigen Tribüne für Sommerverhältnisse mitunter sehr kalt war – ist bei Freilichtspielen eine große Herausforderung. Einmal musste nach einem Regenbruch kurz vor der Pause fast abgebrochen werden – das Mikrofon von Kriemhild drohte den Dienst zu versagen –, aber auch hier gab es trotz diesen Widrigkeiten am Ende den gewohnten stürmischen Applaus. Doch diesmal applaudierten auch die Schauspieler umgekehrt dem Publikum und demonstrierten damit ihrerseits, dass auch diesem für das tapfere Ausharren Dank gebührte. Die Wormser Bevölkerung und die Sponsoren stehen zu ihren Nibelungen-Festspielen. Nach nur vier Jahren hat es Worms geschafft, sich bundesweit als Festspielstadt einen renommierten Namen zu erobern und als kultureller Leuchtturm zu etablieren.
Die Zuschauer saßen dieses Jahr noch einmal zwei Meter höher als letztes Jahr: auf einer 18 Meter hohen Tribüne, 26 Meter in der Breite. Für Rollstuhlfahrer wurden Rampen eingerichtet. Die normalen Preise rangierten von 25 Euro für die oberen Ränge bis zu 85 Euro für die untersten Plätze. Aber es gab auch Logen zu Preisen von 260 Euro für Einzelplatzkarten und 498 Euro für zwei Personen.
Im kommenden Jahr wird Dieter Wedel auf der Südseite des Doms „Die Nibelungen“ mit einem neuen Ensemble inszenieren. Angedacht ist eine überarbeitete Fassung von Moritz Rinke mit neu geschriebenen Szenen und Schwerpunkten. Die Geschichte endet in der Saison 2006 mit Siegfrieds Tod. Die grausame Rache der Kriemhild wird dann in der Fortsetzung des Stoffes im Sommer 2007 zu sehen sein.
So weit der Einstieg, aber schauen wir uns das Geschehen auch noch im Einzelnen an.
_Hebbel-Inzenierung der Nibelungen von Karin Beier_
In den bisherigen vier Jahren der Wormser Nibelungen-Festspiele mit unterschiedlichen Inszenierungen sahen insgesamt etwa 90.000 Zuschauer das Nibelungen-Drama. Seit zwei Jahren ist Dieter Wedel Intendant des Epos um Liebe und Hass, Politik und Rache am Originalschauplatz vor der atemberaubenden Kulisse des Wormser Doms. Dieses Ambiente ist theatertechnisch sensationell.
Karin Beiers Stück ist eine ernst zu nehmenden Inszenierung. Ihre Fassung ist intimer und konzentrierter als das Rinke-Stück der ersten beiden Festspieljahre. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Frauengestalten und ist damit eine sehr andere Nibelungengeschichte als die von Moritz Rinke. Die Geschichte der Frauen im Stück ist viel intensiver und auch die dunkle Seite Siegfrieds wird mehr beleuchtet. Im Grunde haben alle männlichen Schauspieler bei Beier neben den mitreißend intensiven Damen Maria Schrader und Wibke Puls einen schweren Stand. Sonstige Identifikationsmöglichkeiten gibt es da fast keine. Erstmals war dieses Jahr die Inszenierung tontechnisch zudem in Dolby Surround zu hören. Durch Highend-Digitaltechnik mit einem 5.1-Surround-System wurde die eindrucksvolle Inszenierung akustisch rundum erlebbar.
Dabei sind die Protagonisten in Worms auch für die Bevölkerung ansprechbar. Soweit es die aufwendigen Proben und fast täglichen Auftritte erlauben, integrieren sie sich in das städtische Leben, und vor den Vorführungen finden täglich abwechselnd mit allen lockere Talkgespräche bei freiem Eintritt für das interessierte Publikum statt.
Man sieht sie also zwar ständig in der Stadt, aber bei diesen Gesprächen hat man die Gelegenheit, ganz nah an die Darsteller heranzukommen und „live“ etwas über ihre Arbeit auf der Dombühne, aber auch viel „Privates“ zu erfahren. Die Schauspieler zeigen sich dem Publikum und allen Beteiligten dankbar: So fand ein Besuch der Mitarbeiter in der Wäscherei der Lebenshilfe statt, wo man sich bei den Behinderten bedankte, welche die anfallende Wäsche während der Festspielen waschen, trocknen und pflegen. Bei 13 Aufführungen werden alleine schon circa 1.100 Kostümteile gebügelt. Für die Behinderten selbst war das ein großes Ereignis, stolz zeigten sie, wie sie arbeiten, und manch einer brachte auch seine persönlichen Nibelungen-Sammelstücke mit zum Vorzeigen. Auch für den Weltladen waren sie aktiv und kamen zu dessen mit dem entwicklungspolitischen Netzwerk Rheinland-Pfalz organisierten „Nibelungen-Brunch“, wo ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten, Musik und Stars zum Anfassen aufgeboten wurden.
Da die Festspiele immer nahtlos in das danach beginnende Bachfischfest – eines der größten Volksfeste am Rhein – übergehen, unternahmen die Schauspieler auch einen gemeinsamen Rundgang über den Festplatz. Diese Führung übernahm André Eisermann, der aus einer Wormser Schaustellerfamilie stammt und das Backfischfest von klein auf sehr intim kennt. Nicht dabei sein konnte Hagen-Darsteller Manfred Zapatka, der als Einziger länger als geplant in Worms verweilen musste. Während der Festspiele hatte er bereits große Schmerzen im Knie, lehnte schmerzstillende Mittel bei den Vorführungen allerdings ab, damit er „unvernebelt“ auftreten konnte. Sofort nach Ende der Festspiele musste er im Wormser Krankenhaus am Meniskus operiert werden und benötigte noch Schonung; die erste Zeit konnte er natürlich nur an Krücken gehen. Das zeigt aber auch ein eigentliches Problem, denn wenn ein Schauspieler generell mal bei den Festspielen ausfällt, steht keine Zweitbesetzung zur Verfügung. Im Vorjahr zum Beispiel war auch schon Wiebke Puls bei den Proben in eine Bühnenöffnung gestürzt und hatte sich „glücklicherweise“ dabei nur das Nasenbein gebrochen. Der damals nachfallende Joachim Kròl blieb unverletzt. Das Ensemble stand trotzdem einige Tage unter Schock.
_Dieter Wedel_
Seit mehr als einem Jahr ist Dieter Wedel Intendant der Festspiele. Er promovierte an der Freien Universität Berlin in den Fächern Theaterwissenschaften, Philosophie und Literatur. Unzähligen Theatererfahrungen folgten eine kurze Zeit als Hörspielautor und dann Engagements fürs Fernsehen sowie erste Filme: „Einmal im Leben“ war der erste TV-Mehrteiler, womit die Erfolgsstory der Familie Semmeling begann. Es folgte die Fortsetzung „Alle Jahre wieder“ und dann gründete er seine eigene Produktionsfirma. Seitdem ist er Autor, Regisseur und Produzent in einer Person. Neben den großen Fernsehproduktionen wie „Kampf der Tiger“ oder „Wilder Westen inclusive“ bleibt er weiterhin Theaterbühnen treu. Für seine TV-Mehrteiler „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ und „Die Affaire Semmeling“ erhielt er auch international zahlreiche Auszeichnungen. 2002 inszenierte er die Nibelungenuraufführung von Moritz Rinke. Danach wurde er Intendant der Wormser Festspiele.
_Karin Beier_
Sie ist renommierte Theater- und Opernregisseurin. Begonnen hatte sie mit einer eigenen Theatergruppe und führte Shakespears Dramen im Original und unter freiem Himmel auf. Dann folgten eine Regieassistenz am Düsseldorfer Schauspielhaus und seither eigene Arbeiten. Sie inszenierte die deutsche Erstaufführung von „Die 25. Stunde“ von George Tabori sowie Shakespeares „Romeo und Julia“, für das sie 1994 zur Nachwuchsregisseurin des Jahres gewählt wurde. 1995 erarbeitete sie mit vierzehn Schauspielern aus neun Ländern eine mehrsprachige, multikulturelle Inszenierung des „Sommernachttraums“. 1997 schloss sich mit Bizets „Carmen“ ihre erste Oper an. Es folgten unter anderem „99 Grad“, „Das Maß der Dinge“ und „Der Entertainer“. Dieses Jahr inszenierte sie mit kleinen Veränderungen zum zweiten Mal in Worms ein neues Stück nach der klassischen Textvorlage von Friedrich Hebbel. Karin Beier, die, wenn sie nicht arbeitet, ganz alternativ im Norden Schottlands lebt und kleine Lämmer auf die Welt holt, schaut auf ihre zwei Jahre Festspielzeit in Worms gerne zurück. Nachdem sie vor zwei Jahren noch Bedenken hatte, mit Schauspielern aus unterschiedlichsten Sphären des Films und Theaters zu arbeiten, hat sich alles für sie „extrem gelohnt“ und die Ängste waren unbegründet. Keiner des Ensembles hat Starallüren, und nach einem Jahr nach Worms zurückzukommen, war dieses Mal wie eine Heimkehr.
_Maria Schrader_
Sie ist wohl eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen heutzutage. Sie begann ihre Ausbildung am Max-Reinhard-Seminar in Wien. Dann spielte sie an Schauspielhäusern unter anderem in Hannover und Bonn. Ihr Kinodebüt gab sie mit „Robby, Kalle, Paul“. Bekannt wurde sie dann mit Doris Dörries Komödie „Bin ich schön?“. 1999 erhielt sie den Silbernen Bären und den Deutschen Filmpreis für ihre Rolle in „Aimée und der Jaguar“. Von Anfang an spielt sie in Worms die Kriemhild.
_Wibke Puls_
Ausbildung an der Berliner Hochschule der Künste. Danach Schauspielhaus Hamburg. Sie spielt auf mitreißende Art seit Beginn der Festspiele die Brunhild. Vor ihrer Schauspielkarriere machte sie Musik, was sie in den letzten beiden Festspieljahren für die Wormser durch ihren einzigartig intensiven Konzertauftritt mit dem Festspielensemble auch unter Beweis stellt. Sie tritt in Beiers Stück mit nacktem Oberkörper auf, was dieses Jahr in der „Regenbogen-Presse“ für Aufsehen sorgte. „Bild“-Zeitungsüberschrift mit entsprechendem Foto: „Brusthild und die Nippelungen“. Selbst die „Münchner Abendzeitung“ meldete „Die nackten Nibelungen in Worms“. Trotz der kargen Bekleidung hat sie die aufwendigste Maske bei den Aufführungen, denn in der ersten Hälfte vor ihrer Verheiratung mit Gunther trägt sie am ganzen Körper amazonenwilde Tattoos. In der aktuellen Inszenierung der Nibelungen von den Münchner Kammerspielen spielt sie interessanterweise anstelle der Brunhild die Kriemhild und erhielt dafür den Alfred-Kerr-Darstellerpreis.
_Manfred Zapatka_
Ausgebildet an der westfälischen Schauspielschule Bochum, danach an Theatern wie Stuttgart und München engagiert. Er ist einer der großen Charakterdarsteller im deutschen Film und Fernsehen, bekannt z. B. aus der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ (1989) und in Dieter Wedels Mehrteiler „Der große Bellheim“ (1992). Für die Rolle des Heinrich Himmler in „Das Himmler-Projekt“ (2002) wurde er mit dem Adolf-Grimm-Preis ausgezeichnet. Bei den Nibelungen-Festspielen trat er als Hagen auf. Auffallend war beim Publikumsgesprächsabend mit ihm sein politisches Engagement. Zwar rief er nicht direkt zur Wahl der Linkspartei auf, übte aber starke Kritik an der SPD, für die er früher immer eintrat.
_André Eisermann_
Mit der Rolle des „Kaspar Hauser“ wurde Eisermann 1993 aus dem „Nichts“ heraus international bekannt. Er wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so z. B. mit dem Darstellerpreis des Internationalen Filmfestes von Locarno, dem Bayrischen Staatspreis und dem Deutschen Filmpreis. Danach folgte der ebenso grandiose Film „Schlafes Bruder“. Für diese Rolle war er für den Golden Globe nominiert. Seitdem er den Bundesfilmpreis bekam, ist er Akademie-Mitglied der Bundesfilmpreisverleihung. Allerdings ist er auch durch verschiedene Lesungen sehr bekannt geworden. Seit Beginn der Wormser Nibelungenfestspiele hatte er die Rolle des Giselher inne. Derzeit spielt er in Füssen im Musical „Ludwig II.“ dessen Bruder Otto. Als Wormser ist er seit seiner Kindheit mit dem Nibelungenthema vertraut, und selbst wenn er im nächsten Jahr nicht mehr zur Besetzung gehören wird, gibt es wie bisher etwas Neues von ihm im Rahmenprogramm der Festspiele. Im nächsten Jahr wird es endlich auch wieder einen großen Film mit ihm geben, ein Projekt, über das bislang aber nirgendwo etwas verraten wird.
_Joachim Król_
Als einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands wird er nach wie vor hauptsächlich mit seiner Rolle im Film „Der bewegte Mann“ von 1994 identifiziert, den er nach seinen Engagements an deutschen Theatern spielte. Für die dortige Rolle des leidenden Norbert Brommer an der Seite von Til Schweiger erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, so etwa den Bambi und den Deutschen Filmpreis. Danach folgten „Rossini“ und, ebenfalls zusammen mit Maria Schrader, der Film „Bin ich schön?“ von Doris Dörries. Auch internationale Filmprojekte folgten („Zugvögel … einmal nach Inari“ und „Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe und Tod“). Als Commissario Brunetti spielte er in Donna Leons Fernsehkrimis und war zuletzt im Kino als Killer in „Lautlos“ zu sehen. In Worms spielte er den König Gunther.
_Götz Schubert_
Er studierte an der staatlichen Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Zunächst Theater auf den Bühnen in Berlin, dann zahlreiche Fernsehproduktionen wie „Der Zimmerspringbrunnen“, „Die Affaire Semmeling“ von Dieter Wedel und der Kinofilm „NAPOLA“. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Für die Wormser ist er mittlerweile der „klassische“ Siegfried-Darsteller geworden und spielte diese Rolle schon bei der modernen Interpretation von Moritz Rinke in den ersten beiden Festspieljahren. Im letzten Jahr fiel er aus, wurde aber für die Wiederauflage des Beierschen Hebbel-Stückes erneut als Siegfried verpflichtet und ersetze Martin Lindow, der zuletzt den Siegfried spielte. Die Siegfried-Rolle bei Beier ist weniger männlich angelegt als die des kahlköpfigen Haudegen bei Rinke. Zuletzt drehte Schubert mit Veronika Ferres den ZDF-Zweiteiler „Neger, Neger, Schornsteinfeger“, davor stand er für Dieter Wedels Zweiteiler „Papa und Mama“ vor der Kamera, der im Januar 2006 im Fernsehen zu sehen sein wird. Im Maxim-Gorki-Theater in Berlin spielt er aktuell neben Jörg Schüttauf in der „Dreigroschenoper“ und als nächstes ebenfalls dort im „Zerbrochenen Krug“ den Dorfrichter.
_Tilo Keiner_
Er war auf der London Academy of Music and Dramatic Art. Neben verschiedenen Theaterengagements (u. a. Trier, Nürnberg und Köln, Hamburg, Bochum, Nürnberg) ging er auch zum Film und Fernsehen, z. B. für TV-Serien wie „SOKO 5113“ oder „Girlfriends“. Dann spielte er im Film „Saving Private Ryan“ unter der Regie von Steven Spielberg. Auch im deutschen Film „Der Ärgermacher“ war er zu sehen. Derzeit gastiert er auch als Musicaldarsteller Harry im ABBA-Stück „Mamma Mia!“ in Stuttgart. Bei den Nibelungen spielte er den Werbel an Etzels Hof und war damit dieses Jahr neu im Ensemble. Er ersetzte die Rolle von Andreas Bikowski (den Werbel vom letzten Jahr).
_Isabella Eva Bartdorff_
Sie spielte die skurrile Tochter Rüdigers und glänzte an der Seite von André Eisermann, der sie als Giselher in diesem Stück heiraten sollte, ganz besonders. Sie studierte Schauspiel an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und war bereits an Theaterhäusern in Hamburg, Frankfurt, Essen, Bonn und Darmstadt.
_Itzhak Fintzi_
Er gilt in Bulgarien als Superstar und spielte vorm Wormser Dom auf seine charismatische Art den König Etzel. Dass er viele Passagen auf Bulgarisch spricht, macht seine Rolle besonders atmosphärisch.
_Sebastian Hufschmidt_
Er gibt den Gerenot, den Bruder des Königs Gunther. Er spielte an Theatern u. a. in Düsseldorf, Braunschweig und Hannover.
_Josef Ostendorf_
An Schauspielhäusern spielte er in Hamburg, Basel und Zürich. Bekannt ist er auch aus Fernsehfilmen wie „Wolffs Revier“, „Die Männer vom K3“, „Tatort“, „Bella Block“ und „Adelheid und ihr Mörder“. Mehrere Kinofilme sind auch darunter, z. B. „Der Campus“. Bei den Nibelungenfestspielen ist er von Anfang an dabei und spielte in den ersten beiden Jahren den Königsbruder Gernot. Bei Katrin Beier hatte er dagegen die Rolle des Volker von Alzey.
_Michael Wittenborn_
Er spielte an Theatern Hamburg und München. Für Dieter Wedel spielte er im Fernsehen u.a. „Der Schattenmann“, „Der große Bellheim“ und „Die Affaire Semmeling“. Bei den Festspielen spielte er den Markgraf Rüdiger von Bechelarn und ist der Ehemann der Regisseurin Karin Beier.
_Wolfgang Pregler_
Lernte an der Hochschule für Künste in Berlin. Schauspielerfahrung an den Theatern München, Berlin und Hamburg. Ebenso Film- und Fernsehproduktionen wie „Die Affaire Semmeling“ in der Regie von Dieter Wedel (2001) und der internationale Kinofilm „Rosenstraße“ mit Maria Schrader (2003). Auch er gehört zur Urbesetzung und spielte in den ersten beiden Jahren den König Gunther, bei Karin Beier allerdings Dietrich von Bern. Er stammt von den Münchner Kammerspielen.
Nach der letzten Vorstellung, die wie gewohnt mit langem Schlussapplaus endete, drückte Karin Beier jedem Schauspieler ein Glas Sekt in die Hand und es gab zahlreiche Küsschen zu sehen. Auch als die Zuschauertribünen dann leer waren, ging es nochmals gemeinsam auf die Bühne, um Abschied von der großartigen Kulisse vor dem Kaiserdom zu nehmen. Darauf folgte die Abschiedsparty mit Livemusik und einer Stimmung aus Heiterkeit und Melancholie. Lange Umarmungen und auch Tränen, denn dieses Ensemble, das sich menschlich so gut verstand, wird in dieser Zusammensetzung nie wieder zusammenkommen. Dieter Wedel hat angekündigt, für die nächsten Inszenierungen neue Schauspieler nach Worms zu schicken.
_Ein Blick auf die Statisten_
Ohne die Wormser Statisten, die jedes Jahr den Sommer für Proben und Aufführungen opfern, wären die Festspiele nicht vollständig. Es sind viele Wormser involviert, und das bereitet ihnen großen Spaß. Auch eine Hundemeute ist dieses Jahr mit auf der Bühne gewesen, und manche davon haben nach den Festspielen ein neues Herrchen bei den Statisten gefunden.
Manche entpuppen sich dabei als Neueinsteiger mit Karriere-Erwartungen im Schauspielbusiness. Seit dem ersten Festspieljahr besteht einmal im Monat ein regelmäßiger Statistenstammtisch. Trotz der intensiven, fast unbezahlten Arbeitszeit, ist es für alle ein Genuss, mit Größen wie Dieter Wedel oder früher Mario Adorf als Hagen gearbeitet zu haben. Mitunter erscheinen dort auch die Regieassistenz und der künstlerische Leiter der Festspiele, James McDowell.
_Ilka Kohlmann_
Hatte in den ersten beiden Jahren als Statistin angefangen und spielt nun bereits zum zweiten Mal die Mutter von Gudrun. Zwar hat sie nur einen Kurzauftritt, aber natürlich ist jeder Abend auch für sie ein großes Erlebnis, steht sie doch auch beim Schlussapplaus vor stehenden Ovationen mit auf der Bühne. Auch ihr Ehemann Jürgen ist immer dabei, in diesem Jahr als „Hunnen-Trommler“. Auch im nächsten Jahr werden beide wieder gefragt sein.
Ein kleiner Wormser Junge freut sich auch jedes Jahr ganz besonders auf seine Rolle. Er spielt das Kind von Kriemhild und Etzel, auch wenn er anschließend stets geköpft und verstorben die Bühne verlässt.
Dreißig Hunnen sind im Einsatz als Statisten, und deren Maske ist von den Professionellen zeitlich nicht zu bewältigen. Dafür wurde eigens ein Schminkwettbewerb ausgeschrieben und acht Wormser Frauen wurden ausgewählt. Auch für Kostüme und Waffen sind Wormser zuständig. Waffenmeister ist dabei Thomas Haaß, der im Zuge der Nibelungenthematik und der daraus entstanden Gewandeten-Szene ständig in Worms mittelalterlich mitmischt.
_Das Rahmenprogramm:_
_Filme_
Jedes Jahr gibt es ein begleitendes Filmprogramm, aber man kann nicht jedes Jahr die Nibelungen von Fritz Lang oder die Filme aus den 60er Jahren aufführen, und so zeigt man bereits im zweiten Jahr aktuelle Filme aus dem Wirken der Festspielschauspieler. Das waren diesmal Maria Schrader, die zusammen mit Dani Levy in „Meschugge“ die Jüdin Lena Katz spielte, einem Thriller, für den sie für ihre Rolle 1999 den Bundesfilmpreis als beste Hauptdarstellerin erhielt. Joachim Król spielt in „Gloomy Sunday“ eine Dreiecksgeschichte im Budapest der 30er Jahre während der Besetzung durch die Nazis. Und Manfred Zapatka spielte in der Komödie „Erkan und Stefan“ den Verleger Eckenförde, dessen Tochter von den beiden Komikern beschützt werden soll. Die Filme laufen auf großer Leinwand im Open-Air-Kino im Herrnsheimer Schloss. Mit gewöhnlichem Popcorn-Kino hat das also nichts zu tun. Man wird von Festpiel-Hostessen empfangen und steht vor und nach der Aufführung an Stehtischen bei einem Glas Wein zusammen.
_Otto Sander, die Nibelungen-Musiker und die Trommler von Worms_
Otto Sander und Gerd Bessler, der musikalische Leiter der Wormser Hebbel-Inszenierung, gestalteten einen „Heldenabend“ mit Texten und Musik, gespielt vom gesamten musikalischen Ensemble der Festspiele und unterstützt von fünfundzwanzig Trommlern. In den Texten hörte man die Gegensätzlichkeit der Helden durch die Epochen und Länder, und vor allem die Musik war natürlich ein Hörgenuss, in welchem mittelalterliche Motive mit modernen Jazzelementen verschmolzen. Eine Hör- und Augenweide waren vor allem auch die Wormser Trommler, die auf Stahlfässern und Landknechtstrommeln archaische bombastische Rhythmen schlugen. Über neunhundert Besucher sahen sich das an.
_Werner Schneyder und das Ensemble der Nibelungen-Festspiele lesen Richard Wagner_
Der bekannte Kabarettist und Sportmoderator führte durch die Handlung von Wagners „Der Ring des Nibelungen“, und die Schauspieler der Festspiele lasen die Texte. Wahrscheinlich wurde noch nie der ganze „Wagner-Ring“ in so kurzer Zeit in straffer Form dargeboten. Faszinierend waren tatsächlich auch die von Schneyder dargebotenen originalen und ausführlichen Regieanweisungen Wagners, die schmunzeln ließen, da diese selbst mit modernster Technik bis heute unrealisierbar geblieben sind. Auch diese Veranstaltung war ausverkauft, allerdings sicher weniger wegen des Wagner-Themas, sondern als Sympathie-Kundgebung der Wormser für „ihre“ Stars. Es kamen fast neunhundert Besucher.
_Theaterbegegnungen im Herrnsheimer Schloss_
Diese Veranstaltung hat bereits gute Tradition bei den Festspielen und stellt in der Vielseitigkeit des Programmablaufs einen der interessantesten Aspekte im Rahmenprogramm, den man nicht versäumen sollte. Das sehen sehr viele Besucher mittlerweile auch so. Zu den Morgenvorträgen kamen weit mehr als erwartet – man rechnet für solche wissenschaftlich-literarischen Vorträge normalerweise mit einem Interesse von 30 bis 40 Personen, aber die 150 Sitzplätze waren schnell besetzt und weitere etwa 50 standen noch draußen vor der Tür. Teils im schönen Saal des Schlosses, teils unter freiem Himmel, teils in der Remise, treffen sich Zuschauer und Künstler, Politiker, Wissenschaftler, Vertreter aus Kirche und Wirtschaft, um miteinander zu diskutieren, zu lachen und zu streiten. Eine einzigartige intime Gelegenheit, richtig nahe an die VIPs herantreten zu können. In diesem Jahr war das Thema „Was ist deutsch?“.
In den Morgenvorträgen beleuchtete Kulturkoordinator Volker Gallé Literatur und Politik als deutsches Dilemma, Monika Carbe referierte über den Missbrauch von Schiller als Nationaldichter und Gunther Nickel sprach anhand einer Zuckmayer-Rezipation über das Deutschlandbild vom Ersten Weltkrieg bis zur Gründung der Bundesrepublik und wies dabei fast nebenbei die Zuordnung von Ernst Jünger als rechtsgerichteten Autor vom Tisch. Dabei stellte er auch fest, dass dies der Stand der aktuellen Jünger-Forschung sei.
Für die Programmpunkte danach reichte natürlich der Platz mit dem wunderschönen englischen Park dahinter für alle aus – aber auch hier war die Remise dennoch gefüllt bis auf den letzten Platz. Mittags folgten Texte über die Deutschen, gelesen von den Festspiel-Darstellern, von Tacitus bis Willy Brandt – ein sehr aufschlussreiches intensives Erlebnis zum Deutschsein. Höhepunkt war wie schon im letzten Jahr der Auftritt von Wiebke Puls (Brunhilde) mit umgeschnalltem Akkordeon (und meist Zigarette im Mundwinkel) und Itzhak Fintzi (König Etzel), die mit dem Festspiel-Ensemble für ihre eigenen musikalischen Interpretationen der Hebbel`schen Nibelungentexte faszinierten und begeistern konnten. Sehr intim und locker startete bereits der Auftritt: „Hallo, wir sind hier, um ein bisschen Musik zu machen“. Cello, Geige, Trompete und viele subtile Schlaginstrumente präsentierten eine experimentelle musikalische Avantgarde. Die Zuschauer lieben es, wenn Wiebke Puls ins Mikrophon erbärmlich schreit, faucht und haucht. In der Zugabe kam auch Maria Schrader (Kriemhild) auf die Bühne und beide sangen anstatt des bekannten Königinnenstreits die mitreißend zärtliche Version einer Liebeshommage der Königinnen („You are so beautiful“) zueinander und lagen sich danach unter stürmischen Applaus in den Armen. Abgeschlossen wurde mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Was ist deutsch?“ mit Hark Bohm (Filmemacher), Dieter Wedel (TV- und Filmregisseur, Intendant der Festspiele) und Prof. Paul Nolte von der Universität Bremen.
_Jugendblasorchester Rheinland-Pfalz spielte zeitgenössische Kompositionen aus aller Welt und Joern Hinkel las dazu deutsche Reden und Aufsätze aus sechs Jahrhunderten_
Joern Hinkel ist Regieassistent von Dieter Wedel und las Texte von Deutschen über Deutsche, Thesen und Antithesen, Beschwerden, Aufrufe, Zornausbrüche, Gedichte und Gesetzestexte, lächelnd, tobend und analytisch. Dazu gab es zeitgenössische Musik, die von der Heimat erzählte.
_Peer Gynt_
Einer der weiteren Höhepunkte war die Darbietung des Festspielschauspielers André Eisermann, der mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Edward Griegs Schauspielmusik zu „Peer Gynt“ darbot. Das war eine seltene Gelegenheit, die originale Bühnenmusik gelöst vom literarischen Ursprung zu erleben. Neben der Philharmonie waren auch der Wormser Bachchor und „Cantus Novus“ sowie die Sopranistin Caroline Melzer integriert, die zusätzlich das Lied der Solveig sang. Der rote Faden der Schauspielhandlung wurde durch Zwischentexte nachvollziehbar. Den Part der Titelfigur übernahm André Eisermann und machte wie gewohnt seine Lesung zum Erlebnis. Ob nun Goethes Werther oder das Hohelied der Liebe – mit denen er früher Lesungen gab –, schafft er es immer, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Er rezitiert nämlich nicht, sondern verkörpert das, von dem er spricht. Seine jährlichen Vorstellungen im Begleitprogramm der Festspiele sind in Worms seit jeher stets ausverkauft. Aber auch Eva Bartdorff, die ebenfalls Texte las, war ihm ebenbürtig.
_Musikwettbewerb_
Für dieses Jahr hatten die Festspiel-Veranstalter eine ganz besondere Idee und riefen zu Beginn des Jahres zu einem Musikwettbewerb auf, wo jeder Nibelungensongs einreichen konnte. Aus über 50 Liedern wählte eine Jury, bestehend aus SWR, der Popakademie Mannheim und den Festspielen, zehn Bands aus. Diese spielten an zwei Abenden je 30 Minuten Programm und das Spektrum reichte dabei von Reggae, Rap, Pop und Rock über Volksmusik, Country und Dark Wave bis zur Klassik. So verschieden die Stilrichtungen waren, umso unterhaltsamer waren entsprechend auch die Beiträge zum Nibelungen-Thema.
Eine CD dazu ist auch erhältlich, auf der alle ausgewählten Bands „ihren“ Nibelungen-Song präsentieren. Ein Beiheft enthält alle Texte und die Anschaffung macht Freude und ist auch sehr günstig. Die „Musikwettbewerb – Nibelungen-Festspiele Worms“-CD kostet nur 5 Euro und ist erhältlich über info@nibelungen-museum.de.
Enthalten darauf ist auch der Song ‚Siegfried‘ von _Corpsepain_, welche auf der Schwesternseite von |Buchwurm.info|, |POWERMETAL.de|, mit ihrer dunklen Saga-Interpretation des Nibelungen-Themas rezensiert wurden: [„The Dark Saga of the Nibelungs“.]http://www.powermetal.de/cdreview/review-6242.html Sie schlugen sich auch recht gut im Vergleich zu anderen Bands, und wenn ich mich nicht ganz täusche, stieß ich mit meinen Freunden während ihres Auftritts auf „Friedrich“ an (Nietzsche versteht sich). Auch diese CD ist für 9,99 Euro zu beziehen unter info@nibelungen-museum.de.
Das Abschlusslied der CD, ‚Brunhilds Klage‘, stammt von _Weena_, die die besten Interpreten auf dem Festival waren und auch in der Publikumsgunst ganz oben stehen. Sie beschlossen, nachdem sie beim Wettbewerb ausgewählt wurden, eine ganze Rockoper zu den Nibelungen zu verfassen und spielten daher auch ein reines Nibelungen-Set. Thomas Lang ist Rockmusiker und Sylva Bouchard-Beier ausgebildete Opernsängerin. Wie sie zueinander fanden, ist auch eine besondere Geschichte. Thomas kam, um seine Stimme bei ihr ausbilden zu lassen und beide merkten schnell, dass der Crossover aus Rock und Klassik begeistert. Ihre Musik, die in melodischen Passagen in ihrer Heiterkeit an Elemente von |Goethes Erben| erinnert, im Zusammenklang des Beats mit opernartiger Klangfülle aber eher Bands wie |Therion| zuzurechnen ist – und damit natürlich auch an Wagner erinnert –, hat auch wegen der stimmlichen Leistung von Sylva etwas von |Rosenstolz|. Bislang wird die pompöse Zusatzmusik noch durch Synthesizer eingespielt, aber der Auftritt mit einem großen Orchester ist geplant und durch die Zusammenarbeit mit der Festspiel GmbH auch nicht mehr utopisch. Den ersten Teil der Rockoper, „Das Nibelungenlied – Von Betrug, Verrat und Mord“, gibt es bereits auf CD, nächstes Jahr wird der zweite Teil folgen. Auch diese CD ist relativ günstig über das Nibelungen-Museum für 13 Euro zu erwerben: info@nibelungen-museum.de.
Das Festival nannte sich „Coole Sounds für Kriemhild, Hagen & Co.“ und war den Besuch wert. Leider aber waren im Gegensatz zum anderen Rahmenprogramm der Festspiele die beiden Musikfestival-Tage sehr mager besucht, was darauf schließen lässt, dass im nächsten Jahr dieses neue Experiment gestrichen wird. Das wäre sehr schade, denn die Idee war gut und ein Musikfestival ist sicher ein wichtiger Baustein, der einfach noch eine Chance bräuchte, sich zu etablieren. Dass dagegen _Weena_ in einem eigenen Konzert ihre Oper aufführen dürfen, ist mehr als sicher, so umfeiert, wie sie in der lokalen Presse wurden.
_Kikeriki-Theater_
Im dritten Jahr ist dieser Programmpunkt bereits ein durchgehend ausverkaufter Renner während der Festspiele. Das Darmstädter Kikeriki-Theater bot mit „Siegfrieds Nibelungenentzündung“ ein sagenhaftes Blechspektakel um Siggi, Albi und den smarten Lindwurm im Hessen-Dialekt: deftig, heiter und krachig.
_Weiteres Programm_
Nicht nur Nibelungen waren Thema des Rahmenprogramms. Die neue städtische [Literaturinitiative,]http://www.worms.de/deutsch/leben__in__worms/kultur/literaturinitiative-worms__teilnehmer.php der auch |Buchwurm.info|-Schreiber Berthold Röth angehört, trug mit Lesungen bei: _Manfred Krug_ las Bertolt Brecht, _Christian Quadflieg_ las Friedrich Hebbel (immerhin hatte dieser auch das Nibelungen-Festspiel ursprünglich verfasst) und gerne möchte er in einer künftigen Inszenierung einmal den Hagen spielen; _Eva Menasse_ las aus ihrem Debüt-Roman „Vienna“.
Diese Lesungen kosten natürlich Eintritt, aber die_ [Nibelungenlied-Gesellschaft]http://www.nibelungenlied-gesellschaft.de/ _veranstaltete während der gesamten Festspiele morgens um elf Uhr im Historischen Museum kostenlose Vorträge zum Nibelungenthema, die in diesem Jahr den Stoff im Rahmen der europäischen Literaturgeschichte betrachteten. Das Heldenepos ist zweifelsfrei eingebettet in eine europäische Kulturtradition. Das Publikum dafür ist gemischt, es kommen sowohl Wormser als auch Festspielbesucher der Stadt, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Die Vorträge haben wissenschaftlichen Anspruch, sind aber auch für den Laien verständlich gehalten. Im Einzelnen:
„Untergangsszenarien an der Wende zur neuen Zeit – das Nibelungenlied und Hamlet“
„Die Nibelungen in Hebbels Briefen“
„Höfische Heldendichtung im Umfeld des Nibelungenliedes“
„Fantasien von Germanen und Kelten – Fouqués „Held des Nordens“ und Macphersons „Ossian“
„Rüdiger und Dietrich im Nibelungenlied und bei Hebbel“
„Das Nibelungenlied und die Märchen“
„Die Nibelungen als Fantasy-Stoff“ und
„Die Geburt des Rechts aus der Rache – Orestie und Nibelungenlied im Vergleich“.
Normalerweise werden diese Vorträge auch auf die angegebene Website gestellt, jedenfalls findet man dort auch die Vorträge früherer Jahre.
Alles Weitere auch noch en detail aufzuzählen, sprengt den Rahmen dieses Überblicks. Es gab noch mehrere verschiedene Märchenabende mit Harfenbegleitung, Theater-Aktionstage für Kinder und Jugendliche, neben dem Kikeriki-Theater noch weitere neue Kindertheaterstücke um Drachen und Ritter. Da die Festspiele in die Ferienzeit-Programme fallen, gab es darüber hinaus von vielen kleineren Anbietern Thematisches zu Siegfried und den Nibelungen. An weiteren Musikveranstaltungen spielten „Il Cinquecento“ im Dominikanerkloster Musik der Renaissance und „Capella Antiqua Bambergensis“ mittelalterliche Musik. An Ausstellungen zum Nibelungen-Thema gab es gleich vier an verschiedenen Orten: „Siegfriede – Auf der Suche nach Helden unserer Zeit“ (sehr freie, moderne Interpretationen im Kunsthaus und im Historischen Museum), „Bilder zum Nibelungen-Buch im ARUN-Verlag von Linde Gerwin und Nibelungenskulpturen von Jens Nettlich“ (Nibelungen-Museum) – http://www.nibelungenkunst.de/ – und in der Sparkasse eine Bilderreise zu den Schauplätzen des Nibelungenliedes aus dem |dtv|-Buch „Wo Siegfried starb und Kriemhild liebte“.
Für die Wormser Bevölkerung gibt es eineinhalbstündige Backstage-Vorführungen hinter den Kulissen, die einen Blick auf die Masken, das Anprobieren etc. erlauben und durch das tolle Ambiente mit dem Wormser Dom sowieso sehr außergewöhnlich sind. Die Sakristei des Gotteshauses ist abends sogar plötzlich zur Garderobe umfunktioniert, in welcher hektisch die Bekleidung gewechselt wird. Die kirchlichen Vertreter sind da auch ganz ambivalent, sie erlauben wohlwollend das ganze Spektakel, sind aber auch kritisch, dass ihre christliche Kulisse jährlich zur Todesbühne wird, wo ein Schrecken und Schauer auf den anderen folgt.
Neben den Schauspieler-Talkrunden gab es auch ähnliche kleine Gespräche vor Publikum mit sonstig im Rahmenprogramm Tätigen, wie Christian Quadflieg, der ja seinen persönlichen Hebbel in einer Veranstaltung präsentierte. Ebenso mit Otto Sander, auch einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler („Die Blechtrommel“, „Das Boot“, „Der Himmel über Berlin“), der über sich und sein Leben sprach, was der SWR live im Radio übertrug.
_Ausblick_
2006 noch nicht, aber 2007 werden die Festspiele eine Woche länger gehen. Das Rahmenprogramm wird noch weiter ausgebaut und qualitativ gesteigert werden. Dieter Wedel will auch während der Festspiele eine Art „Meisterschule“ mit Workshops für Theaternachwuchs aus der Region aufmachen. Dazu wird mit den umgebenden Theatern Kontakt aufgenommen und auch das jeweilige Festspiel-Ensemble eingebunden. 2006 hat auch ein Jugendtheaterprojekt seine Premiere.
An Inszenierungen gibt es in den nächsten beiden Jahren wieder das Stück von Moritz Rinke, das in den ersten beiden Festspieljahren aufgeführt wurde. Mit diesem hatten die Wormser Festspiele 2002 begonnen und es war erstmals wieder eine ganz neue Fassung der Nibelungen. Dies wird nun aber in der Länge stark erweitert, so dass 2006 der erste Teil zur Aufführung kommt und erst 2007 der zweite Teil folgt. Regie wird dann auch wieder Dieter Wedel selbst führen. Die Besetzung des Ensembles soll zur Auflockerung allerdings eine völlig andere sein. Otto Sander ist als Hagen im Gespräch, aber Manfred Zapatka ist gigantisch und schwer ersetzbar. Bleiben werden wohl Maria Schrader als Kriemhild und Götz Schubert als Siegfried. Ein Schauspieler-Team von der Güte des jetzigen Ensembles zusammenzustellen, ist ein großes Problem. Auch soll die Besetzung viel größer sein als dieses Jahr.
Für die Zeit danach denkt man an ein Nibelungen-Musical, die „Nibelungen“ zumindest mit großer Musikbegleitung, wenn nicht sogar an eine Rock-Oper. Selbstverständlich würde für die Rolle des Siegfried dann ein bekannter Rocksänger verpflichtet. Im Ideenspektrum Wedels für das Rahmenprogramm ist auch „Das Leben des Siegfried“ – eine Collage aus Pantomime, Liedern und Szenen, ausschließlich auf Siegfried bezogen, comicstripartig. Nicht umsonst erinnert der Arbeitstitel an Monty Python`s satirischen Filmklassiker „Das Leben des Brian“. Götz Schubert schlägt im Beiprogramm ein Kammerstück vor, in dem geschildert wird, was in den sieben Ehejahren zwischen Kriemhild und Siegfried passiert – „Szenen einer Nibelungenehe“. Oder auch, welche Verbindungen zwischen Siegfried und Brunhild bestehen, schon vor ihrem Zusammentreffen, bei dem sie von den Burgundern getäuscht wird. Die Möglichkeiten für zusätzliche Geschichten in der eigentlichen Sage sind endlos. Das Hebbel-Stück als Inszenierung ist für die nächsten Jahre jedenfalls zu den Akten gelegt.
Leben lieben
Ein Kapitel aus Max Köhlers neuem unveröffentlichtem Roman „Leben lieben“.
Max Köhler wurde 1942 in Pilsen als Sohn eines deutsch-böhmischen Kaufmanns und einer südfranzösischen Kaufmannstochter geboren. Er studierte Malerei und arbeitete als Fotoreporter und Textredakteur bei Tageszeitungen. Seit 1988 lebt er als freier Maler in Schutterwald bei Straßburg.
http://www.koehler-max.de/
_Gott steh uns bei: ein Heimatmaler_
Professor Subers jüngster Bruder Fritz (auch schon vierundfünfzig Jahre alt) war Maler, genauer gesagt „Heimatmaler“. So wurde er jedenfalls in der Schlossenhausener Lokalzeitung genannt. Überflüssig zu sagen, dass der Professor ihn aus ganzem Herzen verachtete, weil er nicht die Kraft hatte, in einem bürgerlichen Beruf zu arbeiten.
Fritz war anfangs nicht sehr glücklich über den Begriff Heimatmaler, den ihm die Lokalzeitung übergestülpt hatte, fand sich aber später damit ab. Gegen Ende seines Lebens trug er ihn gar als Ehrentitel. Da der Zeitgeist alles verächtlich machte, was mit dem Begriff „Heimat“ zusammenhing, fühlte er sich verpflichtet, für die Heimat einzutreten. Er tat das nicht etwa, weil er seine Heimat liebte, ganz im Gegenteil, sie war ihm oft genug zuwider, aber er musste sich aus irgendeinem verqueren Oppositionszwang für alles einsetzen, wogegen die anderen waren, ohne zu begreifen, weshalb sie dagegen waren und er dafür. Fritz war etwas wirr im Kopf und, gelinde gesagt, sehr verträumt. Er konnte sich auf nichts konzentrieren, am allerwenigsten auf seine Bilder. Merkwürdigerweise schadete das seinen Werken nicht. Sie wirkten pointilistisch. Vermutlich war jeder Point einer seiner Konzentrationshöhepunkte.
Er war groß und hatte eine merkwürdige Art zu gehen: Sein Oberkörper blieb dabei relativ ruhig, aber krumm wie ein Fragezeichen, während er die Beine nach vorne warf, fast von sich schleuderte und sein müder verbogener Oberkörper sie ganz behutsam wieder einholte, als ob er mit seinen Beinen eine Pflicht vorgab und sein Körper keine Lust hätte, sie zu erfüllen, es dann aber doch tat, provozierend langsam wie ein renitenter Internatsschüler. Wiegend und schaukelnd eierte unser Mann vorwärts: ein arrogantes Dromedar, das seine Beine losschickte und den höckrigen Oberkörper in die kulturelle Wüste einer mittelbadischen Kleinstadt nachschleifte.
Seine ganze Körpersprache sagte: Lasst mich bloß in Ruhe, ihr seht doch, dass ich schon genug Mühe habe, mich zu bewegen, warum sollte ich also noch etwas tun, wozu ich ganz gewiss nicht in der Lage bin, denn so ungeschickt, wie ich mich bewege, erledige ich auch alles andere, verschont mich mit euren Bitten um dieses und jenes, ich schaffe es nicht.
Und tatsächlich war ihm fast alles im Leben öde Pflicht. Er konnte nicht unterscheiden zwischen Freizeit, Sport, Arbeit oder Vergnügen, ihm war alles gleich zuwider, aber er sah ein, dass er nicht den ganzen Tag im Bett liegen und lesen konnte, obwohl er dies am liebsten tat, und er sich nur von Rückenschmerzen hinlänglich aufgefordert sah, seine Liegestatt zu verlassen. Lesen im Bett war seine einzige Leidenschaft. Anfangs waren es gute Bücher gewesen, denn er hatte keinen schlechten Geschmack, was man bei diesem trägen Mann eigentlich nicht vermutetet hätte, denn auch eine so scheinbare Kleinigkeit wie ein guter Geschmack verlangt eine gewisse Anstrengung, nämlich ihn zu erwerben, aber Fritz war hier ein Naturtalent, er las von Anfang an und ohne dass ihm das einer empfohlen hätte, nur gut geschriebene Bücher. War er einmal durch Unaufmerksamkeit, Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit an ein schlechtes geraten, war er in der Regel nicht über die erste Seite hinausgekommen.
Jawohl, Weltliteratur las er, wie er sich stolz immer wieder selbst vorsagte, denn es war ja niemand da, den er darüber hätte aufklären können, weil auch das weibliche Geschlecht ihn mied wie selbstverständlich die Männer, die mit einem Geschlechtsgenossen nichts anfangen konnten, der sein halbes Leben verschlief, verlag oder verlas.
Nur gute Bücher zu lesen, hat jedoch den Nachteil, dass einem irgendwann der Stoff ausgeht, weil es nicht unendlich viel davon gibt, und so sank Fritz nach einigen Jahren Weltliteratur eine Stufe tiefer und fing an, Tageszeitungen zu lesen, weil es davon jeden Tag Nachschub gab. Er las selbstverständlich nur die besten Zeitungen, die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche“ und die „Neue Zürcher Zeitung“. Gerade die Zürcher Zeitung machte ihm viel Freude, weil die Schweizer Wörter verwendeten, die es im Deutschen nicht gab.
Fritz amüsierte sich eine Weile mit dem Spiel, die Tendenz eines objektiven Artikels zu erraten, aber eines Tages wurde ihm dies zu langweilig und er fing an, die Lokalzeitung von Schlossenhausen zu lesen. Spätestens hier hätte er sich eingestehen müssen, dass er süchtig nach Lesestoff war, denn las einer die Heimatzeitung, der bei klarem Verstand war? Einmal wurde die Lokalzeitung aus irgendeinem Grunde nicht geliefert und er machte sich mit schweren Entzugserscheinungen über die Gebrauchsanweisung seiner neuen Kaffeemaschine her. Er las sie von sieben Uhr morgens bis etwa zwei Uhr nachmittags und danach hätte er schwören können, dass er immer noch nichts verstanden hatte.
Von einer gewissen Unruhe getrieben, wachte er jede Nacht gegen zwei Uhr auf und wartete von da an auf das Lokalblatt, das gegen vier Uhr vierundzwanzig eintraf. Er las es dann langsam, damit er möglichst viel davon hatte, angefangen von der Nachricht, dass sich die dritte Riege des Turnvereins im „Grünen Baum“ traf, bis hin zu den Sprechstunden des Oberbürgermeisters am Donnerstagabend um acht. Er verglich das Gelesene von Zeit zu Zeit mit seiner Weltsicht, die er sich als Kind durch die Lektüre der „Micky-Maus“-Hefte erworben hatte, und fasste die Diskrepanz in unnachahmlichen Aphorismen zusammen, die ihm bei schlichteren Gemütern den Ruf einbrachten, „durchzublicken“, bei den Kassiererinnen in seinem Supermarkt dagegen Unwillen hervorriefen, weil er sie zu oft wiederholte, ohne sie zu aktualisieren.
Nachdem er alles gelesen hatte, was man in Entenhausen lesen konnte, und ihm der geringe Nutzen einer aus dem Chinesischen übersetzten Gebrauchsanweisung für Kaffeemaschinen klar geworden war, sah er sich nach neuen Gewohnheiten um und stieß dabei auf den Historischen Verein. Er besuchte eine Zusammenkunft des Ausschusses für Vorgeschichte. Hier dominierte ein älterer Herr, der keinen Satz grammatikalisch richtig zu Ende bringen konnte, was auf die Dauer doch ein wenig störte, weil man gezwungen war, zu erraten, was er meinte. Das brachte zwar eine gewisse Würze hinein, weil alle versuchten, zu erraten, was der Vorsitzende gesagt hatte, aber auf die Dauer war es doch ein wenig ermüdend.
So erriet der Ausschuss für Vorgeschichte eines Tages, dass der Vorsitzende meinte, steinzeitliche Opferstätten entdeckt zu haben, weil er Vertiefungen auf großen Felsblöcken im Schwarzwald gefunden hatte, die er für Blutrinnen hielt. Andere Historiker außerhalb des Ausschusses erklärten zwar, das seien Regenrinnen, aber der Ausschuss fand Blutrinnen einfach spannender und einigte sich mit seinem Vorsitzenden auf Blutschalen. Wer geopfert hatte, wurde nicht ganz klar, vielleicht die Kelten, aber wahrscheinlich waren es doch Steinzeitleute. Was sie geopfert hatten, wurde in langen Sitzungen beschlossen, man tendierte zu Tieropfern, ohne Menschenopfer ganz auszuschließen, aber Tieropfer waren deshalb besser, weil es sich möglicherweise bei den Opferpriestern um Vorfahren des Ausschusses für Vorgeschichte gehandelt hatte und keiner rituelle Mörder zu Verwandten haben wollte.
Manche Leute in Schlossenhausen fragten sich natürlich, womit Fritz seinen Lebensunterhalt verdiente. Solche Fragen waren ihm peinlich. Er wollte nicht zugeben, dass er die meiste Zeit des Tages nur im Bett lag und las und so erfand er die Mär vom Kunstmaler, der wenig malte, weil er viel nachdachte. Er wollte niemanden erzählen, dass er von einer sektenbesessenen Tante mit einem undurchsichtigen Vorleben einige hunderttausend Euro geerbt hatte und nicht die geringste Lust verspürte, etwas Vernünftiges zu arbeiten. Das hätte im sozialistischen Schlossenhausen böses Blut gemacht. Weil ihn aber die Leute immer unverschämter nach seiner Malerei fragten, krakelte er ein paar Bilder auf Leinwand und bastelte sich eine Theorie dazu, denn man musste als Maler eine Theorie haben, so etwas wie eine Sendung oder zumindest eine Botschaft, sonst wurde man bei den Verantwortlichen der städtischen Galerie nicht ernst genommen und hatte auch im Künstlerverein einen schweren Stand; ja, man bekam nicht einmal einen Ausweis als Künstler, mit dem man Pinsel zum halben Preis kaufen konnte.
Schlau wie Fritz nun einmal war – denn die Bequemen sind auch schlau, vermutlich, weil sie ständig darüber nachdenken müssen, wie man Beschäftigung vermeidet – erfand er die Theorie, dass man als Maler keine Theorie brauchte, sondern einfach nur das malen sollte, was einem auffiel und das dann möglichst so, dass man es wiedererkennen konnte.
Natürlich ging ein Aufschrei durch die lokale Malszene. Fritz wurde auf der Stelle geächtet und war fortan kein denkender Maler mehr, sondern ein geistig beschränkter Kunsthandwerker. Die Schwierigkeiten mit der städtischen Galerie nahmen zu, was ihn aber nicht weiter störte, denn so konnte er endgültig im Bett bleiben, weil sich keiner um ihn kümmerte, mögliche Kunden mit eingeschlossen.
Aus Langeweile brach er aber eines Tages dann doch eine heftige Auseinandersetzung mit der Leiterin der Galerie vom Zaun, einer promovierten Kunsthistorikerin, die auf der Höhe der Zeit war und Fritz deshalb als parasitäres Subjekt betrachtete. Nicht etwa, weil er im Bett lag und dort nichts tat, sondern weil er ein Mann war und malte. Es gab doch so viele unterdrückte Frauen, die auch malten. Und viel besser malten als Fritz, zeitgemäßer, minimalistischer oder gestischer. Fritz war nicht nur ein parasitärer Maler, sondern malte auch noch nach Ansicht seiner Kolleginnen (die meisten waren Hausfrauen oder Lehrerinnen) viel zu hausbacken und kundenfreundlich. Sein schlimmster Fehler aber war, dass er gut malte. Das war auf keinen Fall zu tolerieren. Musste man nicht als moderner Maler auf Konventionen pfeifen? Wer ließ sich heute noch in das Gefängnis einer guten Malerei einsperren? Mit dem Gegenteil mochte Fritz aber nicht dienen, und so versank er erleichtert, weil keine Nachfrage nach seinen Bildern herrschte, wieder in die Bettkissen, rechts die „Frankfurter Allgemeine“, links Musils „Drei Frauen“ und auf dem Nachttisch Sartres „Wörter“, wovon ihm besonders die ersten drei Seiten gefielen, auf denen der Philosoph seinen Verwandtschaftsgrad zu Albert Schweitzer beschrieb. Fritz Suber hatte das allerdings schon mindestens ein Dutzend mal gelesen, was die Brillanz dieser zweiundsiebzig Zeilen doch ein wenig milderte.
Die Kunsthistorikerin war vom Oberbürgermeister eingestellt worden, weil dieser von der Vision geplagt wurde, eine Stadt von der Bedeutung Schlossenhausens müsse ein Kunstleben haben, um leitende Angestellte und Fabrikanten herzulocken. Sein Plan sah so aus: Ist Kunst da, kommen auch leitende Angestellte. Fehlt Kunst, bleibt diese wichtige Oberschicht weg und die Stadt versinkt in Dumpfheit, ganz abgesehen davon, dass er dann zu wenig Gewerbesteuer einnahm und das Rathaus nicht umbauen konnte.
Nun mochten zwar die Dumpfen in der Stadt die leitenden Angestellten nicht, weil diese in der Regel aus Norddeutschland kamen, und Norddeutsche spätestens seit Luthers Sprachgewohnheiten und dem daraus resultierenden Dreißigjährigen Krieg in Süddeutschland etwa so gern gesehen waren wie Vegetarier in einer Metzgerei.
Aber der Oberbürgermeister verstand nichts von Kunst, weil sein Vater Bote bei der Ortskrankenkasse gewesen war und einen harten Kampf um seine Existenz hatte führen müssen. Deshalb hatte er seinen Sohn auch nicht an die Kunst heranführen können. Nur der Kalender der Krankenkasse hatte im Elternhaus des Oberbürgermeisters an Malerei erinnert. Deshalb wusste der Oberbürgermeister nicht, dass ein kunsthistorisches Studium zur Beurteilung von neuen Kunstentwicklungen wenig taugt, weil ein Kunsthistoriker nur rückwärts blicken kann, wie schon der Name sagt. Das löste natürlich das Dilemma nicht: denn wen sollte er sonst die lokale und internationale Kunstszene beobachten lassen? Er kam einfach nicht auf die Idee, jemanden zu beauftragen, der etwas Geschmack hatte, denn das Beamtengesetz verlangte für eine höhere Stelle ein abgeschlossenes Studium. Es war klar, dass man guten Geschmack nicht einfach studieren konnte, noch dazu, wenn die Professoren auch keinen guten Geschmack gehabt hatten. Außerdem: Wie hätte wohl der Oberbürgermeister jemanden mit gutem Geschmack erkennen können? Da er selbst keinen hatte, konnte er auch nicht sehen, wenn jemand ihn hatte. Und wieso einer Oberbürgermeister werden konnte, der keinen Geschmack und kein Urteil besaß, führte Suber zu tiefgreifenden Überlegungen, an deren Ende die entautorisierten Eliten nach dem verlorenen Kriege standen.
Fritz schien es, als ob eine sich fortpflanzende Fernwirkung des verlorenen Krieges unsere Nation zur Mittelmäßigkeit zwingen würde. Unsere neuen Eliten wollten, so sah es Fritz, nach dem Kriege um keinen Preis der Welt mehr auffallen; nach all den „Auffälligkeiten“ des von uns angezettelten und verlorenen Weltkrieges sicher kein ganz unverständlicher Wunsch. Da unsere neuen Eliten keine Philosophen gewesen seien und auch keine Zeit zum Nachdenken gehabt hätten, seien sie auf den Gedanken gekommen, einfach das Gegenteil von dem zu tun, was die Nationalsozialisten getan hätten. Das aber hätte in eine Sackgasse geführt, weil nicht alles falsch gewesen sei, was die Braunen gesagt oder getan hatten. Wenn beispielsweise ein Nationalsozialist gemeint habe, ein Reh sei braun, könne es nach dem Krieg nicht automatisch grün werden, weil wir den Krieg verloren haben.
Hans Thoma konnte nicht deswegen zum schlechten Maler werden, weil nach dem Krieg alles anders war. Wenn man Thoma verachtete, weil die Nazis ihn verehrt hatten, beging man doch, so schien es Fritz, genau denselben Fehler wie die Nazis, die seine Malerei zur Staatskunst erhoben hatten: Nach dem Krieg gehörte es zur politischen Korrektheit in Westdeutschland, über den Heimatmaler Thoma milde zu lächeln, als habe er es nicht besser gekonnt, weil er eben ein schlichter Junge aus dem Hotzenwald gewesen sei. Keinesfalls war es erlaubt, so zu malen wie er, sonst wurde man vom Kunstbetrieb geschnitten. Das sah dem Mal- und Ausstellungsverbot der Nazis ziemlich ähnlich. Eigentlich war es nur die andere Seite derselben Medaille: „Kunst wird von Staats wegen verordnet – wer anders denkt, wird ausgegrenzt“. Man musste dankbar sein, dass man nicht in ein Arbeitslager kam, wenn man wie Thoma malte. Doch eigentlich landete man ja im Arbeitslager. Da niemand die Bilder kaufte, die im Stil von Thoma gefertigt waren, weil sie politisch unkorrekt waren, musste man letztendlich arbeiten gehen und sich um eine Stelle als ungelernter Arbeiter bemühen, da man ja nichts anderes gelernt hatte als zu malen wie Thoma. Da auf den Akademien nicht gelehrt wurde, zu malen wie Thoma, hatte man es sich wie ein dissidierender Ostblockmaler selbst beibringen müssen. Wagte man sich mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit, wurde man zwar nicht verhaftet, aber gnadenlos ausgepfiffen. Man geriet sozusagen in die Sippenhaft des Ausgepfiffen- und Verachtetwerdens. In einem Konzentrationslager hätte man wenigstens Gleichgesinnte neben sich gehabt. Als Thoma-Nachfolger hingegen blieb einem in Westdeutschland nach dem Krieg nur die Einzelhaft der Einsamkeit.
Angefangen hatte dieses geistige Zwangskorsett mit der Gesinnungs-Schnüffelei der Entnazifizierungsbehörden, die einfach die Gesinnungs-Schnüffelei der Nazis kopierten, nur anders herum. Wer blond und blauäugig war, tat fortan gut daran, sich umzufärben, wer den Heimatmaler Hans Thoma liebte, hielt am besten den Mund.
Fritz hätte es übrigens gerne gesehen, wenn sich Ministerialbeamte oder Feuilletonisten wie Enzensberger um diese Fragen gekümmert hätten. Dass sie dazu beharrlich schwiegen, das Problem nicht aufgriffen, ja es anscheinend gar nicht erkannten (sonst hätten sie sich ja dazu geäußert, und man hätte davon gehört), ärgerte ihn maßlos.
Man ist erstaunt, dass sich ein so träger Mann wie Fritz überhaupt ärgern konnte. Ärgern verlangt doch auch einen gewissen Einsatz. Aber er konnte sich über vieles ärgern. Das steigerte sich, weil er ja mit niemanden reden konnte, zu regelrechten Wutanfällen. Sprach er dennoch einmal mit einer Zufallsbekanntschaft, hörte er nicht zu, sondern hing weiter seinen Gedanken nach. So konnte es passieren, dass er mitten in einem harmlosen Gespräch plötzlich einen Wutanfall bekam, der seine Gesprächspartner erschreckte, weil sie nicht begriffen, wie er zustande gekommen war, jedenfalls nur schwer auf die gegenwärtige Situation bezogen werden konnte.
Man könnte nun auch vollkommen berechtigterweise fragen, was Fritz die Eliten nach dem Kriege angingen, er war ja weder Ministerialbeamter noch Dichter. Aber wir müssen einfach feststellen, dass er sich diese Gedanken machte. Er hatte die Angewohnheit, sich um Dinge zu kümmern, die ihn nichts angingen und andererseits Themen zu vernachlässigen, die eindeutig seine Sache waren, wie etwa die, höflich zu sein und sich um seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Das war ja gerade der Ärger, den er in Schlossenhausen verursachte. Er fühlte sich für Dinge zuständig, für die er nicht zuständig war.
Den Oberbürgermeister und den Kulturamtsleiter von Schlossenhausen fesselte zu der Zeit, als die Frage auftauchte, was eigentlich Kunst in Schlossenhausen sei, noch ein anderes Problem, nämlich die Frage, woher sie selbst kamen. Der Oberbürgermeister wollte seinen Vater vergessen machen, weswegen er immer viel zu elegante Kleidung trug, die er für vornehm hielt, aber natürlich gerade damit auf seine bescheidene Herkunft aufmerksam machte, und der andere prahlte ständig mit seinen Ahnen, weil er wusste, dass ihm etwas fehlte, er wusste nur nicht, was es war, aber er ahnte, dass es mit seiner Herkunft zusammenhing. Jedem zufälligen Gesprächspartner erläuterte er, dass er von Luthers Schwiegervater abstamme, was ihm zwar niemand so recht glauben wollte, aber bei Aufsteigern einen großen Eindruck hinterließ, weil es sich so schwer nachprüfen ließ. Wie um alles in der Welt prüfte man nach, ob man von Luthers Schwiegervater abstammte? Kein Wunder, dass Genealogen und Wappenmacher in Schlossenhausen unerwartet Aufträge bekamen, die sie selbstverständlich zur Zufriedenheit der Auftraggeber ausführten.
Irgendwie muss der Kulturamtsleiter aber doch Angst vor ernsthaften Recherchen bekommen haben, denn nach einigen Jahren wandelte er die Geschichte von seiner Herkunft etwas ab. Sie hörte sich dann so an: Meine Vorfahren waren ausnahmslos Pfarrer. Pause. Selbstverständlich nur bis zur Reformation. Hahahaha. Diesen Sketch führte er ungefähr dreimal am Tag auf und hielt sich dabei für zurückhaltend, weil er auf die ständige Erwähnung seines Onkels verzichtete, der Bischof gewesen war und angeblich Hitler dreimal energisch widersprochen hatte.
Die Leiterin der Städtischen Galerie lobte auf Wunsch des Oberbürgermeisters einen Kunstwettbewerb aus, bei dem sie von vorneherein wusste, wer ihn gewinnen würde, nämlich Gerda Breuer, die Freundin der Frau des Oberbürgermeisters, jene schüchtern-zurückhaltende Malerin, die so breiig ausufernd malte und dabei alle Konventionen, die vor 1945 gegolten hatten, missachtete. Um auch sicherzustellen, dass Gerda den Wettbewerb gewann, stellte Kocher-Meier eine Jury zusammen, die aus dem ehemaligen Professor und einer Studienkollegin von Gerda bestand, ganz abgesehen davon, dass der Oberbürgermeister selbstverständlich auch für Breuer war, weil er ein paar Bilder von ihr erworben hatte. Er hatte sie nicht etwa gekauft, weil seine Frau die Freundin von Gerda war, nein, so weit ging sein Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Frau nicht, begabte Persönlichkeiten an sich zu binden, sondern weil sein Freund, der Textilunternehmer Reser, es ihm geraten hatte.
Reser verstand zwar auch nichts von Bildern, aber er hatte als Unternehmer Glück gehabt und wollte dieses Glück nun irgendwie „weitergeben“, wie er sich ständig im „Schlossenhausener Tageblatt“ ausdrückte, und dabei von wechselnden, aber immer wohlmeinenden Reportern mit den entsprechenden Fragen versorgt wurde („Sie tun ja unheimlich viel für die Kunst. Weshalb tun Sie das? Das müssten Sie doch eigentlich als erfolgreicher Unternehmer gar nicht“). Gleichzeitig wollte Reser natürlich beweisen, dass er ein vornehmer Mensch war, was sich aus seiner Tätigkeit nicht ohne Weiteres ergab, denn er sammelte in großem Stil alte Lumpen ein und ließ sie in riesigen Werken zu neuen Textilien verarbeiten. Eigentlich hätte das den Grünen in der Stadt gefallen müssen, aber ein Grüner ist auch ein Querdenker, deshalb monierten sie, dass Reser bei diesem Recycling Chemikalien verwandte. Vermutlich hätte er sich abends in eine Spinnstube setzen müssen, um aus seinen alten Lumpen neue Fäden zu ziehen. Es war schwer in Schlossenhausen, den Grünen zu gefallen. Manche versuchten es deshalb erst gar nicht. Irgendwie hatte man bei den Grünen immer das Gefühl, dass sie etwas anderes meinten, als sie beklagten. Etwa so, wie man zum Friseur geht, wenn man Krach mit seinem Vorgesetzten hat.
Reser war entzückt von Gerda. War sie nicht im besten Alter und wunderhübsch? Und so scheu! Und sie malte! Gegen die Konventionen, wie es nach dem Krieg der Brauch war! Hatte er nicht zufällig eine Menge Bilder von ihr? War sie nicht die Kunstlehrerin seiner Kinder? Gab sie ihnen nicht wunderbare Noten? Konnte sie nicht einen Kunstpreis vertragen? Würde das nicht ihren Marktwert steigern? Hatte man als erfolgreicher Unternehmer nicht die Macht und die Freude, einen Preis zu vergeben? Wozu war man schließlich mit dem Oberbürgermeister befreundet und Präsident der Industriekammer? Was ergab das alles für einen Sinn, wenn man nicht Freude daraus zog, oder, wie es Reser ausdrückte, seine geschenkte Freude an andere weitergab?
Außerdem war Gerda in derselben Partei wie der Oberbürgermeister. Da es sich um eine sozialistische Partei handelte, war ein Kampfbund gegen die konservative Reaktion unvermeidlich. Man würde es den bürgerlichen Privilegierten schon zeigen, darin waren sich alle einig, die schlecht erzogene Eltern gehabt hatten. Hatte der Vater des Oberbürgermeisters nicht auch unter den Großkapitalisten oder zumindest unter deren bösen Strukturen gelitten? Hatten diese Kapitalisten ihn nicht unterdrückt und auf Botengänge geschickt, so dass er nie die Möglichkeit hatte, Leiter der AOK-Nebenstelle Rammersweier zu werden? Obwohl er weiß Gott das Zeug dazu hatte?
Aber er, der Oberbürgermeister, hatte sich mit eisernem Fleiß aus seiner Misere des Kunstunverständnisses und schlechten Benehmens herausgearbeitet. Eiserner Fleiß, das war das Zauberwort, mit dem er es diesen Typen wie Fritz Suber, dem Maler, schon zeigen würde. Was tat Suber eigentlich den lieben langen Tag außer spinnen? Wovon lebte er? Er hatte ihm noch keine Bilder abgekauft. Tat das überhaupt jemand? Verdammter Schnösel! Tat nichts, hatte nichts, aber riss das Maul auf! Er selbst hatte sich alles erarbeitet, zwar nicht mit seinen eigenen beiden Händen, aber mit seinen eigenen beiden Gehirnhälften! Und der? Tat nichts und legte sich mit einer promovierten, fleißigen und anstelligen Kunsthistorikerin an, die er, der Oberbürgermeister, eingestellt hatte! War das nicht so etwas ähnliches wie Beleidigung? Beleidigung eines Oberbürgermeisters? Er vertrat schließlich nicht nur sich selbst, sondern auch die Bevölkerung, den Souverän.
Irgendwie musste man diesem Kerl beikommen. Man könnte einfach die Zeit für sich arbeiten lassen. Irgendwann würde ihm schon die Puste ausgehen. Und wenn er Geld hatte, konnte das ja auch nicht ewig reichen. Irgendwann ging auch das größte Vermögen zu Ende. Oh, genähtes Elend! Warum hatte sein Vater kein Vermögen zusammengerafft, dann hätte er es nicht jetzt tun müssen. Obwohl ihm als Oberbürgermeister die Hände gebunden waren. Vielleicht könnte Reser? Vielleicht könnte man …
Mit der gespielten Munterkeit, wie sie Leute zuweilen an sich haben, die ihren Beruf hassen, rief Oberbürgermeister Vetter in die Telefonmuschel: „Doris, Schätzchen, könntest du mir Hans geben?“ Er legte den Hörer auf und lehnte sich zurück. Reser war der Richtige: Mit ihm könnte er so eine Sache durchziehen.
„Hans, du alter Drecksack, was machst du heute Abend?“
„Keine Ahnung“, sagte Reser, „vermutlich muss ich zuhause bleiben, weil ich die letzten drei Tage Termine hatte.“
„Komm doch mit deiner Frau zu uns.“
„Kann ich machen, warte mal, ich schau nur eben in den Terminkalender.“
„Brauchst gar nicht zu schauen“, frotzelte der Bürgermeister, „du hast schon einen Termin bei mir.“
„Stehen nur die Lions drin.“
„Die kannst du schwänzen. Da müsste ich auch hin.“
„Okay.“
„So um acht.“
„Gut.“
„Bis dann.“
Vetter legte auf. Seine Sekretärin stürzte herein. „Sie müssen heute Abend zur Bürgervereinigung Nord-West!“
„Nee“, sagte der Oberbürgermeister.
„Sie haben es fest versprochen“, jammerte Doris, „und ich auch, mindestens dreimal hat Kindler angerufen, ob es auch klappt“.
„Kann nix dafür.“
Vetter hob in gespieltem Bedauern die sorgfältig manikürten Finger, spreizte sie geziert und fuhr sich mit ihnen betont theatralisch durchs gefärbte Haar, wobei er den Kopf affektiert zurückwarf. Er fand es ab und zu lustig, den Neurotiker zu geben, aber Doris war heute nicht nach Lachen zumute; sie hatte diese Szene auch schon zu oft gesehen, um beeindruckt zu sein. Sie gehörte zu seinem Standartrepertoire. Außerdem fand sie, dass sich Neurotiker anders benehmen, nämlich so, wie sich der Oberbürgermeister benahm, wenn er normal war.
„Reser kommt. Er hat nur heute Zeit.“ Vetter fragte sich, wie viel sie mitgehört hatte. Nur den Anfang oder alles? Eigentlich war es ihm egal. Politik ist Politik. Das musste sie langsam wissen, dass hier Notlügen benötigt wurden.
Doris hatte das ganze Gespräch mitgehört. Sie wusste schon seit langem, dass der Oberbürgermeister log. Es machte ihr nichts mehr aus. Am Anfang hatte es sie gestört, wenn er sie mit seinem jungenhaften Lächeln anschwindelte. Heute nahm sie das mit dem selben Gleichmut hin, wie sie das Wetter hinnahm. Sie wollte auch nicht ewig seine Sekretärin bleiben. Sie hatte eine schöne Stimme, die vielleicht eine Kleinigkeit zu dünn geraten war, und sie wollte mehr Zeit mit Singen verbringen, vielleicht sogar Berufssängerin werden. Sie hatte schon eine CD aufgenommen und tingelte an Wochenenden mit lokalen Kapellen über die Dörfer. Das machte ihr viel Freude. Eigentlich lebte sie nur dafür. Der Oberbürgermeister mit seinen Terminen konnte ihr gestohlen bleiben. Irgendwie spürte er das auch. Er hatte deshalb schon seine Fühler nach Ersatz ausgestreckt, damit Doris ihn nicht mit ihrer Kündigung überraschen konnte. Denn „The Games must go on“, wie er ständig witzelte.
Doris sammelte ein paar Notizen auf dem Schreibtisch ein, überhörte die beleidigende Bemerkung Vetters („Was macht das Gezirpe, Inge?“) und ging in das Vorzimmer. Aus diesen dürren Notizen musste sie formvollendete und höfliche Briefe machen. Vetter überließ ihr viel, sogar die Formulierungen. Doris rief den Vorsitzenden der Bürgergemeinschaft Nord-West an.
„Es tut mir leid, Herr Kindler, aber der OB kann heute leider nicht kommen. Das Ministerium hat angerufen. Er muss nach Stuttgart.“
„Er hat es doch so fest versprochen“, jammerte Kindler. „Viele werden nur wegen ihm kommen. Was soll ich denen sagen?“
„Sagen Sie die Wahrheit“, grinste Doris.
Kindler schwor sich, am Abend beim OB vorbeizufahren und in seine Garage zu schauen, ob der grüne Mercedes drinnen geparkt war. Aber gleich darauf wusste er, dass er es nicht tun würde. Aber einmal würde er den Bürgermeister beim Lügen erwischen und es weitererzählen, darauf konnte sich dieser Gockel verlassen. Kindler ahnte nicht, dass die meisten in Schlossenhausen schon wussten, dass der Oberbürgermeister log. Meistens waren es nur höfliche Notlügen gewesen, aber in letzter Zeit dehnte der OB diese Notlügen ein bisschen arg weit aus. Kindler dachte an seinen Onkel, den Friseur, der dem Bürgermeister die Haare färbte. Ein Mann, der sich die Haare färbt, ist irgendwo auch ein Gauner, brummelte Kindler in sein fliehendes Kinn und machte sich auf den Weg in den Festsaal, wo er seinen Mitgliedern erklären würde, dass der Oberbürgermeister ein Arschloch sei und deshalb nicht kommen könne. An ihm blieb immer alles hängen.
|Das verwendete Bild stammt von Max Köhler.|©
Farmer, Nancy – Skorpionenhaus, Das
Eine düstere Version der Zukunft skizziert Nancy Farmer in ihrem Roman „Das Skorpionenhaus“. Fortschreitende biotechnologische Entwicklung, Klonen, Organhandel, ausbeutende Gesellschaftsstrukturen, Umweltverschmutzung und ungerechte politische Machtstrukturen thematisiert Farmer in ihrer Geschichte und legt damit den Finger in die Wunden unserer Zeit. „Das Skorpionenhaus“ wirft für ein Jugendbuch überraschend viele Fragen und Gedanken auf, ist vielschichtig und komplex und obendrein spannend. Kein Wunder, dass ein solches Werk nicht unbemerkt bleibt. In den USA konnte Nancy Farmer den |National Book Award| einstreichen, hierzulande gab’s noch den renommierten deutschen Jugendbuchpreis „Buxtehuder Bulle“ obendrauf.
„Das Skorpionenhaus“ erzählt die Geschichte von Matt Alacrán. Matt ist kein gewöhnliches Kind. Matt ist ein Klon des Drogenbarons und Diktators Matteo Alacrán, auch El Patrón genannt. El Patrón hat an der Grenze zwischen Atzlan (heute wohl eher unter dem Namen Mexiko geläufig) und den USA ein eigenes Imperium aufgebaut. Im Volksmund heißt sein Land Opium und der Name ist Programm. El Patrón beliefert von seinen Ländereien aus die ganze Welt mit Opium und hat damit ein Vermögen verdient. Als Patriarch ist El Patrón gefürchtet und an Macht hat er nichts eingebüßt, auch wenn er mittlerweile über 140 Jahre alt ist.
In diesem Land wächst Matt auf und hat als Klon ein schweres Leben. Niemand respektiert ihn; wo er hinkommt, löst er bestenfalls Missfallen, schlimmstenfalls gar Ekel aus. Viele zählen ihn eher zum Vieh, als dass sie einen Mensch in ihm sähen. Nur einer hält zu ihm: El Patrón, der den Jungen hütet wie seinen Augapfel. Kontakt hält er außerdem zu der kleinen María, die ihn zwar auch nicht unbedingt als Menschen ansieht, ihn aber wenigstens zu respektieren scheint.
Je älter Matt wird, desto mehr hinterfragt er seine Existenz. Hat er eine Seele? Kommt er in den Himmel, wenn er stirbt? Als El Patróns Gesundheitszustand sich verschlechtert, findet Matt heraus, was der Sinn seines Lebens ist und er hat nur eine Chance: Flucht. Doch die Grenzen werden von der brutalen Farmpatrouille bestens bewacht. Hat Matt eine Chance?
Die Thematik, die Nancy Farmer in ihrem Roman anschneidet, birgt einige Brisanz. Farmer wirft eine Haufen ethischer Fragen auf. Das Klonen ist ein Aspekt davon, aber längst noch nicht das Ende vom Lied. Die Bewirtschaftung von El Patróns Farm erfolgt recht altmodisch, in Handarbeit. Doch es sind keine Menschen, die diese Arbeiten übernehmen, sondern „Migits“. Die „Migits“ sind willenlos gemachte Menschen, denen ein Computerchip eingepflanzt wurde. Ihre Fähigkeiten sind eng begrenzt, aber sie führen jeden Befehl aus und empfinden weder Hunger noch Müdigkeit. „Migits“ werden als ebenso verabscheuungswürdig angesehen wie Klone, und Matt wird oft auf eine Stufe mit ihnen gestellt.
So hat Matt sichtbare Schwierigkeiten, seine eigene Existenz zu definieren. Er ist den Menschen bis ins Detail ähnlich, soll aber dennoch nicht mehr als ein „Migit“ sein. María sieht ihn in etwa auf einer Stufe mit ihrem Schoßhund Fellball und auch dieser Vergleich kann für Matt nur neue Fragen aufwerfen. Während beispielsweise Charlotte Kerner, die sich in „Blueprint“ ebenfalls auf Ebene eines Jungendbuches mit dem Thema Klonen befasst, eher die Probleme der persönlichen Abgrenzung zwischen dem Klon und seinem älteren Ebenbild in den Mittelpunkt rückt, geht es bei Nancy Farmer eher darum, wie der Klon sich gegenüber den normalen Menschen definiert. Für Matt stellt sich das Problem der Abgrenzung seiner eigenen Persönlichkeit zu El Patrón gar nicht erst.
Während bei „Blueprint“ das Klonen eher aus narzisstischen Motiven vollzogen wurde, sind die Gründe bei Nancy Farmer wesentlich pragmatischer. Es geht um das Bereithalten von Ersatzteilen im Falle einer gesundheitlichen Reparaturbedürftigkeit, und bis Matt dies erfasst hat, scheint es schon fast keine Rettung mehr für ihn zu geben. Sein verzweifelter Versuch, seinem vorbestimmten Schicksal zu entrinnen, macht den wichtigsten Teil der Spannung des Romans aus.
Doch Klonen, Gentechnik, Organhandel sowie deren moralische Fragwürdigkeit sind nicht die einzigen Punkte, in denen „Das Skorpionenhaus“ nachdenklich stimmt. Die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen sind genauso wie die politischen Machtverhältnisse in vielen Punkten fragwürdig. Ausbeutung von Arbeitskräften, Flüchtlinge, die zu Sklaven werden, und Kinderarbeit sind in Nancy Farmers Welt an der Tagesordnung. Auch die Umwelt ist arg in Mitleidenschaft gezogen. Flüsse sind verseucht, ganze Meeresbuchten ausgetrocknet, Chemieabfälle sorgen für Probleme – in gewisser Hinsicht ist Farmers Szenario ein Produkt, das aus dem Hier und Jetzt resultiert und damit indirekt die Probleme unserer Zeit anprangert.
Das mutet allesamt sehr düster an. Eine Zukunft, in der das Negative überwiegt, wird zu einem beklemmenden Szenario ausgestaltet. Doch Farmers Zukunftsvision ist nicht durchweg pessimistisch. Inmitten all der fragwürdigen und schlechten Gegebenheiten ist auch immer wieder Platz für Wärme, Hoffnung und zwischenmenschliche Begegnungen. Auch Matt wird geliebt – besonders von Celia, die ihn aufgezogen hat, aber ebenso von Tam-Lin, der Matt von El Patrón als Leibwächter zur Seite gestellt wird (selbstverständlich aus rein egoistischen Gründen) und von María.
Matt verliert geliebte Menschen und schließt Freundschaften. Und schließlich erfährt er, was es heißt, Verantwortung übernehmen zu müssen. In Matts Brust schlagen zwei Herzen – das eine, das El Patrón folgen möchte und nur an den eigenen Vorteil denkt, und das andere, das zu lieben fähig ist, das ehrlich und fair ist. Matt ist somit auch als Figur durchaus vielschichtig skizziert. Und damit steht er nicht allein. Auch die meisten anderen Figuren in Farmers Welt von morgen wirken facettenreich und glaubwürdig. Sie sind nicht plump schwarz/weiß gezeichnet. Gut und Böse werden nicht ganz klar umrissen, Klischees nicht plump breitgetreten. „Das Skorpionenhaus“ ist damit ein Roman, der nicht nur aufgrund des beklemmenden, düsteren Szenarios in Erinnerung bleibt, sondern auch dank der recht vielschichtig angelegten Figuren.
Nun könnte leicht der Eindruck entstehen, „Das Skorpionenhaus“ käme mit der berühmten, gefürchteten moralischen Keule daher, doch das täuscht. Farmer belehrt den Leser nicht mit erhobenem Zeigefinger. Sie prangert nicht laut an und sucht keine Schuldigen. Sie skizziert einfach eine düstere Utopie, formuliert eine Weltsicht aus Matts Perspektive, teilt dem Leser seine Gedanken mit und lässt diesen selbst die offensichtlichen Schlüsse daraus ziehen.
Und das macht sie auf durchaus spannende Art und Weise. Über die Welt hinter den Grenzen von Opium streut sie immer nur Andeutungen aus. Sie macht den Leser stets neugierig und krönt das Ganze mit einem Sahnehäubchen sich kontinuierlich steigernder Spannung. Ein wenig zu einfach mag es gegen Ende hin erscheinen, wie manche unüberwindbar scheinenden Probleme im Handlungsverlauf gelöst werden, aber dennoch liest sich „Das Skorpionenhaus“ gerade zum Ende hin absolut fesselnd.
Sprachlich ist das Buch leicht verständlich geschrieben. Einfacher, klarer Satzbau, der stets kurz und prägnant bleibt, so dass der Roman einerseits tatsächlich Jugendbuchniveau hat, andererseits aber dennoch auch Erwachsenen Freude bereiten dürfte. Der Verlag empfiehlt das Buch für Kinder ab 12 Jahren, aber das bedarf sicherlich einer weiteren Differenzierung. Der Roman wirft so viele ethische und moralische Fragen auf und ist teilweise so düster angelegt, dass sicherlich nicht jedes Kind dieser Altergruppe ohne zusätzliche Unterstützung gleich gut damit umgehen kann. In jedem Fall ist es ein Buch, über das sich anschließend zu reden lohnt.
Alles in allem weiß Nancy Farmer mit „Das Skorpionenhaus“ zu gefallen. Sie hat ein vielschichtiges und nachdenklich stimmendes Buch vorgelegt, das ein düsteres Zukunftsszenario zeichnet, in dem trotz all der negativen Entwicklungen noch Platz für positive Werte wie Freundschaft und Menschenwürde ist. So schafft Farmer es nicht nur zu unterhalten, sondern auch noch eine Botschaft zu übermitteln. Das Resultat ist ein spannender Roman mit interessanten und größtenteils sehr glaubwürdigen Figuren, der noch eine ganze Weile im Gedächtnis haften bleibt.
Conte, Domenico – Oswald Spengler. Eine Einführung
Ein kleines Rätsel zum Einstieg: Wann und von wem wurden folgende Sätze geschrieben?
„Die Diktatur der Parteihäupter stützt sich auf die Diktatur der Presse. Man sucht durch das Geld Leserscharen und ganze Völker der feindlichen Hörigkeit zu entreißen und unter die eigne Gedankenzucht zu bringen. Hier erfahren sie nur noch, was sie |sollen|, und ein höherer Wille gestaltet das Bild ihrer Welt. Man braucht nicht mehr, wie die Fürsten des Barock, die Untertanen zum Waffendienst zu verpflichten. Man peitscht ihre Geister auf, … bis sie Waffen |fordern| und ihre Führer zu einem Kampf zwingen, zu dem diese gezwungen sein |wollten|.“
Ein politischer Beobachter des Irak-Kriegs 2003?
„Auf dieser Stufe beginnt das … Stadium einer entsetzlichen Entvölkerung. … [Die Bevölkerung] wird von der Spitze herab abgebaut, zuerst die Weltstädte, dann die Provinzstädte, endlich das Land […] Und trotzdem schwindet die Bevölkerung rasch und in Masse dahin, trotz der verzweifelten Ehe- und Kindergesetzgebung“
Ein Soziologe zur neuesten demographischen Studie der Bundesregierung?
Nein, diese Worte schrieb Oswald Spengler (1880-1936) in seinem 1918/22 erschienenen Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“. In diesem tausendseitigen Werk stellt er die Theorie auf, dass in einer normal regellosen Geschichte manchmal die Menschen eines bestimmten Großraums unter dem Eindruck der Landschaft plötzlich von einem einheitlichen Weltbild und Weltgefühl erfasst werden. Dann entsteht eine Hochkultur, in der dadurch alle kulturellen Äußerungen (Politik, Religion, Wissenschaft, Kunst) einen inneren Zusammenhang haben und die nun wie ein Organismus bestimmte schicksalhafte Stadien (Wachstum, Blüte, Reife, Alterung, Tod) durchläuft.
Der italienische Spengler-Experte Domenico Conte hat eine Einführung in das Denken dieses Kulturphilosophen vorgelegt. Nach einer kurzen Darlegung der Selbsteinschätzung Spenglers und biographischen Angaben aus der Zeit _Vor dem „Untergang“_ führt das erste große Kapitel in die Grundgedanken des Hauptwerks ein: Conte stellt zunächst kurz die Kapitel beider Bände von _“Untergang des Abendlandes“_ vor, um dann der Reihe nach die wichtigsten Grundgedanken dieses Buches wie den Zusammenhang von Kultur und Zivilisation oder den Gegensatz von Natur und Geschichte darzulegen. Die Reihenfolge, in der die Hauptgedanken behandelt werden, erscheint zunächst etwas regellos. Aber bald entdeckt man in Conte einen profunden Spengler-Kenner. Seine Ausführungen, insbesondere zur Seele als kulturstiftender Kraft oder zu Spenglers Ursymbolen, sind kurz und treffend, die angeführten Zitate sehr gut ausgewählt. Vielleicht hätte man hier noch etwas zur Bedeutung der Landschaft, ihrer Topographie und Vegetation, bei der Entstehung einer Hochkultur sagen können. Immer wieder kehrt Conte zu Spenglers Auffassung von Kulturen als Organismen zurück und widerlegt damit unsinnige, aber seit Jahrzehnten unausrottbare Fehlurteile, etwa die Vorwürfe des Pessimismus oder Defätismus gegen Spengler.
Es verwundert zunächst, dass zwischen der Einführung in Spenglers kulturgeschichtliches und derjenigen in sein politisches Denken das Kapitel über _Vordenker und geistige Väter_ eingefügt ist, dies wird bald aber klar durch die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse. Der erste Band von „Untergang des Abendlandes“ war auf der Stelle ein Verkaufsschlager und wurde bald Gegenstand der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion, die sich auch um die geistigen Vorläufer Spenglers drehte. Conte befasst sich zunächst natürlich mit Goethe und Nietzsche, auf die Oswald Spengler selber ausdrücklich verwiesen hatte. Hier zeigt der Autor knapp aber deutlich die Einflüsse der beiden großen Denker auf. Dann nennt er weitere Köpfe und Traditionen, von denen Spengler profitierte, von Hegel über verschiedene geschichtsmorphologische Konzepte aus dem 19. Jahrhundert bis zur Kunstgeschichte, deren Denkweise auf Spengler auch über den Bereich von Kunst und Kultur weit hinausreichte. Erstaunlich ist aber, dass der Althistoriker Eduard Meyer, der mit seiner neuen Interpretation der Antike sehr stark auf Spengler wirkte und vermutlich die am häufigsten zitierte Quelle im „Untergang“ sein dürfte, hier nicht erwähnt wird.
Danach wird also _Der politische Autor_ Oswald Spengler dargestellt. Natürlich stehen hier der Aufsatz „Preußentum und Sozialismus“ (1919) und sein Vermächtnis „Jahre der Entscheidung“ (1933) im Mittelpunkt. Es spricht wieder sehr für den Autor, dass er den schillernden und oft missverstandenen Spenglerschen Begriff |Sozialismus| auf Gedanken aus dem „Untergang“ zurückführt und damit aus tagespolitisch begründeten Missverständnissen zieht. Aus „Jahre der Entscheidung“, „das einzige unverkennbar regimekritische Werk“ (Frank Lisson) jener Zeit, werden einige Hauptgedanken referiert. Insgesamt bleibt dieses Kapitel aber eher schwach. Die politischen Thesen Spenglers werden sehr oft in eine enge Verbindung zu damaligen politischen Auseinandersetzungen gebracht. Dass Spenglers politisches Schreiben eher wirkungslos blieb, verleitet Conte gelegentlich zu einem ironischen Unterton. Dabei kommt der Bezug zu Spenglers Erkenntnissen aus dem „Untergang“ zu kurz. Für Spengler war Geschichtsmorphologie, d.h. die Lehre von der (typischen) Gestalt historischer Epochen, nie eine theoretische Spielerei im Elfenbeinturm, sondern sie sollte immer auch praktisch zu einer besseren Lageeinschätzung und damit Politikformulierung genutzt werden.
Seit Mitte der 20er Jahre widmete sich Spengler verstärkt Studien zu grundlegenden kulturphilosophischen Fragen. Seine Aufzeichnungen dazu wurden erst nach seinem Tode geordnet und schließlich in den 60er Jahren veröffentlicht. _Die postum erschienenen Werke_ behandelt das letzte Kapitel. Die „Frühzeit der Weltgeschichte“ ist wieder ein geschichtsmorphologisches Buch, das sich mit einer primitiveren Kulturstufe als den Hochkulturen aus dem „Untergang“ befasst. Auf diesem Gebiet ist Conte offenbar zu Hause. Wieder referiert er sicher und sehr dicht die Hauptthesen. Durch Querverweise auf verwandte Gedanken in kleinen Schriften und Redemanuskripten macht er die Bedeutung dieser neueren Erkenntnisse für Spengler deutlich. Sehr interessant sind auch die Ausführungen, inwieweit Thesen aus dem „Untergang des Abendlandes“ bestätigt, ergänzt oder zurückgenommen werden. Die „Urfragen“, eine „Metaphysik des Lebens“, entwickelt aufgrund der Gegenüberstellung von Pflanze und Tier eine Anthropologie, welche eine Grundlage für die übrigen geschichtsphilosophischen Thesen wird. Auch hier haben wir wieder eine klare, prägnante und verständliche Arbeit von Conte.
Nach einer mehrseitigen Zeittafel zu Leben und Werk folgt noch ein Anhang über _Die Geschichte der Spengler-Rezeption_. Hier wird chronologisch die Auseinandersetzung mit Spengler vorgestellt, von den ersten heftigen Kontroversen ab Erscheinen des ersten Bandes des „Untergangs“ bis zu neueren wissenschaftlichen Publikationen. Kurz wird die Aufnahme seiner Gedanken in unterschiedlichen Ländern und Fachbereichen geschildert. Arnold Toynbee, der mit „A Study of History“ ein ähnliches Werk schrieb, wird leider nur knapp angerissen. Überraschenderweise unterschlägt der Italiener Conte seinen Landsmann Julius Evola vollständig.
_Fazit_
Domenico Contes kurzer Band bietet eine knappe, kenntnisreiche Einführung in Spenglers Denken, mit den erwähnten Einschränkungen bei den politischen Schriften. Einem Spengler-Neuling kann das Buch unbedingt empfohlen werden. Aber auch dem etwas fortgeschritteneren Leser bietet es noch wertvolle Hinweise. Oswald Spengler erfährt in den letzten Jahren wieder ein stärkeres Interesse, besonders seitdem immer wieder ein Einfluss Spenglers auf aktuelle amerikanische politische Bücher (S. Huntington: „Kampf der Kulturen“, Z. Brzezinski: „Die einzige Weltmacht“) vermutet wird, die ihrerseits die gegenwärtige Politik der USA beeinflusst haben sollen. Insofern ist die Übersetzung von Contes Buch auch für den politisch Interessierten keinen Moment zu früh erschienen.
Hyung, Min-Woo – Priest – Band 4
[Band 1 1704
[Band 2 1705
[Band 3 1707
Im vierten Band der „Priest“-Reihe gräbt Autor und Zeichner Min-Woo Hyung tief in der Vergangenheit des Hauptdarstellers Ivan Isaacs und schildert die Geschichte des jungen Priesters aus dessen eigener Sicht, ganz so, wie er sie in seinem Tagebuch auch selbst dargestellt hat. Dieses Tagebuch hat er einst auf der Jagd nach Temozarela geschrieben, und durch seine Aufzeichnungen wird auch deutlich, wie sich der Hass auf den gefallenen Erzengel entwickelt hat und warum Ivan all seine Hoffnungen und Träume dafür hat aufgeben müssen.
Der junge Priester Vater Simon zweifelt noch immer an den Thesen seiner Glaubensbrüder und an der Wahrheit um das ‚heilige Gefängnis‘ namens Heshion. Doch andererseits kann er sich kaum vorstellen, dass die dort lebenden Kollegen den Großteil ihres Lebens damit verbracht haben, einer nicht vorhandenen Wahrheit herzujagen, und so liest er mit großem Interesse das Tagebuch des jungen Ivan Isaacs. Dort erfährt er von einem adoptierten Jungen, der von seiner Schwester nie als Stiefbruder akzeptiert wurde, eigentlich aber ausschließlich aus dem Grunde, um eben jener das Leben nach dem Tod ihrer Mutter einfacher zu machen, in die Familie Isaacs aufgenommen wurde. Doch Ivan beweist Standfestigkeit, und nach dem Tod seines Stiefvaters ist er Gena, so der Name seiner Halbschwester, schon sehr nahe gekommen, auch wenn sich dies beide nicht eingestehen wollen. Erst als er nach einem neunjährigen Priesterseminar in seine Heimat und somit auch zu Gena zurückkehrt, wird er sich seiner Gefühle bewusst, und auch Gena fühlt sich zu ihm hingezogen.
Doch dann taucht der seltsame Priester Raul Piestro auf und bittet Ivan um Mithilfe bei der Aufdeckung einiger vertuschter, religiöser Geheimnisse. Hin- und hergerissen zwischen seiner Berufung auf der einen und Gena auf der anderen Seite, kämpft Ivan mit heftigen Gewissensbissen, entschließt sich letztlich aber doch dazu, Raul Piestro zu folgen. Es dauert nicht lange, bis er genau diesen Beschluss bereut, denn danach ist nichts mehr so, wie es einmal war …
Band numero vier ist für meinen Geschmack bisher der beste und vor allem spannendste Teil dieser Reihe, weil sich hier schon einige Kreise schließen und man doch langsam hinter das mysteriöse Geheimnis hinter dieser Geschichte steigt bzw. eine Vorstellung davon bekommt, worum es in „Priest“ neben der ganzen Action auch geht. Hyung zeichnet unter anderem sein Bild von der Kirche, was aber im weiteren Verlauf dieser Serie noch krasser werden wird. Hier geht es zunächst mal darum, den Teufel als das Böse und als eine Bestie darzustellen, dabei aber auch zu beleuchten, dass die Kirche in vielerlei Hinsicht ein scheinheiliges Spiel betreibt, wobei Hyung hier auch Parallelen zu den oftmals hervorgehobenen Kreuzzügen zieht, und deren Ereignisse schließlich auch mit in die Geschichte einbezieht.
In erster Linie geht es in Band 4 aber darum, wie Ivan Isaacs innerlich von Selbstzweifeln geplagt wird, die sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben ziehen. Zunächst die Entscheidung, Priester zu werden, anschließend seine Liebe zu Gena mit dem Entschluss, sein Priesterdasein mit einer höheren Priorität auszustatten, und dann schließlich die gedankliche Begegnung mit dem Teufel und der Bestie Belial, zu der Ivan sich nach einigen Aufrufen hingezogen fühlt und an die er später auch seine Seele verkauft (was jedoch hier noch nicht beschrieben wird).
Durch ständig wechselnde Szenarien in den Zeichnungen hat Hyung die Gefühlswelt Isaacs‘ wirklich sehr authentisch und lebhaft illustriert. Dazu fällt auf, dass die Zeichnungen entgegen aller vorher geäußerter Kritik zwar weiterhin eckig, aber weitaus schärfer als zuvor ausgefallen sind. Auf diesem Gebiet ist eine eindeutige Verbesserung zu erkennen. Doch auch die Story gewinnt immer mehr an Farbe, wobei der Autor noch weiter abschweift und sich immer mehr Möglichkeiten für die weiteren Fortsetzungen aufbaut. Zudem ist das Thema an sich wirklich genial und mit alle seinen Nebensträngen prima aufgearbeitet worden.
Ich gebe zu, bei den ersten beiden Bänden hatte ich noch so meine Bedenken, wohin die Reise von „Priest“ gehen würde, doch jetzt bin ich davon überzeugt, eine der besten aktuellen Manga-Reihen mitzuverfolgen.
Jodi Picoult – Beim Leben meiner Schwester

Ich will leben
Anna Fitzgerald ist nur 13 Jahre alt, als sie ihrer krebskranken Schwester Kate eine Niere spenden soll. Dies ist der Moment, in dem Anna beschließt, sich einen Anwalt zu nehmen, um ihren Eltern die Entscheidungsgewalt in medizinischen Fragen wegnehmen zu lassen. In den Gelben Seiten findet sie den erfolgreichen Anwalt Campbell Alexander, der ihren Fall übernehmen soll. Der jedoch zeigt sich zunächst skeptisch und lässt sich nur durch die ihn erwartende Publicity zu diesem Pro-bono-Fall hinreißen. Annas Eltern Sara und Brian sind überrascht, als sie eine Vorladung vom Gericht bekommen. Sara, die früher als Anwältin gearbeitet hat, beschließt spontan, ihren Fall selbst zu vertreten.
Doch geht es nicht nur um Annas Leben, sondern auch um das ihrer älteren Schwester Kate. Im Alter von zwei Jahren wurde bei Kate eine spezielle Form der Leukämie festgestellt. Da ihr Bruder Jesse als Spender nicht in Frage kam, beschlossen Sara und Brian damals, noch ein Kind zu zeugen und zwar eines, das in allen Punkten als Spenderin für Sara passen würde. Schon das Nabelschnurblut wird für Kate gespendet, in den Jahren danach schließen sich Lymphozyten-, Granulozyten- und sogar eine Knochenmarksspende an. Einen Großteil ihrer Kindheit hat somit auch Anna im Krankenhaus verbracht, geholfen hat es ihrer Schwester immer nur zeitweise. Als schließlich Kates Nieren versagen, könnte nur Anna ein Organ spenden, da ansonsten das Risiko für Kate zu groß wäre. Die Zeit drängt, denn Kate geht es immer schlechter.
Die Verfahrenspflegerin Julia wird vom Gericht bestellt, um sich ein Bild von Anna und ihrer Familie zu machen. In vielen Gesprächen lernt sie Annas Motive und die ihrer Eltern kennen. Doch auch Julia ist ratlos angesichts der sich ihr dargestellten Situation. Gleichzeitig kämpft sie mit privaten Problemen, denn zu ihrer Highschoolzeit hatte sie einst eine kurze Affäre mit Campbell Alexander, damals allerdings hatte er sie sitzen gelassen. Nun flammt die alte Liebe erneut auf.
An allen Fronten erleben wir persönliche Dramen mit, denn in der Familie Fitzgerald liegt einiges im Argen …
Perspektivenwechsel
„Beim Leben meiner Schwester“ ist aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Zunächst lernen wir Anna kennen, die uns ihre Entscheidung mitteilt, dass sie keine Niere für ihre Schwester spenden möchte, da sie bereits oft genug im Krankenhaus gewesen ist. Anna schaltet daraufhin Campbell Alexander als ihren Anwalt ein. Auch aus der Sicht des erfolgreichen Staranwalts erfahren wir einen Teil der Geschichte, er gibt offen zu, dass er Annas Fall zunächst als reine Werbung für sich selbst ansieht und daher den Fall pro bono übernimmt. An Alexanders Seite begleitet ihn stets sein Servicehund Judge, obwohl der Anwalt doch gar nicht blind ist. Welche Funktion Judge in seinem Leben einnimmt, erleben wir hautnah mit, als Anna gerade vor Gericht ihre Aussage macht. Auch die Verfahrenspflegerin Julia erzählt ihren Teil der Geschichte, sie berichtet von den Verletzungen, die Campbell Alexander ihr zugefügt hat, als er sie damals zu Schulzeiten fallen gelassen hat, wir lernen ihre Schwester kennen und begleiten Julia auf ihren Besuchen bei Anna und ihrer Familie.
Aus Saras Perspektive wird die Familiengeschichte von Kates Krankheit erzählt. Dieser Teil der Geschichte setzt ein, als Kate zwei Jahre alt ist und Sara zum ersten Mal merkwürdige blaue Flecken bei ihr entdeckt, woraufhin nach etlichen Tests schließlich Leukämie diagnostiziert wird. Sara berichtet von ihrer Entscheidung, ein passendes Kind zu bekommen, das als Spenderin für Sara fungieren kann, und sie ertappt sich dabei, wie sie dieses ungeborene Kind gar nicht als eigenständige Persönlichkeit wahrnimmt, sondern nur als geeignete Spenderin: „Obwohl ich im neunten Monat bin, obwohl ich reichlich Zeit zum Träumen hatte, habe ich mir über dieses Kind noch keine besonderen Gedanken gemacht. Wenn ich an diese Tochter denke, dann nur daran, was sie für die Tochter tun kann, die ich bereits habe.“ Später erfahren wir aus Saras Sicht, wie Kates Krankheit sich weiterentwickelt, wie Kate schließlich bei der Chemotherapie einen anderen Patienten kennen lernt, in den sie sich verliebt. Wir werden Teil von Kates Krankengeschichte und erfahren insbesondere Saras Gründe für die vielen Behandlungen und auch für Annas Spenden.
Brian dagegen begleiten wir häufig zu seinen Einsätzen. Der Familienvater arbeitet als Feuerwehrmann und rettet andere Leben, wo ihm dies bei seiner eigenen Tochter so schwer fällt. Die Feuerwehr hat mit einem Brandstifter zu kämpfen, der verlassene Hütten anzündet und zunächst nicht gefasst werden kann. Doch aus Jesses Perspektive werden wir recht schnell Zeuge der Brandstiftungen, denn Jesse hat seine eigenen Probleme zu verarbeiten. Während seine Schwestern ständig im Mittelpunkt des Familiengeschehens stehen – die eine wegen ihrer schweren Krankheit und die andere wegen ihrer Spenden – bleibt er außen vor und rebelliert gegen die Nichtbeachtung durch seine Eltern. Sein Zimmer verfügt über einen separaten Eingang, sodass Jesse unbemerkt kommen und gehen kann.
Zunächst ist dieser ständige Perspektivenwechsel sehr gewöhnungsbedürftig, da man sich zu Beginn jedes Kapitels neu einfinden muss, doch später empfand ich dies als gelungenes Stilmittel, da uns die handelnden Personen dadurch sehr nahe gebracht werden. Wir erleben die Probleme und Sorgen jedes Einzelnen hautnah mit und lernen auch die Gründe für ihr Handeln kennen. So paradox es auch erscheinen mag, so verstehen wir dadurch sowohl Annas Weigerung zu einer Organspende als auch Saras Gründe für die Nierentransplantation. Jodi Picoult schafft es überzeugend, uns jede Perspektive deutlich zu machen, wir begleiten jeden Protagonisten immer wieder auf Schritt und Tritt und fühlen auch mit jedem mit. Das Handeln jeder Person wird verständlich, auch wenn besonders Annas und Saras Wünsche miteinander kollidieren.
Nach und nach wird offenkundig, welche Probleme die Familie Fitzgerald mit sich auszumachen hat. Die Interessen ihrer beiden Töchter stehen praktisch im Gegensatz zueinander. Um die kranke Tochter gesund zu machen, muss die gesunde Tochter immer wieder ins Krankenhaus und sogar eine schwere Knochenmarkstransplantation über sich ergehen lassen, die Anna nicht gut verträgt. Die Familie ist kurz vor dem Auseinanderbrechen, was auch den Eltern auffällt, die sich plötzlich nichts mehr zu sagen haben. Zusammengehalten werden die fünf eigentlich nur durch die zu überstehenden Krisen und durch Kates Krankheit, die nur bekämpft werden kann, wenn alle füreinander da sind. Doch speziell Jesses und Annas Interessen bleiben dabei häufig auf der Strecke. So darf Anna nicht auf das Eishockeyseminar fahren, auf das sie sich so gefreut hatte, weil sie in der Zeit eventuell für weitere Spenden gebraucht werden könnte.
„Bis dahin ist ausgeschlossen, dass sie nach Minnesota fährt. Nicht weil ich Angst habe, Anna könnte dort etwas passieren, sondern weil ich Angst habe, Kate könnte etwas passieren, wenn ihre Schwester nicht da ist. […] Und dann brauchen wir Anna – ihr Blut, ihre Stammzellen, ihr Gewebe – und zwar hier.“
Unlösbar
Jodi Picoult hat einen sehr persönlichen Roman vorgelegt, der uns die Personen wunderbar näher bringt und der es schafft, mit jedem mitfühlen zu lassen. Inhaltlich hat sie sich ein Thema herausgesucht, das ethisch schwierig zu beurteilen ist und gerade moralisch unlösbar erscheint. Wir können Annas Standpunkt sehr gut nachvollziehen, dass sie ihre Niere nicht spenden möchte, da dies einen schweren Eingriff in ihre eigene Gesundheit darstellen würde und sie danach ihr geliebtes Eishockeyspiel aufgeben müsste. Anna möchte mit ihren 13 Jahren endlich die Chance auf ein einigermaßen normales Leben haben und die Chance darauf, erwachsen zu werden (obwohl sie uns in den meisten Situationen doch schon sehr erwachsen vorkommt). Doch verbunden ist dies unweigerlich mit Kates Tod. Wie soll man hierzu eine Lösung finden? Jodi Picoult hat sich ein Ende ausgedacht, das dem Leser das Nach- und Weiterdenken ermöglicht. Sie präsentiert uns nicht ihre eigene Lösung, sondern schafft es sehr geschickt, diese Schwierigkeit zu umschiffen. Vielleicht trägt Picoult am Ende ein wenig dick auf, doch vielleicht war dies auch die einzig mögliche Auflösung in diesem Buch?!
„Beim Leben meiner Schwester“ regt zum eigenen Nachdenken an. Wie würde man selbst in dieser Situation reagieren? Ist es überhaupt gerechtfertigt, sich ein Wunschkind wie Anna erschaffen zu lassen, welches von Anfang an die Aufgabe des Spenders zu übernehmen hat? Aber ist es nicht auch völlig normal, dass Eltern alles Menschenmögliche versuchen wollen, um ihr krankes Kind zu retten? All dies sind Fragen, auf die es keine richtige und keine falsche Antwort gibt, daher fällt es uns schwer, das Buch aus der Hand zu legen und abzuschalten. Wenn wir das Buch am Ende zuklappen, rollt uns vielleicht sogar die eine oder andere Träne über die Wange, denn wir müssen loslassen von uns lieb gewonnenen Figuren. Durch die so persönlichen Schilderungen im Laufe der Geschichte haben wir uns besonders mit Anna richtig angefreundet, eine so „persönliche Beziehung“ habe ich nur selten zu Romanfiguren aufgebaut – und das, obwohl die reine Handlung des Buches nur eine gute Woche umfasst.
Etwas Besonderes
„Beim Leben meiner Schwester“ drückt auf die Tränendrüse, vielleicht ist es daher eher ein Buch für Frauen, ganz bestimmt ist es jedoch ein Buch, das Einfühlungsvermögen benötigt und die Bereitschaft, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Jodi Picoult hat ein Buch vorgelegt, das mich tief bewegt und mitgerissen hat. Der Roman ist flüssig geschrieben und schnell durchgelesen, dennoch ertappt man sich immer wieder dabei, dass man über die geschilderte Situation nachdenkt. Ein wenig störend empfand ich die beginnende Liebesgeschichte zwischen Campbell und Julia, ein reiner Familienroman wäre auch passend gewesen, insgesamt fügt sich aber sogar diese Liebelei ganz gut in das Gesamtgeschehen ein, da wir dadurch auch den Staranwalt aus einer ganz anderen Perspektive kennen lernen dürfen.
Das vorliegende Buch ist ein ganz persönliches Erlebnis, das ich jedem, der sich für dieses Thema und die damit verbundenen Fragen interessiert, nur wärmstens ans Herz legen kann.
Taschenbuch: 480 Seiten
Originaltitel: My Sister’s Keeper
ISBN-13: 978-3492247962
www.piper.de
Der Autor vergibt: 




Köster-Lösche, Kari – Donars Rache (Sachsen-Trilogie, Band 2)
Nachdem ich vom ersten Teil [„Das Blutgericht“ 1719 herb enttäuscht war, fiel es mir ungleich schwerer, mich noch weiter für die „Sachsen-Saga“ von Kari Köster-Lösche zu begeistern, weshalb ich die Geschichte erst einmal eine Woche lang beiseite legte, um neue Motivation zu sammeln. Unerwarteterweise kam eben jene bei der Lektüre von Band 2, „Donars Rache“, zurück, denn Köster-Lösche hat in gewisser Weise noch einmal die Kurve bekommen und es doch noch geschafft, dem Buch spannende Ansätze zu verleihen. Zum Glück …
_Story:_
Gunhild ist wieder in der Realität angekommen und berichtet ihrem Freund Günter von ihren Erlebnissen, doch der will ihr natürlich erst einmal nichts glauben und weist sie barsch ab, weil sie so lange fort gewesen ist. In diesem Moment merkt Gunhild, dass ihre Bestimmung darin besteht, ihren Geliebten Gerowulf wiederzufinden, und deshalb kehrt sie erneut in die ferne Vergangenheit zurück, um ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Doch bei ihrer Rückkehr gerät sie mitten in einen Glaubenskrieg zwischen Sachsen und Franken hinein. Letztere wollen ihre Kontrahenten mit aller Macht zum christlichen Glauben bekehren, was ihnen durch eine Zwangsbekehrung auch gelingt. Gerowulf, der Fürst der Sachsen, ist machtlos gegen die Macht der Gegner, und seine Männer, die auch nicht mehr an die Abwendung des Unheils glauben, zerstreuen sich in alle Winde.
Für Gunhild ist der Anblick all dessen zu viel. Sie kann das Leid der Franken nicht ertragen und beschließt daher, auf eigene Faust gegen das Verbrechen vorzugehen. Dazu nutzt sie ihre medizinischen Kenntnisse, um beim gemeinen Volk Ansehen zu erlangen. Dies nutzt sie dazu, gleichgesinnte Frauen um sich zu scharen und sie zum Widerstand gegen die christliche Eroberung anzustacheln. Gerowulfs Krieger bekommen Wind von der neuen Bewegung und schließen sich wieder ihrem alten Führer an. Mit gemeinsamer und geballter Kraft nimmt der Aufstand der Franken seinen Lauf …
_Bewertung:_
Eines vorweg: Auch in „Donars Rache“ ist Kari Köster-Lösche weit davon entfernt, stilistische Glanzpunkte zu setzen, denn nach wie vor ist ihre Art zu Schreiben recht hölzern und abgehackt. Und auch so manche Begebenheiten wie die Rückkehr von Gunhild sowie der seltsame Zwist zwischen ihr und ihrem ehemaligen Lebensgefährten Günter sind einem recht suspekt, weil sie das Buch nicht wirklich bereichern.
Dafür ist Köster-Lösche jedoch die Darstellung der Ereignisse in Sachsen viel besser gelungen, und tatsächlich entwickelt sich im Laufe der Story, speziell ab dem Moment, in dem Gunhild ihren Einfluss erkennt und geltend macht, ein guter Spannungsbogen, der bis zur letzten Seite anhält, auch wenn so manches Folgeereignis schon vorab zu erahnen war. Doch im Vergleich zu „Das Blutgericht“ werden hier nicht einfach nur gewisse Punkte lieblos aneinandergereiht, sondern die Geschehnisse gehen nahezu fließend ineinander über und können sich entfalten, ohne dass man befürchten müsste, dass ein bestimmter Handlungsabschnitt plötzlich beendet wird, weil schon der nächste sich anbahnt.
Natürlich ist „Donars Rache“ alleine deshalb noch kein literarischer Quantensprung, aber immerhin ein großer Schritt in die richtige Richtung, der wieder Laune und Lust auf mehr macht und das Lesen dieser Saga nicht zur Qual werden lässt. Meine großen Befürchtungen wurden also glücklicherweise nicht bestätigt, und ich bin doch wieder gespannt, ob Köster-Lösche die Serie zufrieden stellend zu Ende bringt und ich es anschließend nicht bereuen muss, meine Lesestunden für diese drei Bände ergebnislos geopfert zu haben. Im Falle von „Donars Rache“ habe ich dies jedenfalls nicht.
Haining, Peter (Hg.) – Visionen des Grauens
Peter Haining: Einleitung (Introduction) – Der Herausgeber reflektiert über den literarischen Wahnsinn als Thema dieser Sammlung und stellt die Autoren kurz vor.
Robert Bloch: (Lizzie Borden Took an Axe, 1946) – Guter, alter Wahnsinn trifft auf dämonische Besessenheit; das Ergebnis sind allemal schädelgespaltene Leichen …
Patricia Highsmith: Der Schneckenforscher (The Snail-Watcher, 1964) – Der langsamen Schnecke einzige Verteidigung ist die Vermehrung – und Sex kann eine tödliche Waffe sein, wie der allzu sorglose Hobbyforscher erfahren muss …
Harry Harrison: Die wahre Geschichte Frankensteins (At Last, the True Story of Frankenstein, 1965) – Der Sohn des großen Monsterbastlers verteidigt vor einem Reporter den Ruf des genialen Vaters und besorgt bei dieser Gelegenheit Ersatzteile für dessen beste Schöpfung …
W. C. Morrow: The Monster Maker (The Surgeon’s Experiment, 1928) – Der verrückte Wissenschaftler beschert einem Selbstmörder ein bizarres Nachleben, das dieser weder erwartet hatte noch begrüßt …
Edgar Allan Poe: Das ovale Portrait (The Oval Portrait, 1842) – Der große Maler saugt seinem schönen Modell das Leben förmlich aus, bis er es endgültig auf die Leinwand gebannt hat …
Fredric Brown: Der Napoleon-Komplex (Come and Go Mad, 1949) – Ist Wahnsinn eine Krankheit oder bedeutet er einen Riss in der gnädigen Geistesbarriere, die uns Menschen vor dem nicht zu verkraftenden Einblick in das wahre kosmische Geschehen bewahrt?
Nathaniel Hawthorne: Dr. Heideggers Experiment (Dr. Heidegger’s Experiment/The Fountain of Youth, 1837) – Wieder jung zu sein, ist der Herzenswunsch vieler Senioren; sind sie es dann, beweisen sie umgehend, dass sie die Erfahrung rein gar nichts gelehrt hat …
Henry Slesar: Wessen Krankheit? (Whosit’s Disease, 1962) – Der Arzt, der sie entdeckt und beschreibt, darf einer neuen Krankheit ihren Namen geben. Das findet der Patient empörend und verlangt seinen Anteil an solchem Ruhm – eine Reaktion, deren mögliche Folgen er besser hätte durchdenken müssen …
Harold Lawlor: (Mayaya’s Little Green Men, 1946) – Tropische Heinzelmännchen unterstützen ein Kindermädchen bei der Arbeit. Die kleinen Wichte tragen Waffen und können im Notfall sehr gut damit umgehen …
Neun Storys, in denen das Grauen nicht Ketten rasselnd um Mitternacht daherkommt, sondern sich vorwiegend im Kopf der Figuren abspielt. Mögliche Fehlfunktionen des Menschenhirns werden hier zu Auslösern dramatischer und tragischer Ereignisse. Ganz „normale“ Irre treten ebenso auf wie der immer beliebte „mad scientist“. Die Lust des Lesers am Horror mischt sich mit mehr Unbehagen als sonst, weil dieser Grusel der Realität nicht völlig enthoben ist. Wahnsinn flößt Furcht ein, da der Geisteskranke als solcher nicht zwangsläufig sofort erkannt wird und verdachtfrei sein Unwesen treiben kann. Noch immer erschrecken diejenigen Ungeheuer am besten, die ganz unscheinbar und unverdächtig wirken. Die Autoren dieser Kollektion verstehen es dies zu vermitteln.
Wenn es um literarischen Wahnsinn mit Realitätsspaltung geht, ist Robert Bloch (1917-1994) nie weit. Seit er Weltruhm mit seinem (von Alfred Hitchcock verfilmten) Roman „Psycho“ erlangte, waren mörderische Mehrfachpersönlichkeiten sein Markenzeiten, das er, ein schneller, ökonomisch arbeitender Unterhaltungsschriftsteller, in vielen Variationen immer wieder pflegte. Blochs „Interpretation“ des tatsächlichen Lizzie-Borden-Mehrfachmords von 1892 (http://ccbit.cs.umass.edu/lizzie ist eine schöne Website für diejenigen, welche es interessiert) ist nicht gerade eine seiner besten Arbeiten, aber der Schlussgag sitzt blochtypisch wieder einmal im Ziel.
Patricia Highsmithes (1921-1995) Schneckenforscher ist ein „sanfter“ Irrer, ein von öder Ehe und langweiliger Arbeit geistig und seelisch verkümmerter Mann. Als er einen Weg findet, den Teufelskreis, zu dem sein Leben geworden ist, zu durchbrechen, verliert er es, weil er sich und sein „Werk“ nicht unter Kontrolle halten kann – ein unfreiwilliger Frankenstein, der nie wirklich begreift, was er da tut. (Anekdotisch aber interessant ist die Tatsache, dass Highsmith selbst eine passionierte Schneckenforscherin war und diese Weichtiere in ihrem abgeschiedenen Haus bei Ascona hielt und studierte.)
Harry Harrison (geb. 1925) erzählt irgendwie passend dazu die „richtige“ Geschichte vom „echten““Frankenstein. Er verschafft uns einen witzigen Einblick in die alltäglichen Schwierigkeiten, denen sich ein wahrlich genialer, aber etwas zu unkonventioneller Wissenschaftler ausgesetzt sieht, und schließt mit einem grimmigen Schlussgag, der einmal mehr beweist, dass zu viel Neugier der Katze Tod sein kann. In dieselbe humoristische Kerbe schlägt Henry Slesar (1927-2002) mit einer seiner berühmten Storys, die ein frivoles oder eigentlich geschmackloses Thema kurz und elegant auf den Punkt bringen.
Normalerweise ist Fredric Brown (1906-1972) der Witzbold vom Dienst, er schrieb aber auch ernst gemeinte und dann sehr ideenreiche Geschichten mit verblüffender Auflösung. „Der Napoleon-Komplex“ fällt in diese Kategorie und bewegt sich hart an der Grenze zur Science-Fiction. Das Universum als Spielball quasi göttlicher Kräfte ist so menschenfeindlich, wie es Brown hier entwirft, tatsächlich wohl nur im Wahn zu ertragen.
Nathaniel Hawthorne (1804-1864) und Edgar Allan Poe (1809-1849) gehören zu den „Urvätern“ der Phantastik. Die Kurzgeschichte als literarische Form haben sie mit aus der Taufe gehoben. Mehr als anderthalb Jahrhunderte ist dies her, so dass man den Autoren ihre altmodische Schwerfälligkeit nicht vorwerfen darf. Dies trifft besonders auf Hawthorne zu, der seiner Epoche wesentlich stärker verhaftet war als der geradezu „modern“ erscheinende Poe. „Dr. Heideggers Experiment“ enthält denn auch mehr als ein Quäntchen moralische Belehrung: Das Alter ist nur Last für den, der sein Leben vergeudet hat; wieder jung zu sein, bedeutet deshalb höchstens die Gelegenheit zu bekommen, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Indes fasst Hawthorne dies mit trockenem Humor in Worte und schließt mit einem unerwarteten Schlussgag, der die Moral von der Geschicht’ umgehend in Frage stellt.
Poe ist hier mit einer seiner weniger bekannten und – seien wir ehrlich – ganz sicher nicht mit einer seiner besseren Kurzgeschichten vertreten. Er schrieb für wenig Geld für Zeitschriften (hier „Graham’s Lady’s and Gentleman’s Magazine“) und oft mit dem Drucker um die Wette. Dennoch ist „Das ovale Portrait“ eine beeindruckende Studie über (künstlerische) Besessenheit und ihre bösen Folgen.
William Chambers Morrow (1853-1923) und Harold Lawlor (1910-1992) sind zwei Autoren aus der „Pulp“-Ära der Unterhaltungsliteratur. Sie schrieben für die grellbunt aufgemachten Magazine der Jahre vor und kurz nach dem II. Weltkrieg. In diesem Umfeld gediehen durchaus Klassiker, aber Morror und Lawlor gehören zum „literarischen Fußvolk“, das vor allem Seiten mit actionbetonten, vordergründig spannenden Storys füllte. Morrow „bedient“ sich dabei mehr als deutlich bei M. W. Shelleys „Frankenstein“ und bringt die hochphilosophische Vorlage auf reinen Grusel herunter. Lawlors Geschichte liest sich wesentlich moderner, kann aber ebenfalls nie wirklich überraschen.
„Visionen des Grauens“ gehört zu den Büchern, die mit der Originalausgabe nur mehr marginal identisch sind. 160 Seiten hatte ein „Vampir“-Taschenbuch der frühen 1970er Jahre aufzuweisen – nicht weniger, nicht mehr. „Beyond the Curtain of Dark“ umfasst die doppelte Seitenzahl. Also blieben Storys für die Übersetzung unberücksichtigt, bis es „passte“ – ein völlig normaler Vorgang in dieser Zeit. Man durfte als Leser noch froh sein, dass dieses Schicksal eine Kurzgeschichtensammlung traf – Romane wurden nämlich durchaus und manchmal ebenso rigoros wie sinnentstellend gekürzt. Was „Beyond the Curtain …“ betrifft, so geht allerdings der rote Faden verloren, an den Herausgeber Haining die einzelnen Storys in ihrer absichtsvollen Abfolge geknüpft hatte. Der verbleibende Torso ist dennoch eine Kollektion, welche die Lektüre lohnt.
Stolze, Greg – Riten des Drachen (Vampire: Requiem)
|Ich sah mein verzerrtes Gesicht im Spiegel des Abts und wusste, was für ein Höllenwolf ich geworden war.
– Vlad Dracula|
(Auszug aus dem Quellenband)
„Riten des Drachen“ ist ein Quellenband von [„Vampire: Requiem“, 1701 der zum Verständnis des ominösen Ordo Dracul beitragen soll. Der Ordo Dracul ist wohl einer der geheimnisvollsten Bünde in der Welt der Dunkelheit. Seine Anhänger verehren Vlad Tepes, wohl besser bekannt als Vlad Dracul oder einfach nur Dracula, als ihren Gründer. Das Besondere an ihm ist, dass er (angeblich) nicht durch den Kuss zum Vampir wurde, sondern durch die Strafe und den Zorn Gottes. Also sehen seine Anhänger den Vampirismus als einen Fluch, der überwunden werden kann.
Nichts währt ewig, nicht einmal der Vampirismus. Daher wollen sie anhand von Riten und der Ansammlung von Wissen die Transzendenz erreichen. Dafür sind nicht nur ein großes Maß an Wissen, sondern auch Disziplin und die Meisterung der Mysterien der Drachen notwendig. Die Mysterien der Drachen sind eine Art Disziplin, die nur den Ordensangehörigen offen steht und deren Erleuchtung und Wissen über das Vampirsein darstellt.
In „Riten des Drachen“ wird die Geschichte des Gründers geschildert, allerdings ist es in der Ich-Perspektive verfasst, also als Draculas Tagebuch. Natürlich hat sich der Autor kleine Freiheiten bei der Gestaltung des Lebenslaufs und des geschichtlichen Kontextes genommen, um der Geschichte interessante Aspekte zuzufügen. Dies ist, da darauf hingewiesen wird, aber nicht weiter schlimm, da die Handlung ja auch in der [„Welt der Dunkelheit“ 1607 spielt.
So wird über seinen letzen Feldzug, seinen Tod mit anschließendem Disput mit Gott sowie die anschließende Wiederauferstehung berichtet. Auch seine Versuche, sein Reich wieder in Besitz zu nehmen, bis hin zu seinem Streben nach Transzendenz samt Aufenthalten bei der Lancea Sancta und dem Zirkel der Mutter (Vampirische Bünde) werden unterhaltsam beschrieben. Besonders interessant ist die Episode, bei der eine Gruppe von selbsternannten Vampirjägern auf die Burg Dracul kommt.
Relativ kurz wird allerdings leider Vlads Besuch in Paris abgetan; schade, hier hätte sich eine Möglichkeit geboten, etwas mehr Volumen in das relativ dünne Buch (ca. 120 Seiten) zu bekommen. Im letzten Kapitel werden anhand seiner ersten Kinder, Mara und Lisette, sowie an seiner Enkelin (im vampirischen Sinne) Anoushka die Strukturen des Ordo Dracul beschrieben. Zudem wird noch tiefgründiger auf seine wirkliche Philosophie eingegangen.
Fast schon sensationell muss ich die Gestaltung von „Riten des Drachen“ nennen. Im DIN-A5-Format gehalten, ist das gesamte Buch mit Samt (!) verkleidet. Auch die silberne Schrift auf diesem Einband trägt ihren Teil zum sehr edlen Eindruck bei. Dazu kommen auf den 120 Seiten über 50 teilweise sehr schöne Zeichnungen und Grafiken. Dass dabei das Leseerlebnis bei so wenigen Seiten und so vielen Bildern ein bisschen kurz kommt, ist verständlich, aber trotzdem schade.
Man muss sich allerdings wirklich fragen, ob der stolze Preis angebracht ist. Doch ich denke, dass diese fürstliche Aufmachung trotz des kurzen Lesevergnügens ihr Geld wert ist. Besonders für Spieler, die einen Angehörigen des Ordo Dracul darstellen wollen, empfiehlt sich die Anschaffung natürlich, da die Darstellung bei „Vampire: Requiem“ etwas kryptisch ausgefallen ist und sich das Verständnis der Philosophie des Ordens nach der Lektüre wirklich deutlich verbessert. So muss ich abschließend sagen, dass sich die Anschaffung lohnt, auch unter dem Gesichtspunkt, dass samtbezogene Bücher einfach herrlich dekadent sind!
Tome / Janry – Spirou & Fantasio: Abenteuer in Moskau (Band 40)
Lucky Luke und Asterix sind Klassiker der frankobelgischen Comickultur und hierzulande allseits bekannt. Aber wie sieht es mit ihren Kollegen Spirou und Fantasio aus? Wer die zwei Weltenbummler noch nicht kennen lernen konnte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Denn seit einigen Jahren legt der |Carlsen|-Verlag die Abenteuer der zwei Freunde neu auf. Jüngst erschien Band 40 der Reihe: „Abenteuer in Moskau“.
Eigentlich wollten Spirou und Fantasio Reportagen über Kokospalmen machen. Stattdessen sitzen sie auf der Rückbank einer muffigen Limousine, auf dem Vordersitz die beiden KGB-Agenten Wapatrowitsch und Schmonzejew. Letzterer dreht sich lässig um, blickt die beiden Abenteurer aus Frankreich trübe an und verdeutlicht ihnen mit wenigen Worten ihre Situation: „Jetzt ihrr arrbeitet fürr KGB!“
Nachdem der Page mit der roten Kappe und der rasende Reporter am Flughafen entführt und in ein Flugzeug nach Moskau verfrachtet wurden, nimmt die Geschichte schnell ihren Lauf. Spirou und Fantasio sind beim KGB für ihr Können bekannt und sollen dem russischen Geheimdienst dabei helfen, den Mafia-Boss Tanaziof aus dem Verkehr zu ziehen. Für die groben Methoden, mit denen die beiden Abenteurer nach Russland geholt wurden, entschuldigt man sich mit knappen Worten.
Obwohl Spirou und Fantasio lieber in den Süden möchten, anstatt sich in Moskau bei Minus 35 Grad die Ohren abzufrieren, interessiert sie die Angelegenheit. Spätestens als ein Attentäter auf sie schießt, die Limousine ins Schleudern gerät und auf der zugefrorenen Moskwa aufschlägt, nehmen sich die beiden Abenteurer des Falles an. Bald stellt sich heraus, dass der ominöse Prinz Tanaziof in Wirklichkeit Fantasios Vetter Zantafio ist. Dieser Erzrivale sollte regelmäßigen Spirou-und-Fantasio-Lesern ein Begriff sein, denn nicht nur einmal machte er den beiden Titelhelden in der Vergangenheit das Leben schwer (s. Bände 2, 5, 6, 14, 21). Nun gilt es, Zantafios Umtriebe wieder einmal zu stoppen und ihn und seinen Kumpanen Nikita Nikolajew aufzuhalten. Die beiden Bösewichter haben nicht weniger im Sinn, als ein nationales Desaster herbeizuführen. Sie wollen ein Relikt der russischen Revolutions-Ära stehlen, den Leichnam von Wladimir Iljitsch Uljanow, besser bekannt als Lenin.
Zur Vorbereitung der „Abenteuer in Moskau“ waren die beiden Autoren Tome und Janry selbst einige Wochen in der russischen Metropole unterwegs, um sich ein realistisches Bild von der Stadt zu machen. Die Handlung jagt die beiden Titelhelden kreuz und quer durch Moskaus Straßen und entpuppt sich bald als eine Art gezeichnete Action-Sight-Seeing-Tour. Der Rote Platz, das Moskauer Schwimmbad, das Lenin-Mausoleum, der Winterpalast des Zaren und das Bolschoi-Theater dürfen da nicht fehlen. Gewürzt ist die Geschichte mit Ausschnitten russischer Lebensart: Neben Wodka, Zobelmützen und Babuschkas begegnet der Leser Russischem Roulette, Eisbaden und dem heißblütigen männlichen Begrüßungskuss.
Wer Tim und Struppi, Lucky Luke und Asterix kennt, wird sich beim Durchblättern eines Spirou-und-Fantasio-Abenteuers an den Zeichenstil dieser Serien erinnert fühlen. Obwohl Spirou und Fantasio alles andere als ein Geheimtipp sind, stehen die frankobelgischen Comic-Helden hierzulande in Sachen Popularität weit hinter ihren Kollegen zurück. Spirou und Fantasio sind Galeonsfiguren der Comic-Stilrichtung école Marcinelle, benannt nach dem Sitz des Verlages Dupuis, der die Geschichten der beiden Weltenbummler seit ihrer Erfindung in den 1930er und 1940er Jahren herausbringt. Kräftige Farben und viel Liebe zum Detail zeichnen auch dieses Spirou-und-Fantasio-Abenteuer aus dem Jahr 1990 aus, dessen Helden sich in den letzten fünfzig Jahren kaum verändert haben. Geordnete Zeilen à drei, vier oder fünf Panels prägen den Gesamteindruck des Bandes. Interessant sind die Soundwords, die sich der russischen Schreibweise angepasst haben und ein umgekehrtes N und ein umgekehrtes R verwenden.
„Abenteuer in Moskau“ ist ein weiterer charmanter Band der Spirou-und-Fantasio-Reihe, die seit einigen Jahren vom |Carlsen|-Verlag als Neuauflage herausgegeben wird. Die bunte Mischung aus Abenteuer und Sight-Seeing wird verfeinert durch einen bissigen Unterton. Im Gegensatz zu diesem Plus an Realitätsnähe und guter Recherche steht ein Minus an Humor und Slapstick, die in diesem Band für meinen Geschmack etwas zu kurz kommen. Toll hingegen: Die Seite mit editorischen Anmerkungen am Ende des Bandes. Hier erfährt man Hintergründiges über die Autoren, das Werk und seine Entstehung.
Preston, Douglas / Child, Lincoln – Burn Case – Geruch des Teufels
Der Teufel geht um in der Millionenstadt New York. So deuten jedenfalls fundamentalreligiöse Bunkerköpfe sowie die Medien verdächtige Spuren (Schwefel, Hufabdrücke), die auf und um die Leiche des berühmten aber verhassten, weil höchst gemeinen Kunstkritikers Jeremy Grove gefunden werden, als der eines schönen Tages ganz von selbst in Flammen aufgeht. Er bleibt nicht der einzige einflussreiche Fiesling, der auf diese spektakuläre Weise endet. Groß ist die Aufregung, denn die Opfer sind keine Durchschnittsbürger oder gar Unterschichtproleten, sondern mächtig und reich.
Mysteriöse Ereignisse der beschriebenen Art locken zuverlässig den unkonventionellen FBI-Agenten Aloysius Pendergast an den Ort des Geschehens. Er hat in seiner Laufbahn schon manchen Spuk erlebt, der sich bei näherer Betrachtung als Menschenwerk entpuppte. Auch hier gibt es durchaus einen Verdächtigen: den zwielichtigen Konzernmagnaten Locke Bullard, den der US-Geheimdienst verdächtigt, illegal Waffen-Hightech an die Chinesen zu verkaufen. Bullard verfügt indes über beste politische Beziehungen und dünkt sich über das Gesetz erhaben, wie Sergeant Vincent D’Agosta zu seinem Leidwesen erfahren muss.
Bullard lässt den erfahrenen Kriminalisten mehrfach ins Leere laufen. Erst als der sich mit Pendergast zusammentut, kommen die Ermittlungen in Gang. Sie nehmen freilich bald eine unerwartete Wendung: Was Bullard auch plant, es geht über Landesverrat weit hinaus. Hat der Philosoph und Theologe Friedrich von Menck Recht, wenn er verkündet, er habe in alten Prophezeiungen die Ankündigung entdeckt, dass New York bzw. seine Bewohner wegen ihrer Sündhaftigkeit noch im laufenden Jahr durch ein unlöschbares Feuer von der Erde getilgt würden? Luzifer bleibt jedenfalls sehr aktiv; Pendergast und D’Agosta müssen ihm um die halbe Welt folgen, um am Ball zu bleiben …
Preston & Child, die beiden unermüdlichen Handwerker der ganz leichten Unterhaltung, fabrizieren mit „Burn Case“ ihren alljährlichen Buchmarkt-Bestseller. Einmal mehr drehen sie beliebte oder gerade aktuelle Moden und Mysterys durch die Mangel, brechen sie auf Trivialniveau herunter und verschmelzen sie zu einem Garn, auf dessen Logik man lieber keinen Gedanken verschwenden sollte.
Was den Lesespaß an sich nicht beeinträchtigt. „Burn Case“ ist Thriller-Trash, der sich selbst niemals ernst nimmt, sondern einfach nur unterhalten will. Das ist eine ehrenhafte und höchst schwierige Aufgabe, wie jene beweisen, die von diesem Job rein gar nichts verstehen: Dan Brown, Scott McBain, Steve Alten und andere von der Werbeindustrie künstlich belebte und am Leben gehaltene Schreibkreaturen.
„Burn Case“ lebt von der flotten Handlung und uralten literarischen Tricks. Immer wieder stoßen unsere Helden auf Geheimnisse, hinter denen sich neue Rätselhaftigkeiten auftun – gut so, denn wirklich mysteriös kommt einem nicht vor, was sich das Autorenduo da ausgedacht hat. Der bewährte Cliffhanger kommt zu neuen Ehren: Mehrfach lassen uns Preston & Child auf dem Höhepunkt einer für unsere Protagonisten hoffnungslosen Situation zappeln. Erst später löst sich das Geheimnis, wie es z. B. D’Agosta gelingen konnte, mit nur einer Kugel im Lauf gleich drei Profikillern zu entkommen. Auch hier sind die Erklärungen nie überzeugend. Die Geschichte endet sogar mit einem Cliffhanger und leitet so über zur „Fortsetzung“; die 2005 unter dem Titel „Dance of Death“ erschien und den von den Toten auferstandenen Pendergast im Kampf mit seinem irren Bruder Diogenes zeigt, der in „Burn Case“ bereits Erwähnung findet.
Der Mystery-Boom der Millenniumsära hat sich allmählich verflüchtigt. Er wird nicht unmodern werden, denn die Menschen lieben das Geheimnisvolle. Doch auf die Dosierung kommt es an. Stets achten Preston & Child darauf, dem Seltsamen ein festes Standbein in der „Realität“ zu verschaffen. Es speist sich aus dem naturwissenschaftlichen Spezialwissen derer, die es auf die Welt loslassen. Glücklicherweise wissen die Verfasser hier mehr als die meisten Leser, so dass der Unfug, den sie verzapfen, zumindest glaubhaft klingt.
Für „Burn Case“ ist der Aufhänger das eigenartige Phänomen der „spontanen menschlichen Selbstentzündung“: Hier und da verbrennen Unglückspilze ohne ersichtliche Ursache offenbar aus sich selbst heraus, wobei unglaubliche Temperaturen entstehen. Die Wissenschaft ist außerordentlich skeptisch, die Anhänger des Unerklärlichen sind entzückt, zumal es eindrucksvolle Bilddokumente über solche flammenden Infernos gibt. (Bei Interesse & Kenntnissen der englischen Sprache bitte eine Suchmaschine der eigenen Wahl mit dem Begriff „spontaneous human combustion“ füttern – das Angebot entsprechender Websites ist beachtlich, was den unfreiwilligen Humorfaktor vieler durchaus ernsthaft gemeinter „Erklärungen“ einschließt.)
Da zwei Rätsel besser sind als eines, greifen Preston & Child auf einen weiteren, eher volkstümlichen Angsterreger zurück, der weniger gut belegt ist, aber Aufmerksamkeit garantiert. Dr. Faustus gilt als Prototyp jener Menschen, die auf dem Weg zu Ruhm, Macht und Vermögen eine fatale Abkürzung nehmen: Er verschrieb seine Seele dem Teufel, der ihm zunächst alles gewährte, was er forderte (den Ritt auf einem Weinfass eingeschlossen – spätmittelalterliche Scherze halt …), bis er ihn nach Ablauf der vereinbarten Frist um 1540 unter für Faustus sehr schmerzhaften Begleitumständen (die in „Burn Case“ eingehend beschrieben werden) und unter Hinterlassenschaft eindeutig satanischer Spuren holte.
So ein moderner Dr. Faustus ist Locke Bullard, der allmählich merkt, dass er in seinem Drang nach Geld und Einfluss zu weit gegangen ist. Seine Komplizen, die mit ihm den Teufelspakt schworen, hat es schon erwischt. Bullard hingegen versucht das Unmögliche: Er will Mephisto um seinen Lohn prellen und das Zusammengeraffte trotzdem behalten, was wie erwartet endet, denn: „Der Teufel ist ein Lügner und der Vater der Lügen“ (Johannes 8,44). Außerdem ist er schlau.
Wobei Satan in persona in „Burn Case“ durch Abwesenheit glänzt – schade eigentlich, denn sein Auftritt wäre in einem Märchenthriller wie diesem durchaus möglich gewesen. Wer sich wirklich hinter seinem Trugbild verbirgt, ahnt der erfahrene Leser ein bisschen zu früh, was zur Holzhammerdramaturgie des Werks freilich passt. Schließlich treten auch sonst nur Knallchargen auf. Bullard ist Bösewicht aus Passion – kein raffinierter Psychopath, sondern als Weltfeind Nr. 1 etwa so glaubhaft wie jeder beliebige James-Bond-Finsterling. Sehr passend umgibt ihn eine Horde von Schlägern und Mietmördern, deren Brutalität nur durch die Zuverlässigkeit übertroffen wird, mit der sie im entscheidenden Moment versagen und das Heldenduo Pendergast & D’Agosta aus todsicheren Todesfallen entwischen lassen.
Das ist ärgerlicher, denn beide sind als positive Hauptfiguren außerordentliche Nervensägen. Pendergast, die Denkmaschine, die alles weiß und kann und niemals zögert, die Leser mit der Vorführung beider Eigenschaften herzlich zu langweilen, ist eine erstaunlich unsympathische Gestalt. Immer noch wollen Preston & Child ihn uns als mysteriösen Mann aus dem Nichts verkaufen. Sind sie außerstande zu bemerken, wie ausgereizt und öde dieser Gag längst ist? Richtig gewirkt hat er nur in „Relic“ (1994; dt. „Das Relikt – Museum der Angst“), als uns Pendergast das erste Mal begegnete.
Seit „Cabinet of Curiosities“ (2002, dt. [„Formula – Tunnel des Grauens“) 192 beginnen die Autoren als buchübergreifende Nebenhandlung eine Pendergast-Familiengeschichte der kruden Art zu entwerfen. Auch hier sind Preston & Child seltsam geizig, beschränken sich auf Andeutungen – Versprechen, die bisher nie eingelöst wurden und einfach überflüssig sind, weil Aloysius Pendergast eine unerhört nichts sagende Figur ist.
Zusätzlich störend wirkt das Bestreben der Autoren, ihre Thriller quasi zu „vernetzen“: Immer wieder treten Figuren auf, die bereits in anderen Romanen Verwendung fanden. Das funktioniert mit dem bewährten D’Agosta, geht aber schief mit sinnfreien Gastauftritten: Weder Polizeifrau Laura Haywood noch Journalist Harriman bringen die Handlung voran. Stattdessen langweilen sie den Leser in einem isolierten Nebenstrang mit den Eskapaden eines selbst ernannten Neo-Heilands, der davon abgehalten werden muss, in New York einen Gottesstaat auszurufen: anscheinend musste „Burn Case“ als Buch nachträglich auf Länge gebracht werden.
Selbstverständlich sind den Autoren die Beschränktheiten ihres Personals bekannt. Deshalb gesellt sich ja der lebensnahe Watson Vincent D’Agosta zum unzugänglichen Holmes Pendergast. Leider erweist sich auch der Polizist als wandelndes Klischee: der wackere, vom Leben gebeutelte, fürs Grobe und – in Vertretung der Leserschaft – für das Stellen dummer Fragen zuständige Brummcop mit dem goldenen Herzen, der von den Vorgesetzten immer auf die Schnauze kriegt, von der Gattin verlassen wurde und sich ansonsten wie der Elefant im Porzellanladen zu benehmen hat.
D’Agosta ist es auch, der von Preston & Child in eine der peinlichsten und lächerlichsten Sexszenen gezwungen wird, die man sich vorstellen kann – oder eben nicht; man muss es einfach lesen und sich vor Lachen schütteln, wie der arme Vincent völlig unvermittelt über die schöne Kollegin Laura herfallen muss, die ansonsten die Alibifrau in unserer Geschichte mimt. (Die zeitgereiste Constance lassen wir außen vor; das ist eine weitere Figur ohne jede Bedeutung für die „Burn Case“-Story.)
Eine „Meisterleistung“ gelang dem deutschen Verlag übrigens wieder einmal mit der „Übersetzung“ des Originaltitels. „Brimstone“ bedeutet „Schwefel“, was angesichts der erzählten Geschichte Sinn ergibt. Dass „Burn Case“ – „Brandfall“? – als „Eindeutschung“ größere Klarheit schafft, kann nicht unbedingt behauptet werden.
Einmal mehr wird das Buch durch eine gut lesbare Schrift, einen kleinräumigen Satzspiegel und großzügige Ränder auf imposante Seitenstärke gebracht – eine weitere Unsitte moderner Veröffentlichungsfabriken, die von der Theorie ausgehen, dass zögernde Leser im Laden von möglichst dicken Büchern („Hier kriegt man was für sein Geld!“) magisch angezogen werden. Indes beträgt der Preis für „Burn Case“ nur 19,90 Euro, was für ein gebundenes Buch heutzutage wirklich günstig ist. Mehr möchte man für dieses kurzweilige, wegen seiner allzu offensichtlichen Schlampigkeit aber auch Ärgernis erregende Werk allerdings auch nicht anlegen.
Douglas Preston wurde 1956 in Cambridge, Massachusetts geboren. Er studierte ausgiebig, nämlich Mathematik, Physik, Anthropologie, Biologie, Chemie, Geologie, Astronomie und Englische Literatur. Erstaunlicherweise immer noch jung an Jahren, nahm er anschließend einen Job am American Museum of Natural History in New York an. Während der Recherchen zu einem Sachbuch über „Dinosaurier in der Dachkammer“ – gemeint sind die über das ganze Riesenhaus verteilten, oft ungehobenen Schätze dieses Museums – arbeitete Preston bei |St. Martin’s Press| mit einem jungen Lektor namens Lincoln Child zusammen. Thema und Ort inspirierten das Duo zur Niederschrift eines ersten Romans: „Relic“ (1994; dt. „Das Relikt – Museum der Angst“).
Wenn Preston das Hirn ist, muss man Lincoln Child, geboren 1957 in Westport, Connecticut, als Herz des Duos bezeichnen. Er begann schon früh zu schreiben, entdeckte sein Faible für das Phantastische und bald darauf die Tatsache, dass sich davon schlecht leben ließ. So ging Child – auch er studierte übrigens Englische Literatur – nach New York und wurde bei |St. Martins Press| angestellt. Er betreute Autoren des Hauses und gab selbst mehrere Anthologien mit Geistergeschichten heraus. 1987 wechselte Child in die Software-Entwicklung. Mehrere Jahre war er dort tätig, während er nach Feierabend mit Douglas Preston an „Relic“ schrieb. Erst seit dem Durchbruch mit diesem Werk ist Child hauptberuflicher Schriftsteller. (Douglas Preston ist übrigens nicht mit seinem ebenfalls schriftstellernden Bruder Richard zu verwechseln, aus dessen Feder Bestseller wie „The Cobra Event“ und „The Hot Zone“ stammen.)
Selbstverständlich haben die beiden Autoren eine eigene Website ins Netz gestellt. Unter http://www.prestonchild.com wird man großzügig mit Neuigkeiten versorgt (und mit verkaufsförderlichen Ankündigungen gelockt).
Sturgeon, Theodore – goldene Helix, Die
Ende 2003 erschien bei |Shayol| „Lichte Augenblicke“, der erste Teil einer Sammlung ausgewählter Kurzgeschichten von Theodore Sturgeon. Mehr als ein Jahr danach ist nun mit „Die goldene Helix“ der zweite und abschließende Teil erschienen. Das Vorwort stammt diesmal von Ray Bradbury und ist genauso wie die Geschichten für diese Ausgabe neu übersetzt worden.
Den Anfang macht „Der Mann, dem das Meer abhanden kam“, eine Story, in der der Erzähler den Leser direkt anspricht und uns eine Strandszene vermittelt, mit einem spielenden Jungen und einem kranken Mann, der das Meer betrachtet. Beide sind miteinander verbunden: der Alte, der an der Taucherkrankheit leidet, und der Junge, der ihm Mut zusprechen will und sich an seine eigenen Taucherfahrungen erinnert. Dabei gehen allwissender Erzähler, alter Mann und Junge ineinander über, es ist nie ganz klar, wessen Blickwinkel man gerade betrachtet. Die Geschichte erscheint wie viele andere von Sturgeon nicht als SF, auch wenn sie mit diesem Etikett versehen ist. Der Autor spielt mit Illusionen und Gedankenbildern, erst am Schluss lichtet sich der Nebel der Wahnbilder.
Bei der nächsten Geschichte mit dem Titel „Biancas Hände“ stehen genau diese im Mittelpunkt. Bianca ist ein behindertes Mädchen, das bei seiner Mutter wohnt, Ran ist ein junger Mann, der als Hilfskraft in einem Café arbeitet. Er verliebt sich, aber nicht in sie, sondern in ihre Hände. Die Geschichte beschreibt diese merkwürdige Beziehung, dabei werden immer nur ihre Hände beschrieben, der Rest des Körpers dagegen ausgeblendet. Die ganze Geschichte ist eher verstörend und man weiß nicht so recht, ob dies nun schon Horror ist oder etwas anderes.
Richtiggehend klassisch erscheint einem dagegen „Herr Costello, Held“. Die Geschichte wird uns erzählt von einem Zahlmeister, auf dessen Schiff Herr Costello mitreist. Wie sich bald zeigt, ist dieser Costello ein ehemaliger Politiker, Intrigant und Manipulator. Zunächst bringt er die Schiffsgemeinschaft auf seine Seite, zerstört alte Loyalitäten und sät Misstrauen und Zwietracht. Im zweiten Teil setzt er sein Werk auf einem Planeten fort und etabliert dort eine Kollektivgesellschaft, in der man nie einsam ist. Doch dabei scheint er in den Augen des Zahlmeisters, der uns berichtet, ein freundlicher und ehrbarer Mann zu sein.
„Es“ ist klassischer Horror. Eine einsame Farm in den USA, auf der zwei Brüder, eine Frau und ein kleines Mädchen leben. Das Grauen dagegen lauert im Wald auf seine Opfer. Das Monster ist nicht böse, es hat keine Ziele, es tötet einfach. Dabei ist die Handlung geradlinig und kommt ohne viele Schleifen oder Hintergedanken aus.
Ganz anders dagegen „Das andere Geschlecht“. Wie der Titel nahelegt, geht es um Mann und Frau und Frau und Mann und alles, was dazwischen liegt. Ein Biologe, der die Leichen eines bei einem Raubüberfall getöteten Pärchens untersuchen soll, und eine Reporterin, die daraus eine Story machen will, sind die Hauptpersonen. Doch dann sind da noch die merkwürdigen Leichen, die in Flammen aufgehen, als der Mann sein Büro verlässt. Und während er noch in dieser Nacht seine Traumfrau trifft, findet sie am nächsten Tag ihren Traummann. Um aber zu erkennen, was sie wirklich wollen, brauchen sie beide ein Wesen, das weder männlich noch weiblich ist. Letztlich geht es hier also um das altbekannte Spiel zwischen Mann und Frau, doch Sturgeon nutzt die phantastischen Möglichkeiten der SF, um noch eine Variante einzubringen.
In „Denkweise“ berichtet uns der Ich-Erzähler, ein SF-Autor, der früher als Seemann gearbeitet hat, von einem Freund mit einer ganz besonderen Art, an Probleme heranzugehen. Bezugspunkt der Handlung ist der Bruder dieses Freundes, der unheilbar erkrankt ist und dessen Körper einfach zu zerfallen scheint. Die Frage, die sich stellt: Wer ist schuld an dieser Krankheit? Wer ist überhaupt an etwas schuld? Bringt die Pistole einen Menschen um, oder der, der abdrückt?
Und was ist schlimmer: Hass oder Gleichgültigkeit? Diese Geschichte regt zum Nachdenken an, in erster Linie schockt sie aber.
„Die Fähigkeiten Xanadus“ weist dagegen wieder die Merkmale auf, an denen man SF erkennen kann. Die Menschheit hat sich über die Galaxis ausgebreitet und dabei sind die verschiedensten Kulturen entstanden, doch bei allen gibt es noch die alte Sprache, die als Verständigungsmittel genutzt wird. Nun landet ein Raumfahrer aus einer hoch technisierten Kultur auf dem Planeten Xanadu, dessen Bewohner vergleichsweise primitiv leben. Sie bauen ihre Häuser ohne Wände, sie kennen keine Regierung – und sie verrichten ihren Stuhlgang in der Öffentlichkeit. Wie sich herausstellt, ist die Kultur der scheinbaren Barbaren sogar älter als seine eigene, doch der Raumfahrer kann sich nicht erklären, warum sie so leben. Er selbst ist mit klaren Zielen gekommen: Er soll herausfinden, ob es sich für seine Welt lohnt, diesen Planeten zu erobern.
Den Abschluss bildet die namensgebende „goldene Helix“, die auch die längste Geschichte dieses Bandes ist. Eine Gruppe von Kolonisten, die auf dem Weg zu ihrer neuen Heimat ist, erwacht aus dem Kälteschlaf, nur um festzustellen, dass sie nicht mehr auf dem Raumschiff, sondern auf einem völlig fremden Planeten sind. Dorthin gebracht wurden sie von merkwürdig golden schimmernden Wesen, deren Zeichen eine goldene Helix ist. Diese Geschichte entstand im Herbst 1953, ein halbes Jahr, nachdem Watson und Crick das Doppelhelixmodell der DNS vorgestellt hatten. Sturgeon spinnt darin seine eigenen Vorstellungen über die Entwicklung der Menschheit und der Evolution aus.
Ergänzt werden die Geschichten von bibiographischen Informationen sowie einem Anhang von Hans-Peter Neumann und Hannes Riffel mit den in der englischen Sammelausgabe bisher erschienenen Texten und einer Übersicht über die auf Deutsch erschienenen Sammelbände mit Geschichten von Sturgeon sowie seiner Romane. Neben den durchgehend guten Neuübersetzungen erkennt man vor allem daran den hohen Anspruch des Verlags an die beiden Erzählbände.
Sturgeon selbst ist ein faszinierender Autor. Er schafft es, den Leser mit den ersten Sätzen neugierig zu machen, das Wichtigste kurz vorzustellen, so dass es einem vorkommt, als ob man Bescheid wüsste, nur um einige Seiten später überrascht zu werden. Und dabei gelingt ihm das Kunststück, dies alles auf wenigen Seiten auszubreiten. Er wird zu Recht als ein Meister der Kurzgeschichte bezeichnet.
Die hier ausgewählten Geschichten sind sehr unterschiedlich, SF und Non-SF wechseln sich ab. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, aber es wird auch jeder eine Geschichte finden, die ihm nicht zusagt. Seien es der geradlinige Horror in „Es“ oder die verwirrenden Geschehnisse in „Die goldene Helix“. Trotzdem bietet sich der Band gerade für diejenigen an, die Kurzgeschichten eher skeptisch gegenüberstehen, denn Sturgeon kann doch davon überzeugen, dass es auch auf wenigen Seiten möglich ist, vieles zu sagen, ohne dass die Geschichte bedeutungsüberladen wirkt.
_Konrad Schwenke_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
Perry, Anne – Feinde der Krone
Die Inspektor-Pitt-Reihe von Anne Perry nimmt mittlerweile schon recht voluminöse Ausmaße an. „Feinde der Krone“ ist der 22. Band der Reihe und schließt sich direkt an die finalen Ereignisse des Vorgängerbandes [„Die Verschwörung von Whitechapel“ 1175 an. Vorkenntnisse sind also durchaus empfehlenswert, auch wenn Perry gelegentlich auf Vorangegangenes zurückgreift, um den roten Faden herzustellen.
Eines der Grundelemente der Inspektor-Pitt-Reihe ist eine Verschwörergruppe namens „Der innere Kreis“. Gut getarnt, sitzen Vertreter dieser Gruppe in den allen Bereichen von Verwaltung, Justiz und Gesellschaft und streben als oberstes Ziel eine Beseitigung der Monarchie an, um sich selbst zur regierenden Macht des britischen Empires aufzuschwingen. Der Titel des vorliegenden Bandes „Feinde der Krone“ deutet schon an, dass diesem Thema auch hier wieder eine tragende Rolle zukommt.
In „Die Verschwörung von Whitechapel“ gelang es Inspektor Pitt, das Bestreben des Inneren Kreises, die Krone zu stürzen, zu vereiteln. Am Ende wurde der vermutlich wichtigste Mann der Verschwörergruppe, Charles Voisey, in den Adelsstand erhoben – eine bittere Pille für jemanden, der so vehement gegen die Monarchie arbeitet. Für Pitt war es die einzige Möglichkeit, Voisey unschädlich zu machen.
Doch der holt nun mit seinem frisch erworbenen Adelstitel zum Gegenschlag aus. Er kandidiert für die Unterhauswahl und will nun auf diesem Wege die Ziele des Inneren Kreises verwirklichen. Pitt wird im Auftrag des Sicherheitsdienstes darauf angesetzt, Voisey im Auge zu behalten und zu verhindern, dass dieser mit Hilfe krimineller Machenschaften und Intrigen die Abstimmung vor seinem Gegenkandidaten, dem Liberalen Aubrey Serracold, gewinnt.
Als dann die berühmte Spiritistin Maude Lamont ermordet aufgefunden wird, ist es wiederum Pitt, der mit den Ermittlungen betraut wird. Als Pitt herausfindet, wer die Gäste von Lamonts letzter Séance waren, vermutet er gleich einen Zusammenhang zu Charles Voisey und dem Inneren Kreis, denn die letzten Gäste waren Rose Serracold, die Gattin von Voiseys Gegenkandidat und General Kingsley, der in Leserbriefen ein glühender Verfechter von Voiseys Anliegen zu sein scheint. Doch wer war der dritte Gast an diesem Abend, der in Maude Lamonts Notizbuch nur durch ein Symbol verewigt ist? Pitt versucht es herauszufinden und kommt dabei einem Skandal auf die Spur. Doch seine Zeit wird knapp, denn mit jeden Tag rücken die Unterhauswahlen ein Stückchen näher …
Wieder einmal nimmt Anne Perry sich in ihrem Roman zwei Themenkomplexe vor, die innerhalb der Handlung in einem Zusammenhang stehen. Die Verschwörung um den Inneren Kreis, die sie mit Fortschreiten der Romanreihe immer weiter ausbaut, und einen Mordfall, in dem Pitt ermittelt und der innerhalb des Buches abgeschlossen wird. Der Innere Kreise ist, ebenso wie die in jedem Band wieder auftauchenden Hauptfiguren, der rote Faden der Reihe. War der Zusammenhang zwischen den beiden thematischen Ebenen Kriminalfall und Verschwörung in „Die Verschwörung von Whitechapel“ noch ein recht nachvollziehbarer, deutlicher und ausgewogener, so wird er in „Feinde der Krone“ zunehmend abstrakter und dadurch leider auch nicht unbedingt überzeugender.
Pitt stellt sofort einen Zusammenhang zwischen dem Mord an der Spiritistin und Charles Voiseys Bestrebungen, einen Unterhaussitz zu ergattern, her. Für den Leser wird dies nicht unbedingt bis ins letzte Glied nachvollziehbar erklärt. Der Zusammenhang bleibt recht diffus und Pitts Erklärungsversuch weitestgehend spekulativ und abstrakt. So kommen auch die Ermittlungen in der Mordsache nicht so recht voran. Perry wendet sich zwischendurch immer wieder anderen Handlungsfäden und Personengruppen zu. Sie berichtet von Dinners der feinen Gesellschaft, die im Vorfeld der Wahlen von eben diesem Thema beherrscht werden. Damit gibt sie zwar sehr nachvollziehbar die politische Stimmung Englands zur damaligen Zeit wieder und macht ihren Roman gerade auch aus historischer Sicht interessant, dennoch gerät der Kriminalfall neben diesen Ausführungen manchmal schon ein wenig ins Hintertreffen.
Mit fortschreitenden Ermittlungen konzentriert Perry sich zunehmend auf den etwas mühsam bemühten Zusammenhang zwischen dem Mordfall und dem Inneren Kreis. Der Innere Kreis beginnt die Handlung zu dominieren. Alles läuft auf ein Duell zwischen Pitt und Voisey hinaus, der nach seiner Niederlage in „Die Verschwörung von Whitechapel“ darauf aus ist, es Pitt heimzuzahlen. Der Mord an der Spiritistin wird dabei schon fast ein wenig nebenbei aufgeklärt. Nachdem es Kapitel für Kapitel zunächst kaum voranging, nehmen die Dinge zum Ende hin einen recht rasanten Verlauf. Der anfangs noch etwas schleppende Spannungsbogen kommt dann ganz ordentlich in Fahrt, so dass die Lektüre zumindest im letzten Buchdrittel doch noch recht fesselnd verläuft.
Doch das macht den etwas schleppenden Start nicht vergessen. So abrupt wie „Die Verschwörung von Whitechapel“ endete, so abrupt beginnt „Feinde der Krone“. Die beiden Bände scheinen in der Tat darauf ausgelegt zu sein, dass man sie direkt nacheinander liest. Dennoch drängt sich der Eindruck auf, dass Annes Perry das Niveau des Vorgängerromans nicht zu halten vermag. Hier wirken die verschiedenen Handlungsebenen etwas unausgewogen, so dass auch der Spannungsbogen sich nicht so kontinuierlich aufstrebend entwickelt, wie man es beim Vorgängerroman erlebt hat.
Ein Grund dafür ist auch der etwas farblos bleibende Erzählstrang um Pitts Familie. Vor allem Pitts Frau ist in der Inspektor-Pitt-Reihe immer eine wichtige Zutat gewesen. Sie trug auf ihre Art zu den Ermittlungen bei, hatte sie doch Zugang zu gesellschaftlichen Bereichen, die Pitt selbst verschlossen blieben. In „Feinde der Krone“ tritt sie zusammen mit den beiden Kindern und dem Hausmädchen Gracie alleine die Urlaubsreise nach Devon an, auf die auch Pitt eigentlich mitkommen sollte. Nur gelegentlich blendet Perry diesen Handlungsstrang ein, und so richtig zu Ende geführt wird er gar nicht erst. Die Figuren rund um Inspektor Pitt – in „Die Verschwörung von Whitechapel“ noch ein echter Pluspunkt – verschenken hier ein Menge Potenzial, indem sie kaum zum Tragen kommen.
Das erweckt den Eindruck, als müsse Anne Perry ähnlich wie andere nicht minder aktive Vielschreiber auch, der Vielzahl ihrer Romane allmählich Tribut zollen. Bei dem Tempo, in dem Perrys Romane auf den Markt drängen, ist es kein Wunder, dass irgendwann auch in Sachen Qualität Einbußen zu erwarten sind. Sie scheint durchaus ehrgeizige Ziele zu haben, indem sie Kriminalfall, Verschwörung sowie gesellschaftliche und politische Zeitstudie vermischt, aber in diesem Fall fehlt der Mischung einfach die Ausgewogenheit.
Was die Lektüre immerhin noch ganz angenehm macht und dafür sorgt, dass man das Buch dennoch ohne Mühe zu Ende bringt, ist neben der einfließenden Zeitstudie auch Perrys Schreibstil. Perry kommt weitestgehend ohne Action aus und hält den Leser dank ihrer routinierten Erzählweise auch so bei der Stange. Ihr Stil ist nicht sonderlich ausschmückend, aber auch nicht zu nüchtern. Schlichte Kost, die sich leicht und flüssig konsumieren lässt. Sicherlich nichts Herausragendes, aber dennoch äußerst solide Unterhaltungsliteratur.
Alles in allem kann „Feinde der Krone“ nicht so ganz die Erwartungen erfüllen, die der Vorgängerroman „Die Verschwörung von Whitechapel“ geweckt hat. Etwas unausgewogene Erzählebenen und ein Kriminalfall, der im Laufe der Handlung ein wenig ins Hintertreffen zu geraten droht, trüben genauso die Freude wie liebgewonnene Hauptfiguren, deren Anteil an der Handlung einfach zu mager und zu wenig überzeugend ausfällt. Zwar durchaus solide Kost für Freunde historischer Krimis, da eben auch die historischen Schilderungen des viktorianischen Zeitalters sehr lesenswert sind, aber man hat von Anne Perry eben auch schon Besseres gelesen.
Hyung, Min-Woo – Priest – Band 3
[Band 1 1704
[Band 2 1705
Im dritten Band nimmt die Geschichte um den mysteriösen Priester „Ivan Isaacs“ eine plötzliche Wende, denn der Autor und Zeichner Min-Woo Hyung schwenkt nach einigen weiteren Auschnitten aus dem verhängnisvollen Leben in der Wüste 300 Jahre weiter in die Zukunft und beginnt, das Vermächtnis des Priesters näher aufzudecken. Plötzlich wird die Geschichte in einem ganz anderen Rahmen betrachtet, gewinnt dadurch aber einige zusätzliche Elemente und Hintergründe, die man bislang noch gar nicht in Betracht ziehen konnte.
Während die Führerin der Angel-Rebellen für die Anschläge in der Wüste verantwortlich gemacht wird und die verbliebenen Bewohner die Todesstrafe für dieses teuflische Verbrechen fordern, findet Lizzy bei einigen Marshalls noch einen letzten Hoffnungsfunken, denn sie glauben an ihre Unschuld und wollen der Wahrheit auf die Spur kommen. Lizzy sieht darin auch die einzige Chance, noch einmal aus ihrer Misere auszubrechen, und willigt schließlich ein, sich den Sheriffs anzuvertrauen – ansonsten besteht nämlich für sie auch die Gefahr, infolge ihrer schweren Verletzung zu einer Untoten zu mutieren.
Isaacs beginnt derweil, an seinen Memoiren zu arbeiten, die schließlich 300 Jahre später auftauchen. Der längst totgeglaubte Graham hat die letzten Jahre damit verbracht, das Tagebuch von Ivan Isaacs zu studieren und die seltsamen Vorkommnisen der Vorzeit aufzuklären. Jedoch braucht er dazu die Hilfe seines alten Kumpels Simon, der überrascht ist, Graham eines Tages wiederzutreffen, jedoch noch mehr ins Staunen kommt, als dieser ihm einen riesigen Komplex offenbart, in dem die Forschungen ein im wahrsten Sinne des Wortes diabolisches Ausmaß annehmen. Die dort lebenden Gläubigen glauben fest daran, dass Simon ihnen beim letzten Schritt zur Vollendung ihrer Theorie weiterhelfen kann, und als dieser sich die Dokumente von Isaacs ansieht, entdeckt er so manches grauenvolle Geheimnis aus der Vergangenheit.
Min-Woo Hyung hat bereits nach sehr kurzer Zeit einen gewagten Schritt gemacht und die bisherige Geschichte erst mal zur Ruhe gelegt. Schilderte er in den ersten beiden Mangas noch die Sicht der Dinge überwiegend aus dem Blickwinkel der verwirrten Lizzy, kommen nun die Ansichten und der Glauben gelehrter Theologen und Wissenschaftler an die Oberfläche, wobei die religiösen Inhalte dieser Reihe ebenfalls zum ersten Mal eine gewichtigere Bedeutung gewinnen. Hyung gibt erstmals einige Hinweise auf die ferne Vergangenheit und die Geschehnisse vor dem Tag, an dem Ivan Isaacs seine Selle an Belial verkaufte, hält sich aber dabei noch dezent zurück, so dass die Spannung stets sehr hoch und der Leser am Buch kleben bleibt.
Andererseits ist man zunächst einmal verwirrt, weil man einen solchen Schritt zu diesem Zeitpunkt absolut nicht erwartet hat. Dies soll jedoch nicht heißen, dass die Geschichte aus dem Wilden Westen damit abgeschlossen wäre – hier setzt Hyung zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder an, doch erst einmal deckt er jetzt Schritt für Schritt die Geschichte der verschiedenen Charaktere auf und deutet in Band 3 bereits an, welche Tragweite die gesamte Story hat.
Mit dem Buch als Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart lässt der Autor schließlich zwei Geschichten parallel laufen und holt diesbezüglich auch ziemlich weit aus. In den kommenden Bänden, ich möchte es schon mal ankündigen, spielt die Geschichte sich in einzelnen Flashbacks aus der Sicht von Ivan Isaacs‘ Tagebuch ab, und dabei wird dann Schritt für Schritt die Wahrheit über den jungen Priester, den Erzengel Temozarela und schließlich auch das nebulöse Gebilde inmitten der abgelegenen Theologen-Festung aufgedeckt.
Es lohnt sich also nach wie vor, bei dieser Geschichte am Ball zu bleiben, gerade jetzt, wo Min-Woo Hyung noch mehr Pforten für noch weiter reichende Handlungsstränge öffnet und die verschiedenen Zeiten dabei exzellent miteinander verknüpft. Spätestens mit diesem Band, in dem mir übrigens auch die illustrierten Darstellungen am besten gefallen (womit auch die verminderte Brutalität einhergeht), habe ich meine Liebe für „Priest“ entdeckt!
Interview mit Per Helge Sørensen
|Per Helge Sorensen ist Spezialist für Internetsicherheit und Kryptographie. Mit [„Intrigenspiel“ 1590 hat Lübbe seinen zweiten Roman in die deutschen Buchläden gebracht, der komplexer ist als sein Vorgänger „Mailstorm“, aber erneut faszinierende Blickwinkel auf die Abgründe der Multi-Media-Gesellschaft eröffnet. Grund genug, um einige neugierige Fragen nach Dänemark zu schicken:|
_Alf Stiegler:_
Wie lange hast du an „Intrigenspiel“ gearbeitet und was war der schwierigste Teil seiner Entstehung?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe an dem Roman volle eineinhalb Jahre gearbeitet. Der schwierigste Teil war definitiv der Anfang. Ich musste den ersten Abschnitt mehrere Male neu schreiben, um die richtige Energie in die ersten Kapitel zu bekommen. Außerdem hatten die ersten fünf Kapitel ursprünglich 120 Seiten. Ich habe sie auf nur 70 Seiten heruntergekürzt.
_Alf Stiegler:_
Wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die du von „Mailstorm“ bis zum aktuellen „Intrigenspiel“ durchlaufen hast?
_Per Helge Sørensen:_
Mailstorm ist ein recht traditioneller Thriller – trotz der Handlungsplattform Internet. Irgendjemand wird auf Seite sieben umgebracht und die Hauptfigur hat herauszufinden, warum. Verglichen dazu ist „Intrigenspiel“ ein viel komplexerer Roman. Es gibt keinen Mord, der den Plot vorantreibt. Und die Story ist aus vier verschiedenen Perspektiven heraus erzählt. Außerdem hat sich die Sprache verändert: von der traditionellen, kompakten Thrillersprache in „Mailstorm“ zur ausgefeilter satirischen Sprache in „Intrigenspiel“.
_Alf Stiegler:_
Sind deine Storys schon fertig konstruiert, wenn du zu schreiben beginnst? Oder ziehst du es vor loszuschreiben, um dann zu sehen, wohin dich die Geschichte führt?
_Per Helge Sørensen:_
In Mailstorm kannte ich den kompletten Plot, als ich zu schreiben begann, in „Intrigenspiel“ waren es stattdessen anfangs etwa 2/3 der Handlung. Ich hatte keine Vorstellung, wie die Geschichte enden würde. Sollte Herman verhaftet werden? Sollte er verurteilt werden? Ich war darüber wirklich ein wenig beunruhigt, aber als ich den Punkt erreicht hatte, wo nichts mehr geplant war, hatte ich keine Probleme damit. Das letzte Drittel der Story hat sich praktisch von selbst geschrieben.
_Alf Stiegler:_
Bist du als Autor eher ein „einsamer Wolf“ oder engagierst du dich in deiner lokalen Literatur-Szene?
_Per Helge Sørensen:_
Ich bin eingebunden in die lokale Autorengemeinschaft. Tatsächlich war ich ein Jahr Vorsitzender der dänischen Autorengemeinschaft (von 2004 bis 2005). Aber diese Arbeit betrifft hauptsächlich politische Themen: Vertragsverhandlungen mit Verlegern, Entschädigungen von öffentlichen Bibliotheken an Autoren usw. Was mein Schreiben betrifft, bin ich allerdings ein „einsamer Wolf“.
_Alf Stiegler:_
Wie bist du überhaupt mit Literatur und dem Schreiben in Berührung gekommen?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe 1998 für das dänische Ministerium gearbeitet, Internet- und Sicherheitsfragen betreffend. Irgendwann war ich einfach überarbeitet und musste verschwinden. Also habe ich mir ein Flugzeugticket gekauft, um mich in Kuba für sechs Monate zu entspannen. Dort dachte ich mir dann, dass es durchaus den Versuch wert wäre, über manche der Themen einen Roman zu schreiben, die ich im Ministerium bearbeitet habe (Kryptographie etwa, die ja auch in „Mailstorm“ eine Rolle spielt). Der Rest ist, wie man so sagt, Geschichte.
_Alf Stiegler:_
Wie wichtig waren deine „digital-rights“-Arbeiten für den Schreibprozess von „Intrigenspiel“ und wie sehr beeinflussen sie deine Autorenarbeit überhaupt?
_Per Helge Sørensen:_
Politik ist ein wichtiger Motor für mein Schreiben. „Mailstorm“ ist auf der Basis von Diskussionen entstanden, die sich um Internetüberwachung und Kryptographie gedreht haben. Eines der wichtigsten Themen in „Intrigenspiel“ ist „freie Meinungsäußerung vs. Pornographie und kontroverse Inhalte“. In dem Zusammenhang sind die Arbeiten, die ich für „digital rights“ verfasse, wichtige Inspirationsquellen.
_Alf Stiegler:_
Beide deiner Bücher behandeln den Missbrauch von Medien – besonders das Internet. Ist dieses Thema dir ein brennendes Anliegen?
_Per Helge Sørensen:_
Auf jeden Fall. Das Internet ist ein sehr mächtiges Medium. Das erste Mal in der Geschichte können sich normale Bürger der ganzen Welt darstellen, ohne von irgendwem zensiert zu werden. Und sie können sich mit Gleichgesinnten austauschen – über den kompletten Globus. Aber die Gesellschaft ist es nicht gewöhnt, mit einer solchen Freiheit umzugehen, vor allem nicht, wenn diese Freiheit dazu verwendet wird, Informationen zu verbreiten, die wir als kontrovers ansehen oder sogar als gefährlich. Wie die Gesellschaft mit dieser Freiheit umgehen soll, ist ein wichtiges Thema der Demokratie. Zum Beispiel: Sollten wir Informationen darüber verbieten, wie man Verbrechen begehen kann (wie man Bomben bauen kann etwa), oder sollen wir nur die Verbrechen selbst verbieten?
_Alf Stiegler:_
Wie viele Erfahrungen aus deinem Alltagsleben haben ihren Weg in „Intrigenspiel“ gefunden? Das Leben von Kristian Nyholm zum Beispiel, oder der Umgang, den die Journalisten des Dagbladet miteinander pflegen – es wirkt so „echt“, dass man es beinahe fühlen kann. Ist das deiner Vorstellungskraft entsprungen, oder gestattest du dem Leser hier Einblicke in frühere Abschnitte deines Lebens?
_Per Helge Sørensen:_
Nyholms Figur basiert tatsächlich auf Erfahrungen, die ich während meiner Arbeit im dänischen Ministerium gemacht habe. Und praktisch alle Szenen mit der Journalistin Camilla sind aus meinen Erfahrungen mit Journalisten entstanden, Erfahrungen, die ich sammeln konnte, wenn ich Interviews über digital rights gegeben habe usw. „Intrigenspiel“ ist sehr stark vom „wirklichen Leben“ beeinflusst.
_Alf Stiegler:_
Aufklärung vs. Unterhaltung; was ist dein wichtigster Schreib-Antrieb?
_Per Helge Sørensen:_
Ich würde sagen, Aufklärung. Aber natürlich muss es auch unterhaltsam sein, sonst verliert man seine Leser.
_Alf Stiegler:_
Ich persönlich mochte es, wie du mit Definitionen gespielt hast, das „Spiel der großen Worte“, wie es Kristian Nyholm genannt hat; Ich schätze, Luhman wäre stolz auf dieses „Man gestaltet die Realität, indem man sie formuliert“. War das deine Absicht?
_Per Helge Sørensen:_
Ich würde gerne sagen, dass dem so ist … Aber … wirklich: Ich habe nie viel von Luhmann gelesen. Ich kenne mich mit Mathematik und dem Ingenieurswesen aus. Das Luhman-Zeug in „Intrigenspiel“ basiert auf ein paar oberflächlichen Blicken, die ich auf die Diplomarbeit eines Freundes geworfen habe. Hm. Trotzdem freut es mich, dass dir das „Spiel der großen Worte“ gefällt. Ich bin auch ziemlich stolz darauf.
_Alf Stiegler:_
Was hältst du überhaupt von Cyberpunk und Science-Fiction? Eher eine Erweiterung des geistigen Horizonts oder Verschwendung von Gehirnkapazität?
_Per Helge Sørensen:_
Wenn es gut gemacht ist, mag ich es sehr gerne. Gibson ist natürlich der Meister. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Art von Romanen, die ich hauptsächlich lese. David Mitchell kann ich wärmstens empfehlen – er verbindet Zeitgenössisches mit SF, Cyberpunk und vielen anderen Einflüssen. „Cloud Atlas“ und „Number9Dream“ sind die besten Bücher, die ich seit Jahren gelesen habe.
_Alf Stiegler:_
Okay, lass uns mal etwas spekulieren: Es gibt die Hypothese, dass wir bereits in einer virtuellen Realität leben. Diese Idee wurde von Moores Gesetz abgeleitet: Wenn Computer alle drei Jahre ihre Prozessor-Kapazitäten verdoppeln, wären wir vielleicht irgendwann in der Lage, perfekte Kopien unserer Realität anzufertigen. Solche virtuellen Realitäten hätten dann die Aufgabe, Konsequenzen von Projekten und Handlungen zu ergründen – ein Was-wäre-wenn-Simulator sozusagen.
Aber falls Moores Gesetz tatsächlich so etwas ermöglichen sollte, gäbe es in der Zukunft eine unvorstellbare Menge solcher virtuellen Realitäten – und der Wahrscheinlichkeitsrechnung entsprechend wäre es viel wahrscheinlicher, in einer dieser virtuellen Realitäten zu leben – nicht etwa in der „wirklichen Realität“. Was hält ein IT-Spezialist von solchen Spekulationen?
_Per Helge Sørensen:_
Hm. Interessant. Kann ich einen Freund anrufen?
Nun, ich denke, die Idee ist einfach aufregend, dass wir in einer „gefälschten“ virtuellen Realität existieren könnten. Natürlich ist das auch ein hervorragender Aufhänger für eine Story. Ich glaube, das ist ein sehr grundsätzlicher Menschheitstraum: Es muss einfach mehr geben, wir leben nicht in der wirklichen Welt und es gibt eine Hintertür zu irgendeinem fremden Ort. Es ist wie der Traum vieler Kinder: Die eigenen Eltern sind nicht die echten Eltern, tatsächlich ist man der Sohn eines Königs, und der wird eines Tages kommen, um einen abzuholen. Wie auch immer, meistens stellt sich heraus, dass deine Eltern auch tatsächlich deine Eltern sind. Es stellt sich heraus, dass man hart arbeiten muss, um diese Hintertür zu finden, hinaus in eine Welt voller Magie.
Um zu den virtuellen Realitäten zurückzukehren: So leid es mir tut, dort gilt genau das Gleiche. Diese Welt ist, so fürchte ich, die wirkliche Welt. Aber wenn man hart genug arbeitet, kann man sich die Magie für sich selbst erschaffen.
Um auf die technischen Aspekte einzugehen: Was ist mit den Computern, in denen diese virtuellen Welten existieren sollen? Diese Computer müssten ja Teil der „wirklichen Welt“ sein. Aber müssten sie nicht genauso in der virtuellen Welt existieren? Müsste in dieser virtuellen Welt (einer perfekten Kopie unserer Welt!) nicht ein virtueller Computer existieren, der wiederum diese virtuelle Welt enthalten müsste? (Kann Gott der Allmächtige einen Felsen erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht heben kann?)
_Alf Stiegler:_
Was hältst du vom „Transhumanismus“ und der dort vertretenen These, dass es eines Tages Super-Intelligenzen geben wird, die über den normalen Menschen bestimmen werden?
_Per Helge Sørensen:_
Ich bin ein Skeptiker. Ich habe während meines Studiums ein wenig mit künstlichen Intelligenzen gearbeitet. Obwohl die Geschwindigkeit der Prozessoren und die Speicherkapazität explodieren, sind Computer immer noch ziemlich dumm. Es ist ein Albtraum, wenn man auch nur versucht, einen Computer menschliche Sprache erkennen zu lassen. Rechner dazu zu bringen, eben Gesagtes auch zu |verstehen|, ist noch immer reine Zukunftsmusik. Man darf keinesfalls unterschätzen, wie komplex der menschliche Geist ist!
_Alf Stiegler:_
Andererseits: Die meisten exponentiellen Funktionen flachen irgendwann ab und Moores Gesetz wird es wahrscheinlich irgendwann genauso ergehen. Glaubst du, dass der Gipfel der Computerentwicklung schon an unsere Tür klopft?
_Per Helge Sørensen:_
Nein. Obwohl die technische Entwicklung sich durchaus verlangsamen könnte, glaube ich, dass es ein gewaltiges Entwicklungspotenzial gibt – neue Wege, wie man Computer oder das Internet nutzen kann. Ich würde sogar sagen, dass wir bisher nicht einmal die Spitze des Eisbergs gesehen haben.
_Alf Stiegler:_
Wie sieht es mit DNA-Computern aus? Handelt es sich dabei noch um Science-Fiction, oder greifen Ingenieure bereits auf diese Idee zurück?
_Per Helge Sørensen:_
Momentan ist das noch reine Science-Fiction. Aber das Bild-Telefon war ebenfalls Science-Fiction, als ich noch ein Kind war. Man braucht ja nur einen Blick auf Star Trek werfen … und einen Vergleich zum neuesten Nokia-Handy ziehen.
_Alf Stiegler:_
Neal Stephensons „Snow Crash“ behandelt auf faszinierende Weise eine „Vermählung“ von Religion mit einer ultra-modernen, Technik-geprägten Gesellschaft. Glaubst du, dass es noch Platz für eine Seele in unserer „postreligiösen Gesellschaft“ gibt?
_Per Helge Sørensen:_
Ich denke, es gibt eine Menge Seele in der postreligiösen Gesellschaft: Die Seele innerhalb eines jeden menschlichen Individuums. In meinen Augen ist Religion hauptsächlich eine Ausrede, die (meist von alten Männern) benutzt wird, um das Leben anderer Menschen zu kontrollieren.
_Alf Stiegler:_
„Sex mit Kindern ist der Ersatz, den die postreligiöse Gesellschaft für Blasphemie gefunden hat.“ – Wahr und zynisch. Was hat dich zu dieser Ansicht geführt?
_Per Helge Sørensen:_
Ich habe nach etwas gesucht, das den modernen, säkularen Menschen auf die selbe Weise vor den Kopf stößt, wie sich Muslime durch Kritik an ihrer Religion vor den Kopf gestoßen fühlen. Pädophilie ist mir als einziges Problem eingefallen. Vielleicht liegt das daran, dass Kinder für viele Menschen den Platz von Gott eingenommen haben – das wichtigste Ziel im Leben.
_Alf Stiegler:_
Kontrolle vs. Entscheidungsfreiheit. Würdest du eine Softwarelösung unterstützen, die „grenzüberschreitende Internetpornographie“ aus dem Internet filtern kann, eine Softwarelösung, wie sie die Softwarespezialisten von Kyner vorgeschlagen haben? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage …
_Per Helge Sørensen:_
Das Schlüsselwort ist „grenzüberschreitend“. Kyner erzeugt die Illusion, dass es derart extreme Pornographie gibt, dass wir sie loswerden müssen. Obwohl es zweifellos |nicht| illegal ist (also Pädophilie, etc.)! Was Kyner tatsächlich sagt ist, dass diese Art von Information illegal sein |sollte| – aber solange wir damit nicht durchkommen (wegen irgendwelchem demokratischen Bockmist über „freie Meinungsäußerung“), versuchen wir dergleichen auf andere Weise zu ächten: über Filter.
Indem Kyner Worte verwendet wie „grenzüberschreitend“, erzeugt er die Illusion, dass es ein Problem gibt, welches wir zu lösen haben. Obwohl es keines gibt. Übrigens verwendet die EU-Kommission den Begriff „schädlicher Inhalt“.
Tatsächlich ist die Sache ganz einfach: Es gibt zwei Arten von Inhalten:
– illegale Inhalte, um die sich die Polizei und die Gesetze zu kümmern haben,
– legale Inhalte, die man in Ruhe lassen sollte.
Es gibt keinen Grund für Filter.
_Alf Stiegler:_
Was sind deiner Ansicht nach die widerlichsten Entwicklungen der Multi-Media-Unterhaltung?
_Per Helge Sørensen:_
Wenn Streitkräfte die Sprache und Bilder der Spieleindustrie verwenden, um Soldaten zu rekrutieren. Die dänischen Streitkräfte veröffentlichen beispielsweise eine monatliche Broschüre, die wie Werbung für Counter Strike aussieht. Die US-Streitkräfte haben sogar ihr eigenes Rekrutierungs-Spiel entwickelt. Krieg ist kein Computerspiel. Die Streitkräfte sollten es am besten wissen.
_Alf Stiegler:_
Die dänische Literatur hat es schwer, sich einen Weg in deutsche Buchgeschäfte zu bahnen. Hast Du ein paar Underground-Tipps für Skandinavien-hungrige Sørensen-Süchtige?
_Per Helge Sørensen:_
Es gibt einen neuen Roman von Morten Ramsland. In Dänemark war er sehr erfolgreich und wird wahrscheinlich demnächst in Deutschland veröffentlicht. Uneingeschränkte Leseempfehlung!
Falls eher Kriminalromane bevorzugt werden, sollte man Sara Blaedel antesten. Sie ist die neue, dänische „Queen of Crime“.
_Alf Stiegler:_
Welche Lektüre ziehst du persönlich vor?
_Per Helge Sørensen:_
Im Moment lese ich eine Menge zeitgenössische Literatur aus England und Amerika. Allan Hullinghurst. David Mitchell (wie oben schon erwähnt). Jonathan Franzen. Poul Auster. Und den japanischen Guru natürlich: Haruki Murakami.
_Alf Stiegler:_
Gibt es eine Genre, von dem du die Finger lässt?
_Per Helge Sørensen:_
Als ich 13 war, habe ich eine Menge Fantasy gelesen. Ich denke, ich habe genug für den Rest meines Lebens.
_Alf Stiegler:_
Die dritte Veröffentlichung ist die Magische, sagt man im Musikgeschäft. Was dürfen wir von deiner dritten Veröffentlichung erwarten?
_Per Helge Sørensen:_
Den „Großen Dänischen Roman“, der sich mit all den wichtigen Themen der letzten 30 Jahre befasst, in Dänemark, Europa und dem Rest der Welt. Oder um es anders auszudrücken: Ich weiß es noch nicht. 😉
_Alf Stiegler:_
Ein paar letzte Worte für die Leser von Buchwurm.info?
_Per Helge Sørensen:_
Hört nicht auf zu lesen. Die magische Welt ist da draußen.