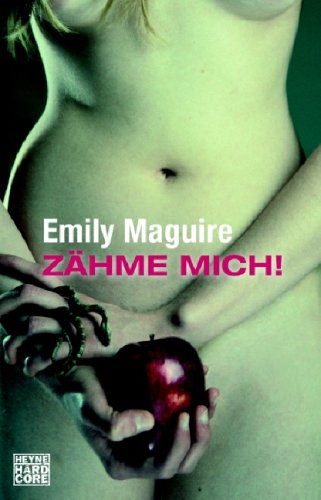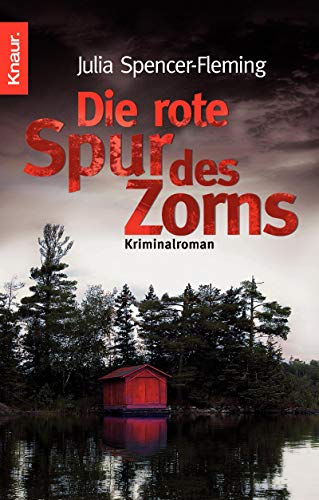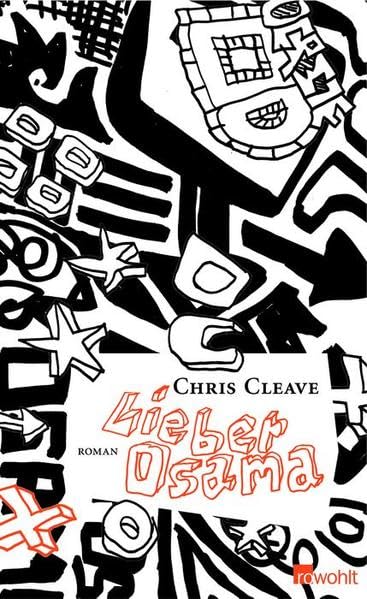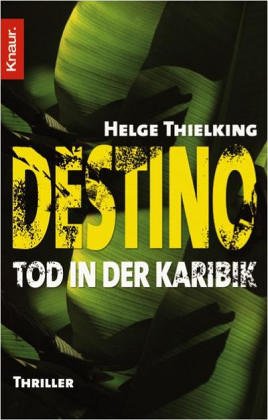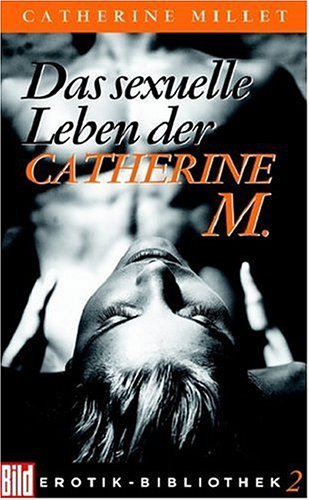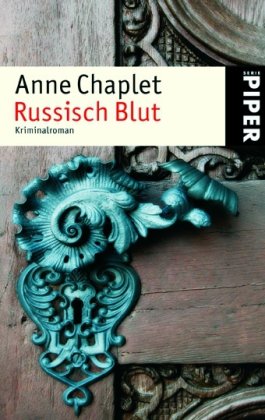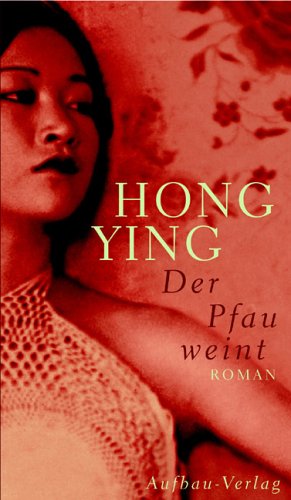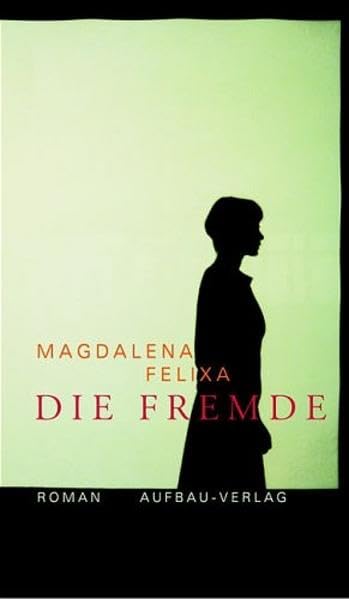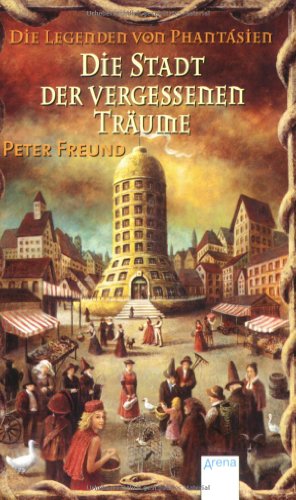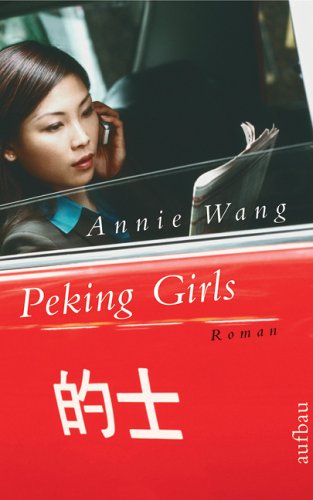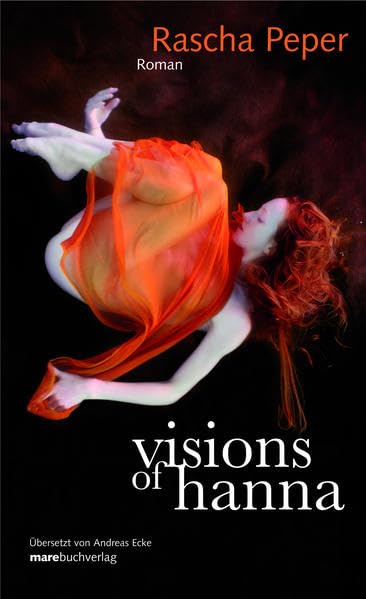Bei „Exit“ handelt es sich um einen Thriller mit Kellermans Serienhelden Alex Delaware, der selbstständiger Psychologe in New York ist, aber zusammen mit seinem Freund Milos Sturgis, einem Polizisten, der es nicht immer so genau nimmt, schon den einen oder anderen Fall gelöst hat.
Dieses Mal wird Alex von seiner ehemaligen Arbeitskollegin Stephanie Eves, die auf der Kinderstation des Western Pediatric Medical Centers arbeitet, zu Rate gezogen. Die knapp zwei Jahre alte Cassie Jones wird immer wieder ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie mysteriöse Anfälle erleidet, ohne dass die Ärzte eine Diagnose stellen können. Die Mutter des Kindes ist verunsichert. Nachdem ihr erster Sohn dem plötzlichen Kindstod erlegen ist, kümmert sie sich beinahe schon übertrieben um ihre Tochter und sehr schnell kommt Alex der Verdacht, dass sie am Münchhausensyndrom leiden könnte. Bei der erweiterten Form dieser Störung täuschen Eltern, zumeist die Mütter, Krankheiten an ihrem Nachwuchs vor, um Aufmerksamkeit zu bekommen oder eigene Traumata auf das Kind zu projizieren. Die Fakten in Cassies Fall sind erdrückend. Die Mutter hat einen Kindstod durchgemacht, was sehr oft bei Münchhausens vorkommt, und die Vergangenheit der Ehefrau eines angesehenen Uniprofessors, der zudem der Sohn des Krankenhausvorstands ist, ist auch nicht ganz sauber. Dabei macht die Familie Jones eigentlich einen sehr netten Eindruck. Delawares Neugierde ist geweckt; er macht sich auf die Suche nach dem Schuldigen und muss dabei gegen die Zeit kämpfen. Als ein Arzt des Krankenhauses, der Cassie ebenfalls untersucht hatte, im Parkhaus des Krankenhauses getötet wird, eröffnen sich ganz neue Dimensionen …
Zuerst einmal die schlechte Nachricht: Jonathan Kellerman produziert amerikanische Durchschnittsliteratur. Solche, die vielleicht irgendwann mal Oberklasse war, aber aufgrund der inflationären Anzahl von Büchern im ähnlichen Stil zum Durchschnitt wurde. Ein nüchterner Schreibstil, frei von Eigenheiten, und glatt gebürstete Protagonisten, ein solider Spannungsaufbau – das ist es, worüber wir hier reden.
Trotzdem kann Kellerman mit ein paar Überaschungen punkten. Vielleicht nicht gerade mit seinem stilistisch einwandfreien, aber nicht besonders aufregenden Schreibstil, der mit viel Wissen gespickt ist, das in transusige Dialoge gepackt wurde. Und vielleicht auch nicht gerade mit dem Angestelltengeseufze über weggefallene Arbeitsplätze und immer schlechter werdende Arbeitsbedingungen, denn das ist ja beinahe schon obligatorisch in jedem Krimi – sei es jetzt bei der Polizei oder in der Medizin. Blasse Charaktere mit wenig Tiefgang sind ebenso nicht besonders schicklich. Auch Kellermans leichter Hang zu übertriebener Detailbeschreibung (zum Beispiel die ausführliche Darstellung der Ohrringe von Alex‘ Freundin) trägt nicht gerade zum Genuss bei, hält sich aber im Vergleich mit einigen Kollegen noch in einem gewissen Rahmen.
Dagegen nimmt Kellerman in anderen Bereichen eine Vorbildfunktion ein. Er belästigt den Leser nur wenig mit dem Seelenleben seines Protagonisten, sondern konzentriert sich hauptsächlich auf den Fall, der trotz wenig Action mit der Zeit an Fahrt und Spannung gewinnt. Letztere bezieht er hauptsächlich daraus, dass Delaware mit der Zeit ein Netz von möglichen Tätern präsentiert, ohne sich wirklich festzulegen. Der Leser kann wunderbar mitraten und wird am Schluss doch noch überrascht. Allerdings muss er davor einige Längen hinnehmen und die Tatsache, dass die Handlung von der eigentlichen Geschichte, nämlich Cassies Leiden, etwas zu sehr abrückt und wirr wird.
In der Summe handelt es sich bei „Exit“ trotzdem um einen der besseren Thriller. Kellerman lässt das Privatleben seines Protagonisten zum größten Teil außen vor und konzentriert sich stattdessen darauf, einen auf weiten Strecken überzeugenden Plot zu basteln. Schreibstil und Längen in der Handlung verhindern ein besseres Ergebnis, aber trotzdem kann Kellerman auf einem Teil der Lesestrecke überzeugen.