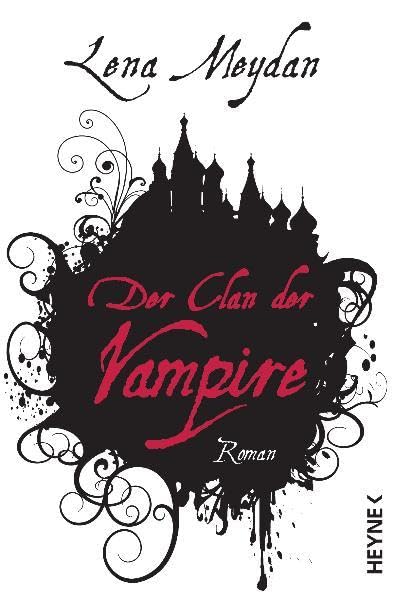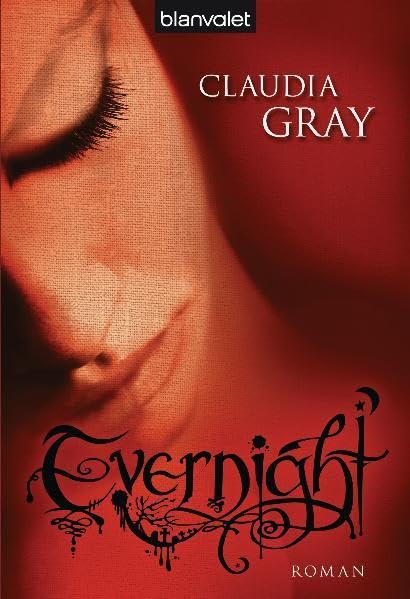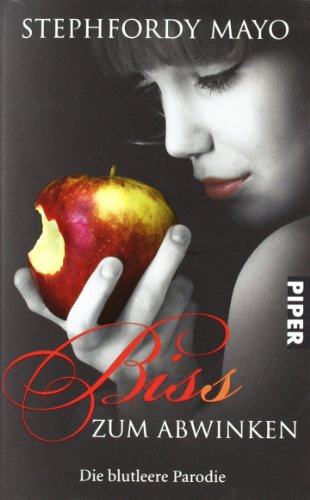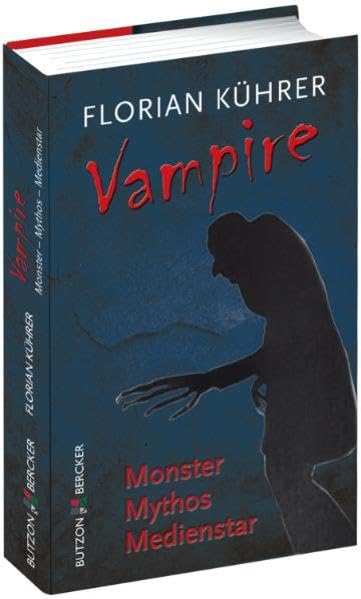„Dein Blut auf meinen Lippen“ klingt irgendwie nach einem süßlichen Liebesroman für die Hausfrau fortgeschrittenen Alters, die sich in ihrer Freizeit gern in die Arme eines gutgebauten (und doch romantisch veranlagten) Mannes träumt. Tatsächlich kommt man dem Kern der Sache näher, wenn man sich den amerikanischen Originaltitel ansieht, der ziemlich eindeutig benennt, worum es in dem Roman von Claudia Gabel geht: „Romeo & Juliet & Vampires“. Und damit ist eigentlich auch schon alles Wichtige gesagt. Erwähnenswert ist vielleicht außerdem, dass es sich um ein Jugendbuch handelt – erwachsene Leser sollten also keine tiefschürfenden Erkenntnisse erwarten, weder zu „Romeo und Julia“ noch zu Vampiren.
„Dein Blut auf meinen Lippen“ lässt sich dem gerade boomenden Genre des Mashups zuordnen. Die zugrundeliegende Idee ist, dass ein Autor sich einen existierenden Text vornimmt (in diesem Fall Shakespeares „Romeo und Julia“) und ihm ein neues (in der Regel fantastisches) Element hinzufügt – hier sind es Vampire. Dadurch erhält der eventuell angestaubte, da gemeinfreie, Text frischen Pepp und wird unter neuen Gesichtspunkten und mit anderen Schwerpunkten durch den Autor uminterpretiert. Das wohl bekannteste Beispiel für ein Mashup ist Seth Grahame-Smiths „Stolz und Vorurteil und Zombies“. Und ja, oftmals sind die Titel tatsächlich so einfallslos, wohl damit der geneigte Leser sofort erkennen kann, womit er es zu tun hat.
„Dein Blut auf meinen Lippen“ folgt also mehr oder weniger der Handlung von Shakespeares großer Tragödie, allerdings mit einigen tiefgreifenden Veränderungen. Zunächst einmal wird die Handlung nach Transsilvanien verlegt, was ziemlich seltsam wirkt, da trotzdem alle Personen italienische Namen tragen. Julia Capulet ist die Tochter einer ruchlosen und einflussreichen Vampirdynastie. In den vergangenen Jahren haben die Capulets mit Freude die transsilvanische Landbevölkerung buchstäblich ausgesagt, geduldet vom walachischen Landesfürsten Vlad. Dieser wurde nun jedoch gestürzt und sein Bruder Radu möchte für Frieden im Land sorgen. Deshalb verbietet er den Capulets, Menschen auszusaugen. Er verbietet ihnen auch bei Todesstrafe, mit ihren Erzfeinden, den Montagues, aneinanderzugeraten. Diese sind – kaum überraschend – Vampirjäger.
Die Capulets versuchen nun mit allen Mitteln, ihren Einfluss zu sichern. Dazu geben sie einen großen Ball, um Graf Paris zu umschwärmen und ihm ihre Tochter anzubiedern. Denn Paris genießt bei Radu großes Ansehen und könnte so die Interessen der Capulets vertreten. Doch Julia will von Paris nichts wissen. Sie ist ohnehin von ihrer Familie und deren fehlender Moral genervt. Zu ihrem sechszehnten Geburtstag wird sie sich in einen vollwertigen Vampir verwandeln, doch sie hadert mit ihrem Schicksal – schließlich will sie keineswegs Menschen töten! Die Situation spitzt sich zu, als sie auf dem Ball Romeo kennenlernt – einen Menschen und Vampirjäger. Die beiden verlieben sich sofort unsterblich und heiraten praktisch sofort. Doch kann eine Liebe zwischen Vampir und Vampirjäger Bestand haben? Kann Romeo akzeptieren, was aus Julia wird? Kann sie es selbst?
Keine Sorge, „Dein Blut auf meinen Lippen“ beantwortet all diese Fragen wohlwollend und in klarer Übereinstimmung mit den aktuellen Trends in der Vampirliteratur. Dass Claudia Gabel am Ende drastisch von Shakespeares Auflösung der Geschichte abweicht, ist vermutlich der größte Fauxpas, den sie sich leistet. Jugendliche Leser werden sicher begrüßen, dass Romeo und Julia schlussendlich nicht ihr Leben für die Versöhnung ihrer Familien aushauchen. Shakespeare-Fans werden wohl aufgrund solch schändlicher Abweichung vom großen Barden das Buch mit einem bitteren Nachgeschmack zuklappen.
Ansonsten kommt „Dein Blut auf meinen Lippen“ recht geradlinig daher: Alle wichtigen Handlungspunkte von Shakespeares Drama werden abgearbeitet: Das Fest, die Balkonszene, die Hochzeit, das Duell, Julias scheinbarer Tod. Abgearbeitet ist hierbei ein wichtiges Stichwort, denn oft hat man als Leser den Eindruck, vieles würde schnell und mit einigem Desinteresse abgehandelt. Dass sich Claudia Gabel entschlossen hat, ein Drama in einen Prosatext umzuschreiben, ist eine große Chance, die sie leider viel zu oft ungenutzt verstreichen lässt. Emotionen und Motive werden kaum ergründet, stattdessen dümpelt der Roman an der Oberfläche jugendlicher Liebe, ohne je wirklich tiefes Gefühl vermitteln zu können. Das liegt sicher auch an der sehr einfachen Sprache des Textes, der oftmals wie eine Schreibübung ohne einen Funken Inspiration klingt. So erscheint „Dein Blut auf meinen Lippen“ irgendwie unentschlossen: Auf der einen Seite verfährt der Roman mit der überlebensgroßen Vorlage lieblos und ohne rechte Sympathie. Andererseits gibt es zu wenige wirklich zündende Ideen der Autorin, die dem Stoff eine neue Richtung geben würden. Dadurch kann man sich nie ganz des Eindrucks erwehren, dass man auch einfach das Original hätte lesen können.
_“Dein Blut auf meinen Lippen“_ eignet sich sicherlich für jugendliche Leser, denen man Shakespeare schmackhaft machen will – Baz Luhrmanns farbenprächtige Verfilmung des Stoffes erzielt allerdings sicherlich denselben Effekt und vermittelt außerdem noch die Einzigartikeit des Shakespeare’schen Sprache – etwas, das Gabels Buch (bis auf wenige Zitate) komplett vermissen lässt. Für erwachsene Leser bietet der Roman wenig Spektakuläres und eignet sich höchstens für einen verregneten Nachmittag.
|Taschenbuch: 240 Seiten
Originaltitel: Romeo & Juliet & Vampires
ISBN-13: 978-3499257032|
[www.rowohlt.de]http://www.rowohlt.de