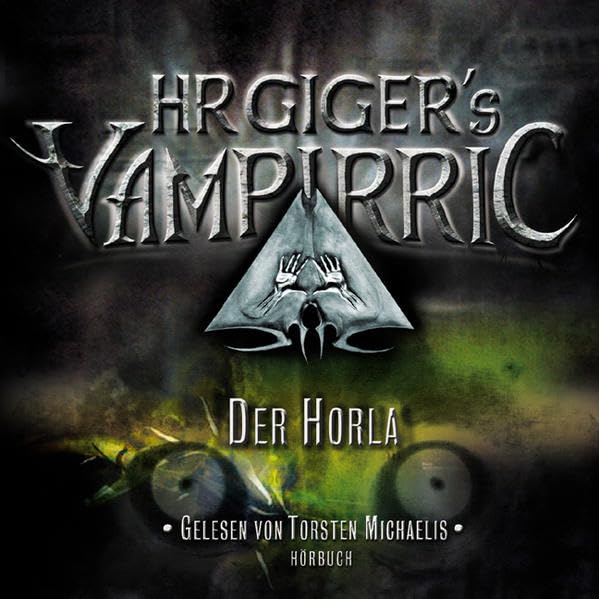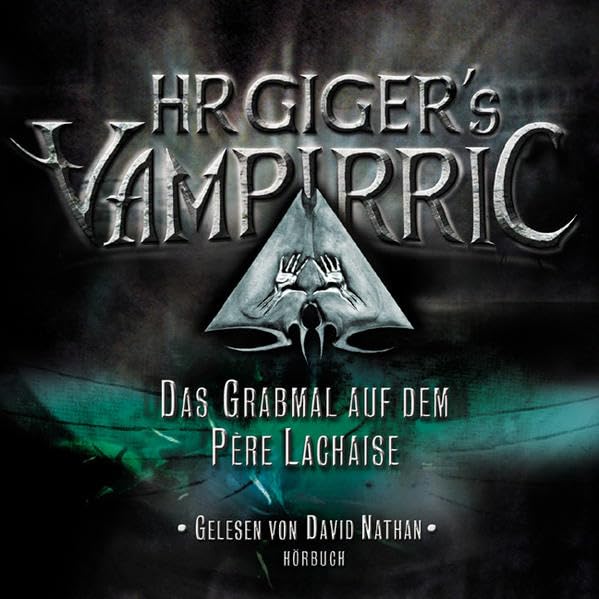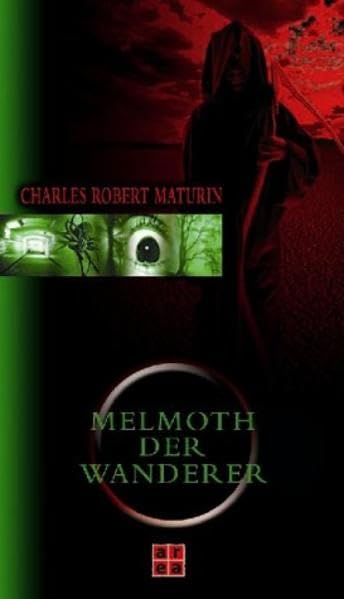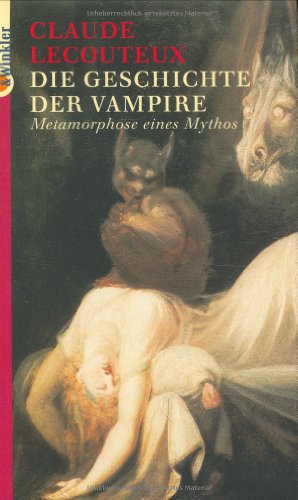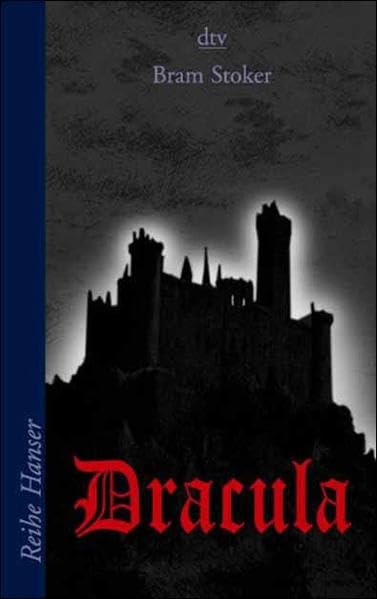Die letzte CD aus HR Gigers Viererpack „Vampirric“, einer Hörbuch-Anthologie mit Vampirgeschichten, bietet noch einmal ein echtes Erlebnis. Dem Gruselfreund wird hier nämlich Guy de Maupassants „Der Horla“ (frz. „Le Horla“, 1887) vorgelesen, ein Klassiker der Vampirliteratur und ein Schmuckstück psychologischen Grusels.
Man verfolgt die Tagebucheintragungen eines zunächst lebensfrohen und naturverbundenen jungen Mannes: Er wohnt am Fluss in einem Häuschen, winkt den vorbeifahrenden Schiffen und spatziert durch die Wälder. Doch diese Idylle wird immer mehr gestört, als sich unser Protagonist Jean zunehmend schlapp und unwohl fühlt. Er schäft schlecht und leidet unter Albträumen. Letztlich beschließt er, dass er sich auf eine Erholungsreise begeben sollte. Ein weiser Entschluss, denn bei seiner Rückkehr fühlt er sich gesund und wohl. Doch schon nach der ersten Nacht im eigenen Haus stellen sich die Symptome wieder ein. Bald vermutet er sogar, dass er schlafwandelt, da aus seinem Krug des Nachts Wasser verschwindet, ohne dass er sich erinnern kann, es getrunken zu haben. Er fürchtet, wahnsinnig zu werden, doch bemerkt er, dass sich etwas anderes in seinem Haus herumtreibt, ein Wesen, das ihn nachts heimsucht und sich offensichtlich von Milch und Wasser ernährt, andere Speisen aber verschmäht. Gleichzeitig entzieht es Jean offensichtlich die Lebensenergie und zwingt ihm seinen Willen auf. Dieser Horla, so stellt sich das Wesen im Laufe der Erzählung vor, ist offensichtlich Teil einer Rasse, die evolutionär über dem Menschen steht und sich ihn Untertan macht. Jean pendelt daraufhin zwischen Verzweiflung und Wahn; ein Versuch, den Horla zu vernichten, schlägt fehl. Mit der Ausweglosigkeit der Situation konfrontiert, bleibt Jean nur noch eine Möglichkeit, sich dem Zugriff des Wesens zu entziehen: der Selbstmord.
Guy de Maupassant (1850-1893) ist dem Liebhaber französischer Literatur sicher kein Unbekannter. Als frischgebackener Beamter machte er seine ersten zögerlichen Schritte in der Schriftstellerei, war aber mit seinem Debüt „Fettklößchen“ gleich so erfolgreich, dass er sich fortan nur noch dem Schreiben widmete und einer der beliebtesten Autoren seiner Zeit wurde. Er war mit so bekannten Namen wie Flaubert oder Turgenev bekannt, bei Maupassants Tod 1893 hielt kein Geringerer als Emile Zola die Grabrede. Maupassants Leben endete in Wahnsinn. Schon früh litt er an einer Nervenkrankheit, die die damalige Medizin nicht zuordnen konnte: Sehstörungen, Angstzustände, Depressionen und partielle Lähmungen stellten sich in Schüben ein. Als sein Bruder durch ein ähnliches Leiden im Wahnsinn starb, war für Maupassant klar, dass ihm das gleiche Schicksal blühen würde. Unter diesem Licht lässt sich „Der Horla“ auch als Maupassants Auseinandersetzung mit dem fortschreitenden Wahnsinn lesen. Jean fragt sich an mehreren Stellen, ob er denn wahnsinnig geworden sei. Anstatt das Unmögliche und Unglaubliche zu akzeptieren, zieht er zunächst den Gedanken vor, selbst nicht mehr zurechnungsfähig zu sein. Dann, als das Unmögliche unwiderruflich bestätigt ist, drängt ihn gerade diese Gewissheit weiter an den Rand des Wahnsinns. Die Vorstellung, der Mensch sei nicht die Krönung der Schöpfung und nur Sklave eines höheren Wesens, raubt ihm den Seelenfrieden. Jeans Ringen um sein inneres Gleichgewicht zeigt Maupassant unverblümt in den schmerzhaft glaubwürdigen Tagebucheintragungen des Geplagten.
Gelesen wird die Geschichte diesmal von Torsten Michaelis, der sonst Wesley Snipes seine Stimme leiht. Dass er damit offensichtlich hoffnungslos unterfordert ist, beweist er hier eindrucksvoll. Mit samtener Stimme zieht er den Hörer in seinen Bann und klingt dennoch mit zunehmender Sprechzeit (und zunehmendem Wahnsinn) gehetzter, unkontrollierter und gebrochener. Innerhalb der 78 Minuten des Hörbuchs kann er damit eine ungeheure Bandbreite beweisen – und das mit nur einer Geschichte!
Qualitativ liegt diese CD ungefähr gleichauf mit „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“, das sich auf dem dritten Hörbuch findet. Welche Geschichte letztendlich das Rennen macht, ist Geschmackssache, beide jedoch bieten eine spannende Studie über das Innenleben eines vermeintlich Wahnsinnigen. Wer nicht alle vier CDs der Sammlung kaufen will, sollte sich jedoch zumindest diese beiden anschaffen. Jeweils eine gute Stunde gepflegten Nervenkitzels und Gruselns sind garantiert.
Wer nach dem Genuss von „HR Giger’s Vampirric“ immer noch nicht genug von vampirischen Geschichten hat, der kann sich das dazu passende Buch (erschienen bei |Festa|) zulegen. Für die Hörbücher wurden nämlich nur einige Erzählungen ausgewählt (sechs insgesamt), die Anthologie selbst bietet noch eine ganze Reihe mehr, nämlich insgesamt 23 Geschichten.
Alle vier Hörbücher im Überblick:
[HR Giger’s Vampirric 1: 581
Thomas Ligotti „Die verloren gegangene Kunst des Zwielichts“ und
Horacio Quiroga „Das Federkissen“
[HR Giger’s Vampirric 2: 582
Leonard Stein „Der Vampyr“ und
Amelia Reynolds Long „Der Untote“
[HR Giger’s Vampirric 3: 583
Karl Hans Strobl „Das Grabmahl auf dem Père Lachaise“
HR Giger’s Vampirric 4:
Guy de Maupassant „Der Horla“