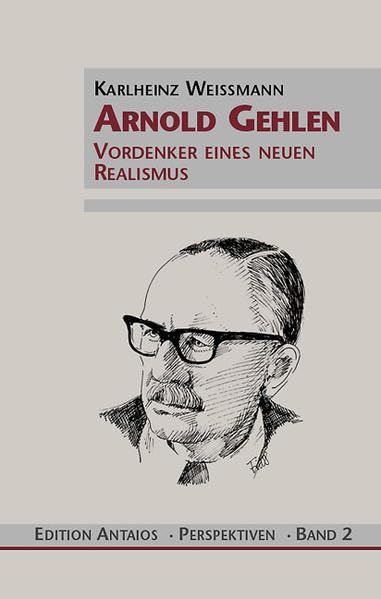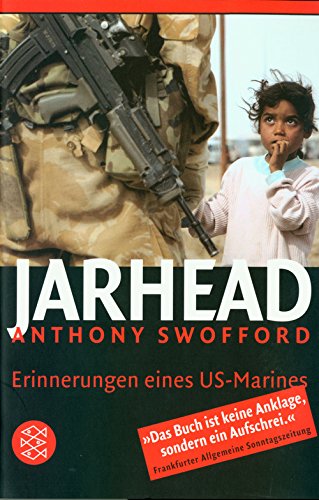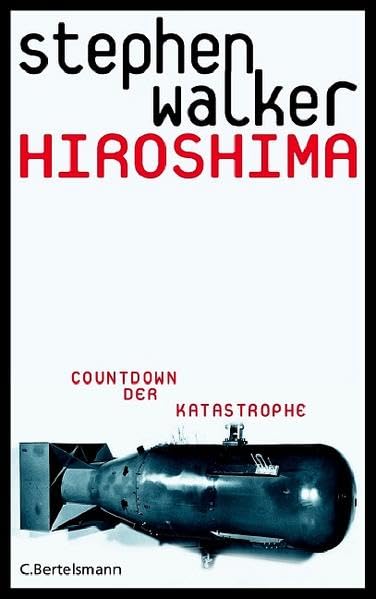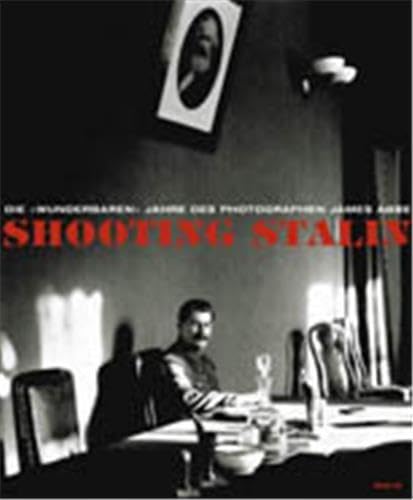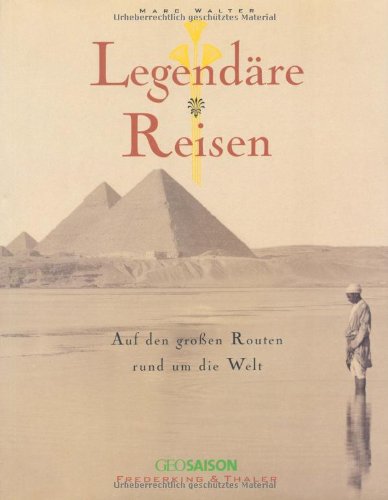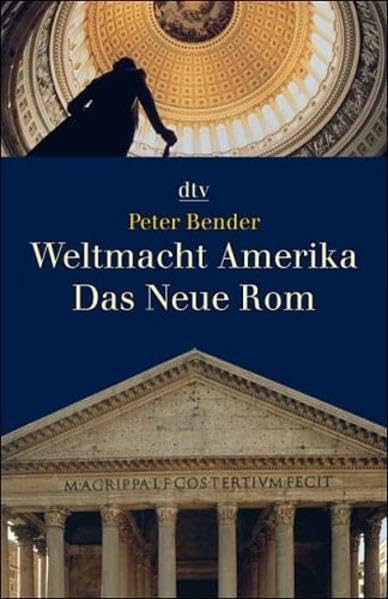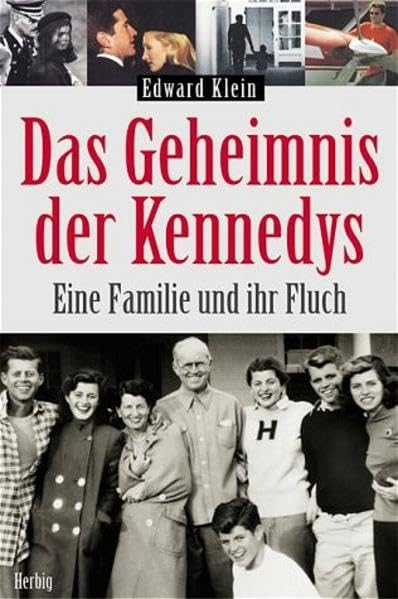Uns ist in alten maeren
Wunders viel geseit
Von helden lobebaeren
Von grozer arebeit
Von freuden, hochgeziten
Von weinen und von klagen
Von küener recken striten
Muget ihr nun wunder hoeren sagen.
Aus dem Nibelungenlied
Vor vier Jahren begann Worms damit, Nibelungenfestspiele (http://www.nibelungenfestspiele.de) durchzuführen und wurde im ersten Jahr bundesweit als Provinz noch sehr belächelt. Ab dem zweiten Festspieljahr sah das schon anders aus und in diesem Jahr lief es bislang am besten: Alle 13 Vorstellungen der Hebbel-Inszenierung vor dem Nordportal des Wormser Doms waren ausverkauft. Mehr als ausverkauft geht nun einmal nicht, aber über eine künftige Verlängerung von zwei auf drei Wochen wird nun nachgedacht.
Die rund 19.000 Zuschauer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz bejubelten das Stück von Karin Beier sowie das Starensemble um Maria Schrader, Joachim Król, Manfred Zapatka, André Eisermann, Götz Schubert und Wiebke Puls. „Eine solche Resonanz wie in diesem Jahr haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Die Festspiele 2005 verliefen sehr positiv, ich bin rundum zufrieden“, sagt Festspielintendant Dieter Wedel.
Worms kann stolz auf seinen Glanz und Glimmer sein, denn vor fünf Jahren war es ein großes Wagnis, ohne Staatstheater und entsprechende Infrastruktur Festspiele in dieser Größe zu starten. Die Organisation, die im Vergleich zu anderen Festspielstädten nur von wenigen Machern betrieben wird, läuft reibungslos. Die Wormser sind stolz auf ihre Festspiele und das ist wichtig, denn wenn Steuergelder ausgegeben werden, ist es notwendig, dass solch große Events von der Bevölkerung breit unterstützt werden.
Das Rahmenprogramm wurde in diesem Jahr stark aufgewertet und mit hochkarätigen Namen besetzt. Zu den Höhepunkten zählten Veranstaltungen mit Manfred Krug, Christian Quadflieg, Otto Sander und dem Kabarettisten Werner Schneyder. Die Besucherzahlen übertrafen alle Erwartungen: Knapp 6.000 Gäste kamen zu den Lesungen, Konzerten und den Theaterbegegnungen. Das Herrnsheimer Schloss wurde als zweite Festspielstätte hervorragend angenommen.
Die Vorhaben, Worms durch die Nibelungen touristisch aufzuwerten, sind vollkommen aufgegangen. Durch die Festspiele und auch die Nibelungen-Thematik, die sich durch das ganze Jahr hindurchzieht, kommen mehr und mehr Touristen in die Stadt.
In eine riesige VIP-Lounge verwandelte sich der romantische Heylshofpark rund um den Dom: Bunte Lichter, Wasserfontänen, der dunkelrote Drachenblutbrunnen und klassische Klänge sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre vor und nach den Aufführungen. Das elegante Ambiente zog
jeden Abend hunderte Besucher an. „Einfach sagenhaft“, lautete das Urteil der Gäste. Und mittlerweile zieht auch es auch viele Prominente von Salzburg über Bayreuth nunmehr regelmäßig nach Worms. Das Ambiente vorm Dom ist auch einzigartig. Die erscheinende Prominenz, die zu den Festspielen über sämtliche Aufführungen hinweg anreist, befindet sich natürlich auch immer im Blickpunkt der lokalen Presse, aber diese hier ausführlich zu benennen, erscheint mir nicht relevant. Jedenfalls gibt es bereits bei der Premiere, wie auch sonst allenorts üblich, einen breiten roten Teppich und jede Menge VIPs, umlagert von Fotografen. Der Medienrummel von rund 200 Medienvertretern bei der Premiere war schon sehr ungewöhnlich, zumal es sich ja „nur“ um eine Wiederaufführung der Hebbel-Inszenierung gehandelt hatte. Die Party nach der Premiere im festlich geschmückten, an den Dom grenzenden Heylspark ist mit all seinen Lichtern und Fackeln ein unvergleichliches Erlebnis, das man so nicht anderweitig zu sehen bekommt – weder in Salzburg noch in Bayreuth. Diese Party ging bis morgens um acht Uhr.
Trotz des verregneten Sommers blieb es in Worms während der Aufführungen die meiste Zeit trocken. Nicht eine einzige Vorführung mussten die Veranstalter – im Gegensatz zum Vorjahr – wegen schlechten Wetters absagen. Der Kampf mit dem Wetter – das zudem abends sowohl für die Schauspieler auf der Bühne als auch auf der hohen, windigen Tribüne für Sommerverhältnisse mitunter sehr kalt war – ist bei Freilichtspielen eine große Herausforderung. Einmal musste nach einem Regenbruch kurz vor der Pause fast abgebrochen werden – das Mikrofon von Kriemhild drohte den Dienst zu versagen –, aber auch hier gab es trotz diesen Widrigkeiten am Ende den gewohnten stürmischen Applaus. Doch diesmal applaudierten auch die Schauspieler umgekehrt dem Publikum und demonstrierten damit ihrerseits, dass auch diesem für das tapfere Ausharren Dank gebührte. Die Wormser Bevölkerung und die Sponsoren stehen zu ihren Nibelungen-Festspielen. Nach nur vier Jahren hat es Worms geschafft, sich bundesweit als Festspielstadt einen renommierten Namen zu erobern und als kultureller Leuchtturm zu etablieren.
Die Zuschauer saßen dieses Jahr noch einmal zwei Meter höher als letztes Jahr: auf einer 18 Meter hohen Tribüne, 26 Meter in der Breite. Für Rollstuhlfahrer wurden Rampen eingerichtet. Die normalen Preise rangierten von 25 Euro für die oberen Ränge bis zu 85 Euro für die untersten Plätze. Aber es gab auch Logen zu Preisen von 260 Euro für Einzelplatzkarten und 498 Euro für zwei Personen.
Im kommenden Jahr wird Dieter Wedel auf der Südseite des Doms „Die Nibelungen“ mit einem neuen Ensemble inszenieren. Angedacht ist eine überarbeitete Fassung von Moritz Rinke mit neu geschriebenen Szenen und Schwerpunkten. Die Geschichte endet in der Saison 2006 mit Siegfrieds Tod. Die grausame Rache der Kriemhild wird dann in der Fortsetzung des Stoffes im Sommer 2007 zu sehen sein.
So weit der Einstieg, aber schauen wir uns das Geschehen auch noch im Einzelnen an.
_Hebbel-Inzenierung der Nibelungen von Karin Beier_
In den bisherigen vier Jahren der Wormser Nibelungen-Festspiele mit unterschiedlichen Inszenierungen sahen insgesamt etwa 90.000 Zuschauer das Nibelungen-Drama. Seit zwei Jahren ist Dieter Wedel Intendant des Epos um Liebe und Hass, Politik und Rache am Originalschauplatz vor der atemberaubenden Kulisse des Wormser Doms. Dieses Ambiente ist theatertechnisch sensationell.
Karin Beiers Stück ist eine ernst zu nehmenden Inszenierung. Ihre Fassung ist intimer und konzentrierter als das Rinke-Stück der ersten beiden Festspieljahre. Ihr Hauptaugenmerk liegt auf den Frauengestalten und ist damit eine sehr andere Nibelungengeschichte als die von Moritz Rinke. Die Geschichte der Frauen im Stück ist viel intensiver und auch die dunkle Seite Siegfrieds wird mehr beleuchtet. Im Grunde haben alle männlichen Schauspieler bei Beier neben den mitreißend intensiven Damen Maria Schrader und Wibke Puls einen schweren Stand. Sonstige Identifikationsmöglichkeiten gibt es da fast keine. Erstmals war dieses Jahr die Inszenierung tontechnisch zudem in Dolby Surround zu hören. Durch Highend-Digitaltechnik mit einem 5.1-Surround-System wurde die eindrucksvolle Inszenierung akustisch rundum erlebbar.
Dabei sind die Protagonisten in Worms auch für die Bevölkerung ansprechbar. Soweit es die aufwendigen Proben und fast täglichen Auftritte erlauben, integrieren sie sich in das städtische Leben, und vor den Vorführungen finden täglich abwechselnd mit allen lockere Talkgespräche bei freiem Eintritt für das interessierte Publikum statt.
Man sieht sie also zwar ständig in der Stadt, aber bei diesen Gesprächen hat man die Gelegenheit, ganz nah an die Darsteller heranzukommen und „live“ etwas über ihre Arbeit auf der Dombühne, aber auch viel „Privates“ zu erfahren. Die Schauspieler zeigen sich dem Publikum und allen Beteiligten dankbar: So fand ein Besuch der Mitarbeiter in der Wäscherei der Lebenshilfe statt, wo man sich bei den Behinderten bedankte, welche die anfallende Wäsche während der Festspielen waschen, trocknen und pflegen. Bei 13 Aufführungen werden alleine schon circa 1.100 Kostümteile gebügelt. Für die Behinderten selbst war das ein großes Ereignis, stolz zeigten sie, wie sie arbeiten, und manch einer brachte auch seine persönlichen Nibelungen-Sammelstücke mit zum Vorzeigen. Auch für den Weltladen waren sie aktiv und kamen zu dessen mit dem entwicklungspolitischen Netzwerk Rheinland-Pfalz organisierten „Nibelungen-Brunch“, wo ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten, Musik und Stars zum Anfassen aufgeboten wurden.
Da die Festspiele immer nahtlos in das danach beginnende Bachfischfest – eines der größten Volksfeste am Rhein – übergehen, unternahmen die Schauspieler auch einen gemeinsamen Rundgang über den Festplatz. Diese Führung übernahm André Eisermann, der aus einer Wormser Schaustellerfamilie stammt und das Backfischfest von klein auf sehr intim kennt. Nicht dabei sein konnte Hagen-Darsteller Manfred Zapatka, der als Einziger länger als geplant in Worms verweilen musste. Während der Festspiele hatte er bereits große Schmerzen im Knie, lehnte schmerzstillende Mittel bei den Vorführungen allerdings ab, damit er „unvernebelt“ auftreten konnte. Sofort nach Ende der Festspiele musste er im Wormser Krankenhaus am Meniskus operiert werden und benötigte noch Schonung; die erste Zeit konnte er natürlich nur an Krücken gehen. Das zeigt aber auch ein eigentliches Problem, denn wenn ein Schauspieler generell mal bei den Festspielen ausfällt, steht keine Zweitbesetzung zur Verfügung. Im Vorjahr zum Beispiel war auch schon Wiebke Puls bei den Proben in eine Bühnenöffnung gestürzt und hatte sich „glücklicherweise“ dabei nur das Nasenbein gebrochen. Der damals nachfallende Joachim Kròl blieb unverletzt. Das Ensemble stand trotzdem einige Tage unter Schock.
_Dieter Wedel_
Seit mehr als einem Jahr ist Dieter Wedel Intendant der Festspiele. Er promovierte an der Freien Universität Berlin in den Fächern Theaterwissenschaften, Philosophie und Literatur. Unzähligen Theatererfahrungen folgten eine kurze Zeit als Hörspielautor und dann Engagements fürs Fernsehen sowie erste Filme: „Einmal im Leben“ war der erste TV-Mehrteiler, womit die Erfolgsstory der Familie Semmeling begann. Es folgte die Fortsetzung „Alle Jahre wieder“ und dann gründete er seine eigene Produktionsfirma. Seitdem ist er Autor, Regisseur und Produzent in einer Person. Neben den großen Fernsehproduktionen wie „Kampf der Tiger“ oder „Wilder Westen inclusive“ bleibt er weiterhin Theaterbühnen treu. Für seine TV-Mehrteiler „Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“ und „Die Affaire Semmeling“ erhielt er auch international zahlreiche Auszeichnungen. 2002 inszenierte er die Nibelungenuraufführung von Moritz Rinke. Danach wurde er Intendant der Wormser Festspiele.
_Karin Beier_
Sie ist renommierte Theater- und Opernregisseurin. Begonnen hatte sie mit einer eigenen Theatergruppe und führte Shakespears Dramen im Original und unter freiem Himmel auf. Dann folgten eine Regieassistenz am Düsseldorfer Schauspielhaus und seither eigene Arbeiten. Sie inszenierte die deutsche Erstaufführung von „Die 25. Stunde“ von George Tabori sowie Shakespeares „Romeo und Julia“, für das sie 1994 zur Nachwuchsregisseurin des Jahres gewählt wurde. 1995 erarbeitete sie mit vierzehn Schauspielern aus neun Ländern eine mehrsprachige, multikulturelle Inszenierung des „Sommernachttraums“. 1997 schloss sich mit Bizets „Carmen“ ihre erste Oper an. Es folgten unter anderem „99 Grad“, „Das Maß der Dinge“ und „Der Entertainer“. Dieses Jahr inszenierte sie mit kleinen Veränderungen zum zweiten Mal in Worms ein neues Stück nach der klassischen Textvorlage von Friedrich Hebbel. Karin Beier, die, wenn sie nicht arbeitet, ganz alternativ im Norden Schottlands lebt und kleine Lämmer auf die Welt holt, schaut auf ihre zwei Jahre Festspielzeit in Worms gerne zurück. Nachdem sie vor zwei Jahren noch Bedenken hatte, mit Schauspielern aus unterschiedlichsten Sphären des Films und Theaters zu arbeiten, hat sich alles für sie „extrem gelohnt“ und die Ängste waren unbegründet. Keiner des Ensembles hat Starallüren, und nach einem Jahr nach Worms zurückzukommen, war dieses Mal wie eine Heimkehr.
_Maria Schrader_
Sie ist wohl eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen heutzutage. Sie begann ihre Ausbildung am Max-Reinhard-Seminar in Wien. Dann spielte sie an Schauspielhäusern unter anderem in Hannover und Bonn. Ihr Kinodebüt gab sie mit „Robby, Kalle, Paul“. Bekannt wurde sie dann mit Doris Dörries Komödie „Bin ich schön?“. 1999 erhielt sie den Silbernen Bären und den Deutschen Filmpreis für ihre Rolle in „Aimée und der Jaguar“. Von Anfang an spielt sie in Worms die Kriemhild.
_Wibke Puls_
Ausbildung an der Berliner Hochschule der Künste. Danach Schauspielhaus Hamburg. Sie spielt auf mitreißende Art seit Beginn der Festspiele die Brunhild. Vor ihrer Schauspielkarriere machte sie Musik, was sie in den letzten beiden Festspieljahren für die Wormser durch ihren einzigartig intensiven Konzertauftritt mit dem Festspielensemble auch unter Beweis stellt. Sie tritt in Beiers Stück mit nacktem Oberkörper auf, was dieses Jahr in der „Regenbogen-Presse“ für Aufsehen sorgte. „Bild“-Zeitungsüberschrift mit entsprechendem Foto: „Brusthild und die Nippelungen“. Selbst die „Münchner Abendzeitung“ meldete „Die nackten Nibelungen in Worms“. Trotz der kargen Bekleidung hat sie die aufwendigste Maske bei den Aufführungen, denn in der ersten Hälfte vor ihrer Verheiratung mit Gunther trägt sie am ganzen Körper amazonenwilde Tattoos. In der aktuellen Inszenierung der Nibelungen von den Münchner Kammerspielen spielt sie interessanterweise anstelle der Brunhild die Kriemhild und erhielt dafür den Alfred-Kerr-Darstellerpreis.
_Manfred Zapatka_
Ausgebildet an der westfälischen Schauspielschule Bochum, danach an Theatern wie Stuttgart und München engagiert. Er ist einer der großen Charakterdarsteller im deutschen Film und Fernsehen, bekannt z. B. aus der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ (1989) und in Dieter Wedels Mehrteiler „Der große Bellheim“ (1992). Für die Rolle des Heinrich Himmler in „Das Himmler-Projekt“ (2002) wurde er mit dem Adolf-Grimm-Preis ausgezeichnet. Bei den Nibelungen-Festspielen trat er als Hagen auf. Auffallend war beim Publikumsgesprächsabend mit ihm sein politisches Engagement. Zwar rief er nicht direkt zur Wahl der Linkspartei auf, übte aber starke Kritik an der SPD, für die er früher immer eintrat.
_André Eisermann_
Mit der Rolle des „Kaspar Hauser“ wurde Eisermann 1993 aus dem „Nichts“ heraus international bekannt. Er wurde dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so z. B. mit dem Darstellerpreis des Internationalen Filmfestes von Locarno, dem Bayrischen Staatspreis und dem Deutschen Filmpreis. Danach folgte der ebenso grandiose Film „Schlafes Bruder“. Für diese Rolle war er für den Golden Globe nominiert. Seitdem er den Bundesfilmpreis bekam, ist er Akademie-Mitglied der Bundesfilmpreisverleihung. Allerdings ist er auch durch verschiedene Lesungen sehr bekannt geworden. Seit Beginn der Wormser Nibelungenfestspiele hatte er die Rolle des Giselher inne. Derzeit spielt er in Füssen im Musical „Ludwig II.“ dessen Bruder Otto. Als Wormser ist er seit seiner Kindheit mit dem Nibelungenthema vertraut, und selbst wenn er im nächsten Jahr nicht mehr zur Besetzung gehören wird, gibt es wie bisher etwas Neues von ihm im Rahmenprogramm der Festspiele. Im nächsten Jahr wird es endlich auch wieder einen großen Film mit ihm geben, ein Projekt, über das bislang aber nirgendwo etwas verraten wird.
_Joachim Król_
Als einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands wird er nach wie vor hauptsächlich mit seiner Rolle im Film „Der bewegte Mann“ von 1994 identifiziert, den er nach seinen Engagements an deutschen Theatern spielte. Für die dortige Rolle des leidenden Norbert Brommer an der Seite von Til Schweiger erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, so etwa den Bambi und den Deutschen Filmpreis. Danach folgten „Rossini“ und, ebenfalls zusammen mit Maria Schrader, der Film „Bin ich schön?“ von Doris Dörries. Auch internationale Filmprojekte folgten („Zugvögel … einmal nach Inari“ und „Gloomy Sunday – Ein Lied von Liebe und Tod“). Als Commissario Brunetti spielte er in Donna Leons Fernsehkrimis und war zuletzt im Kino als Killer in „Lautlos“ zu sehen. In Worms spielte er den König Gunther.
_Götz Schubert_
Er studierte an der staatlichen Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Zunächst Theater auf den Bühnen in Berlin, dann zahlreiche Fernsehproduktionen wie „Der Zimmerspringbrunnen“, „Die Affaire Semmeling“ von Dieter Wedel und der Kinofilm „NAPOLA“. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Für die Wormser ist er mittlerweile der „klassische“ Siegfried-Darsteller geworden und spielte diese Rolle schon bei der modernen Interpretation von Moritz Rinke in den ersten beiden Festspieljahren. Im letzten Jahr fiel er aus, wurde aber für die Wiederauflage des Beierschen Hebbel-Stückes erneut als Siegfried verpflichtet und ersetze Martin Lindow, der zuletzt den Siegfried spielte. Die Siegfried-Rolle bei Beier ist weniger männlich angelegt als die des kahlköpfigen Haudegen bei Rinke. Zuletzt drehte Schubert mit Veronika Ferres den ZDF-Zweiteiler „Neger, Neger, Schornsteinfeger“, davor stand er für Dieter Wedels Zweiteiler „Papa und Mama“ vor der Kamera, der im Januar 2006 im Fernsehen zu sehen sein wird. Im Maxim-Gorki-Theater in Berlin spielt er aktuell neben Jörg Schüttauf in der „Dreigroschenoper“ und als nächstes ebenfalls dort im „Zerbrochenen Krug“ den Dorfrichter.
_Tilo Keiner_
Er war auf der London Academy of Music and Dramatic Art. Neben verschiedenen Theaterengagements (u. a. Trier, Nürnberg und Köln, Hamburg, Bochum, Nürnberg) ging er auch zum Film und Fernsehen, z. B. für TV-Serien wie „SOKO 5113“ oder „Girlfriends“. Dann spielte er im Film „Saving Private Ryan“ unter der Regie von Steven Spielberg. Auch im deutschen Film „Der Ärgermacher“ war er zu sehen. Derzeit gastiert er auch als Musicaldarsteller Harry im ABBA-Stück „Mamma Mia!“ in Stuttgart. Bei den Nibelungen spielte er den Werbel an Etzels Hof und war damit dieses Jahr neu im Ensemble. Er ersetzte die Rolle von Andreas Bikowski (den Werbel vom letzten Jahr).
_Isabella Eva Bartdorff_
Sie spielte die skurrile Tochter Rüdigers und glänzte an der Seite von André Eisermann, der sie als Giselher in diesem Stück heiraten sollte, ganz besonders. Sie studierte Schauspiel an der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und war bereits an Theaterhäusern in Hamburg, Frankfurt, Essen, Bonn und Darmstadt.
_Itzhak Fintzi_
Er gilt in Bulgarien als Superstar und spielte vorm Wormser Dom auf seine charismatische Art den König Etzel. Dass er viele Passagen auf Bulgarisch spricht, macht seine Rolle besonders atmosphärisch.
_Sebastian Hufschmidt_
Er gibt den Gerenot, den Bruder des Königs Gunther. Er spielte an Theatern u. a. in Düsseldorf, Braunschweig und Hannover.
_Josef Ostendorf_
An Schauspielhäusern spielte er in Hamburg, Basel und Zürich. Bekannt ist er auch aus Fernsehfilmen wie „Wolffs Revier“, „Die Männer vom K3“, „Tatort“, „Bella Block“ und „Adelheid und ihr Mörder“. Mehrere Kinofilme sind auch darunter, z. B. „Der Campus“. Bei den Nibelungenfestspielen ist er von Anfang an dabei und spielte in den ersten beiden Jahren den Königsbruder Gernot. Bei Katrin Beier hatte er dagegen die Rolle des Volker von Alzey.
_Michael Wittenborn_
Er spielte an Theatern Hamburg und München. Für Dieter Wedel spielte er im Fernsehen u.a. „Der Schattenmann“, „Der große Bellheim“ und „Die Affaire Semmeling“. Bei den Festspielen spielte er den Markgraf Rüdiger von Bechelarn und ist der Ehemann der Regisseurin Karin Beier.
_Wolfgang Pregler_
Lernte an der Hochschule für Künste in Berlin. Schauspielerfahrung an den Theatern München, Berlin und Hamburg. Ebenso Film- und Fernsehproduktionen wie „Die Affaire Semmeling“ in der Regie von Dieter Wedel (2001) und der internationale Kinofilm „Rosenstraße“ mit Maria Schrader (2003). Auch er gehört zur Urbesetzung und spielte in den ersten beiden Jahren den König Gunther, bei Karin Beier allerdings Dietrich von Bern. Er stammt von den Münchner Kammerspielen.
Nach der letzten Vorstellung, die wie gewohnt mit langem Schlussapplaus endete, drückte Karin Beier jedem Schauspieler ein Glas Sekt in die Hand und es gab zahlreiche Küsschen zu sehen. Auch als die Zuschauertribünen dann leer waren, ging es nochmals gemeinsam auf die Bühne, um Abschied von der großartigen Kulisse vor dem Kaiserdom zu nehmen. Darauf folgte die Abschiedsparty mit Livemusik und einer Stimmung aus Heiterkeit und Melancholie. Lange Umarmungen und auch Tränen, denn dieses Ensemble, das sich menschlich so gut verstand, wird in dieser Zusammensetzung nie wieder zusammenkommen. Dieter Wedel hat angekündigt, für die nächsten Inszenierungen neue Schauspieler nach Worms zu schicken.
_Ein Blick auf die Statisten_
Ohne die Wormser Statisten, die jedes Jahr den Sommer für Proben und Aufführungen opfern, wären die Festspiele nicht vollständig. Es sind viele Wormser involviert, und das bereitet ihnen großen Spaß. Auch eine Hundemeute ist dieses Jahr mit auf der Bühne gewesen, und manche davon haben nach den Festspielen ein neues Herrchen bei den Statisten gefunden.
Manche entpuppen sich dabei als Neueinsteiger mit Karriere-Erwartungen im Schauspielbusiness. Seit dem ersten Festspieljahr besteht einmal im Monat ein regelmäßiger Statistenstammtisch. Trotz der intensiven, fast unbezahlten Arbeitszeit, ist es für alle ein Genuss, mit Größen wie Dieter Wedel oder früher Mario Adorf als Hagen gearbeitet zu haben. Mitunter erscheinen dort auch die Regieassistenz und der künstlerische Leiter der Festspiele, James McDowell.
_Ilka Kohlmann_
Hatte in den ersten beiden Jahren als Statistin angefangen und spielt nun bereits zum zweiten Mal die Mutter von Gudrun. Zwar hat sie nur einen Kurzauftritt, aber natürlich ist jeder Abend auch für sie ein großes Erlebnis, steht sie doch auch beim Schlussapplaus vor stehenden Ovationen mit auf der Bühne. Auch ihr Ehemann Jürgen ist immer dabei, in diesem Jahr als „Hunnen-Trommler“. Auch im nächsten Jahr werden beide wieder gefragt sein.
Ein kleiner Wormser Junge freut sich auch jedes Jahr ganz besonders auf seine Rolle. Er spielt das Kind von Kriemhild und Etzel, auch wenn er anschließend stets geköpft und verstorben die Bühne verlässt.
Dreißig Hunnen sind im Einsatz als Statisten, und deren Maske ist von den Professionellen zeitlich nicht zu bewältigen. Dafür wurde eigens ein Schminkwettbewerb ausgeschrieben und acht Wormser Frauen wurden ausgewählt. Auch für Kostüme und Waffen sind Wormser zuständig. Waffenmeister ist dabei Thomas Haaß, der im Zuge der Nibelungenthematik und der daraus entstanden Gewandeten-Szene ständig in Worms mittelalterlich mitmischt.
_Das Rahmenprogramm:_
_Filme_
Jedes Jahr gibt es ein begleitendes Filmprogramm, aber man kann nicht jedes Jahr die Nibelungen von Fritz Lang oder die Filme aus den 60er Jahren aufführen, und so zeigt man bereits im zweiten Jahr aktuelle Filme aus dem Wirken der Festspielschauspieler. Das waren diesmal Maria Schrader, die zusammen mit Dani Levy in „Meschugge“ die Jüdin Lena Katz spielte, einem Thriller, für den sie für ihre Rolle 1999 den Bundesfilmpreis als beste Hauptdarstellerin erhielt. Joachim Król spielt in „Gloomy Sunday“ eine Dreiecksgeschichte im Budapest der 30er Jahre während der Besetzung durch die Nazis. Und Manfred Zapatka spielte in der Komödie „Erkan und Stefan“ den Verleger Eckenförde, dessen Tochter von den beiden Komikern beschützt werden soll. Die Filme laufen auf großer Leinwand im Open-Air-Kino im Herrnsheimer Schloss. Mit gewöhnlichem Popcorn-Kino hat das also nichts zu tun. Man wird von Festpiel-Hostessen empfangen und steht vor und nach der Aufführung an Stehtischen bei einem Glas Wein zusammen.
_Otto Sander, die Nibelungen-Musiker und die Trommler von Worms_
Otto Sander und Gerd Bessler, der musikalische Leiter der Wormser Hebbel-Inszenierung, gestalteten einen „Heldenabend“ mit Texten und Musik, gespielt vom gesamten musikalischen Ensemble der Festspiele und unterstützt von fünfundzwanzig Trommlern. In den Texten hörte man die Gegensätzlichkeit der Helden durch die Epochen und Länder, und vor allem die Musik war natürlich ein Hörgenuss, in welchem mittelalterliche Motive mit modernen Jazzelementen verschmolzen. Eine Hör- und Augenweide waren vor allem auch die Wormser Trommler, die auf Stahlfässern und Landknechtstrommeln archaische bombastische Rhythmen schlugen. Über neunhundert Besucher sahen sich das an.
_Werner Schneyder und das Ensemble der Nibelungen-Festspiele lesen Richard Wagner_
Der bekannte Kabarettist und Sportmoderator führte durch die Handlung von Wagners „Der Ring des Nibelungen“, und die Schauspieler der Festspiele lasen die Texte. Wahrscheinlich wurde noch nie der ganze „Wagner-Ring“ in so kurzer Zeit in straffer Form dargeboten. Faszinierend waren tatsächlich auch die von Schneyder dargebotenen originalen und ausführlichen Regieanweisungen Wagners, die schmunzeln ließen, da diese selbst mit modernster Technik bis heute unrealisierbar geblieben sind. Auch diese Veranstaltung war ausverkauft, allerdings sicher weniger wegen des Wagner-Themas, sondern als Sympathie-Kundgebung der Wormser für „ihre“ Stars. Es kamen fast neunhundert Besucher.
_Theaterbegegnungen im Herrnsheimer Schloss_
Diese Veranstaltung hat bereits gute Tradition bei den Festspielen und stellt in der Vielseitigkeit des Programmablaufs einen der interessantesten Aspekte im Rahmenprogramm, den man nicht versäumen sollte. Das sehen sehr viele Besucher mittlerweile auch so. Zu den Morgenvorträgen kamen weit mehr als erwartet – man rechnet für solche wissenschaftlich-literarischen Vorträge normalerweise mit einem Interesse von 30 bis 40 Personen, aber die 150 Sitzplätze waren schnell besetzt und weitere etwa 50 standen noch draußen vor der Tür. Teils im schönen Saal des Schlosses, teils unter freiem Himmel, teils in der Remise, treffen sich Zuschauer und Künstler, Politiker, Wissenschaftler, Vertreter aus Kirche und Wirtschaft, um miteinander zu diskutieren, zu lachen und zu streiten. Eine einzigartige intime Gelegenheit, richtig nahe an die VIPs herantreten zu können. In diesem Jahr war das Thema „Was ist deutsch?“.
In den Morgenvorträgen beleuchtete Kulturkoordinator Volker Gallé Literatur und Politik als deutsches Dilemma, Monika Carbe referierte über den Missbrauch von Schiller als Nationaldichter und Gunther Nickel sprach anhand einer Zuckmayer-Rezipation über das Deutschlandbild vom Ersten Weltkrieg bis zur Gründung der Bundesrepublik und wies dabei fast nebenbei die Zuordnung von Ernst Jünger als rechtsgerichteten Autor vom Tisch. Dabei stellte er auch fest, dass dies der Stand der aktuellen Jünger-Forschung sei.
Für die Programmpunkte danach reichte natürlich der Platz mit dem wunderschönen englischen Park dahinter für alle aus – aber auch hier war die Remise dennoch gefüllt bis auf den letzten Platz. Mittags folgten Texte über die Deutschen, gelesen von den Festspiel-Darstellern, von Tacitus bis Willy Brandt – ein sehr aufschlussreiches intensives Erlebnis zum Deutschsein. Höhepunkt war wie schon im letzten Jahr der Auftritt von Wiebke Puls (Brunhilde) mit umgeschnalltem Akkordeon (und meist Zigarette im Mundwinkel) und Itzhak Fintzi (König Etzel), die mit dem Festspiel-Ensemble für ihre eigenen musikalischen Interpretationen der Hebbel`schen Nibelungentexte faszinierten und begeistern konnten. Sehr intim und locker startete bereits der Auftritt: „Hallo, wir sind hier, um ein bisschen Musik zu machen“. Cello, Geige, Trompete und viele subtile Schlaginstrumente präsentierten eine experimentelle musikalische Avantgarde. Die Zuschauer lieben es, wenn Wiebke Puls ins Mikrophon erbärmlich schreit, faucht und haucht. In der Zugabe kam auch Maria Schrader (Kriemhild) auf die Bühne und beide sangen anstatt des bekannten Königinnenstreits die mitreißend zärtliche Version einer Liebeshommage der Königinnen („You are so beautiful“) zueinander und lagen sich danach unter stürmischen Applaus in den Armen. Abgeschlossen wurde mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Was ist deutsch?“ mit Hark Bohm (Filmemacher), Dieter Wedel (TV- und Filmregisseur, Intendant der Festspiele) und Prof. Paul Nolte von der Universität Bremen.
_Jugendblasorchester Rheinland-Pfalz spielte zeitgenössische Kompositionen aus aller Welt und Joern Hinkel las dazu deutsche Reden und Aufsätze aus sechs Jahrhunderten_
Joern Hinkel ist Regieassistent von Dieter Wedel und las Texte von Deutschen über Deutsche, Thesen und Antithesen, Beschwerden, Aufrufe, Zornausbrüche, Gedichte und Gesetzestexte, lächelnd, tobend und analytisch. Dazu gab es zeitgenössische Musik, die von der Heimat erzählte.
_Peer Gynt_
Einer der weiteren Höhepunkte war die Darbietung des Festspielschauspielers André Eisermann, der mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Edward Griegs Schauspielmusik zu „Peer Gynt“ darbot. Das war eine seltene Gelegenheit, die originale Bühnenmusik gelöst vom literarischen Ursprung zu erleben. Neben der Philharmonie waren auch der Wormser Bachchor und „Cantus Novus“ sowie die Sopranistin Caroline Melzer integriert, die zusätzlich das Lied der Solveig sang. Der rote Faden der Schauspielhandlung wurde durch Zwischentexte nachvollziehbar. Den Part der Titelfigur übernahm André Eisermann und machte wie gewohnt seine Lesung zum Erlebnis. Ob nun Goethes Werther oder das Hohelied der Liebe – mit denen er früher Lesungen gab –, schafft er es immer, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Er rezitiert nämlich nicht, sondern verkörpert das, von dem er spricht. Seine jährlichen Vorstellungen im Begleitprogramm der Festspiele sind in Worms seit jeher stets ausverkauft. Aber auch Eva Bartdorff, die ebenfalls Texte las, war ihm ebenbürtig.
_Musikwettbewerb_
Für dieses Jahr hatten die Festspiel-Veranstalter eine ganz besondere Idee und riefen zu Beginn des Jahres zu einem Musikwettbewerb auf, wo jeder Nibelungensongs einreichen konnte. Aus über 50 Liedern wählte eine Jury, bestehend aus SWR, der Popakademie Mannheim und den Festspielen, zehn Bands aus. Diese spielten an zwei Abenden je 30 Minuten Programm und das Spektrum reichte dabei von Reggae, Rap, Pop und Rock über Volksmusik, Country und Dark Wave bis zur Klassik. So verschieden die Stilrichtungen waren, umso unterhaltsamer waren entsprechend auch die Beiträge zum Nibelungen-Thema.
Eine CD dazu ist auch erhältlich, auf der alle ausgewählten Bands „ihren“ Nibelungen-Song präsentieren. Ein Beiheft enthält alle Texte und die Anschaffung macht Freude und ist auch sehr günstig. Die „Musikwettbewerb – Nibelungen-Festspiele Worms“-CD kostet nur 5 Euro und ist erhältlich über info@nibelungen-museum.de.
Enthalten darauf ist auch der Song ‚Siegfried‘ von _Corpsepain_, welche auf der Schwesternseite von |Buchwurm.info|, |POWERMETAL.de|, mit ihrer dunklen Saga-Interpretation des Nibelungen-Themas rezensiert wurden: [„The Dark Saga of the Nibelungs“.]http://www.powermetal.de/cdreview/review-6242.html Sie schlugen sich auch recht gut im Vergleich zu anderen Bands, und wenn ich mich nicht ganz täusche, stieß ich mit meinen Freunden während ihres Auftritts auf „Friedrich“ an (Nietzsche versteht sich). Auch diese CD ist für 9,99 Euro zu beziehen unter info@nibelungen-museum.de.
Das Abschlusslied der CD, ‚Brunhilds Klage‘, stammt von _Weena_, die die besten Interpreten auf dem Festival waren und auch in der Publikumsgunst ganz oben stehen. Sie beschlossen, nachdem sie beim Wettbewerb ausgewählt wurden, eine ganze Rockoper zu den Nibelungen zu verfassen und spielten daher auch ein reines Nibelungen-Set. Thomas Lang ist Rockmusiker und Sylva Bouchard-Beier ausgebildete Opernsängerin. Wie sie zueinander fanden, ist auch eine besondere Geschichte. Thomas kam, um seine Stimme bei ihr ausbilden zu lassen und beide merkten schnell, dass der Crossover aus Rock und Klassik begeistert. Ihre Musik, die in melodischen Passagen in ihrer Heiterkeit an Elemente von |Goethes Erben| erinnert, im Zusammenklang des Beats mit opernartiger Klangfülle aber eher Bands wie |Therion| zuzurechnen ist – und damit natürlich auch an Wagner erinnert –, hat auch wegen der stimmlichen Leistung von Sylva etwas von |Rosenstolz|. Bislang wird die pompöse Zusatzmusik noch durch Synthesizer eingespielt, aber der Auftritt mit einem großen Orchester ist geplant und durch die Zusammenarbeit mit der Festspiel GmbH auch nicht mehr utopisch. Den ersten Teil der Rockoper, „Das Nibelungenlied – Von Betrug, Verrat und Mord“, gibt es bereits auf CD, nächstes Jahr wird der zweite Teil folgen. Auch diese CD ist relativ günstig über das Nibelungen-Museum für 13 Euro zu erwerben: info@nibelungen-museum.de.
Das Festival nannte sich „Coole Sounds für Kriemhild, Hagen & Co.“ und war den Besuch wert. Leider aber waren im Gegensatz zum anderen Rahmenprogramm der Festspiele die beiden Musikfestival-Tage sehr mager besucht, was darauf schließen lässt, dass im nächsten Jahr dieses neue Experiment gestrichen wird. Das wäre sehr schade, denn die Idee war gut und ein Musikfestival ist sicher ein wichtiger Baustein, der einfach noch eine Chance bräuchte, sich zu etablieren. Dass dagegen _Weena_ in einem eigenen Konzert ihre Oper aufführen dürfen, ist mehr als sicher, so umfeiert, wie sie in der lokalen Presse wurden.
_Kikeriki-Theater_
Im dritten Jahr ist dieser Programmpunkt bereits ein durchgehend ausverkaufter Renner während der Festspiele. Das Darmstädter Kikeriki-Theater bot mit „Siegfrieds Nibelungenentzündung“ ein sagenhaftes Blechspektakel um Siggi, Albi und den smarten Lindwurm im Hessen-Dialekt: deftig, heiter und krachig.
_Weiteres Programm_
Nicht nur Nibelungen waren Thema des Rahmenprogramms. Die neue städtische [Literaturinitiative,]http://www.worms.de/deutsch/leben__in__worms/kultur/literaturinitiative-worms__teilnehmer.php der auch |Buchwurm.info|-Schreiber Berthold Röth angehört, trug mit Lesungen bei: _Manfred Krug_ las Bertolt Brecht, _Christian Quadflieg_ las Friedrich Hebbel (immerhin hatte dieser auch das Nibelungen-Festspiel ursprünglich verfasst) und gerne möchte er in einer künftigen Inszenierung einmal den Hagen spielen; _Eva Menasse_ las aus ihrem Debüt-Roman „Vienna“.
Diese Lesungen kosten natürlich Eintritt, aber die_ [Nibelungenlied-Gesellschaft]http://www.nibelungenlied-gesellschaft.de/ _veranstaltete während der gesamten Festspiele morgens um elf Uhr im Historischen Museum kostenlose Vorträge zum Nibelungenthema, die in diesem Jahr den Stoff im Rahmen der europäischen Literaturgeschichte betrachteten. Das Heldenepos ist zweifelsfrei eingebettet in eine europäische Kulturtradition. Das Publikum dafür ist gemischt, es kommen sowohl Wormser als auch Festspielbesucher der Stadt, die sich mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Die Vorträge haben wissenschaftlichen Anspruch, sind aber auch für den Laien verständlich gehalten. Im Einzelnen:
„Untergangsszenarien an der Wende zur neuen Zeit – das Nibelungenlied und Hamlet“
„Die Nibelungen in Hebbels Briefen“
„Höfische Heldendichtung im Umfeld des Nibelungenliedes“
„Fantasien von Germanen und Kelten – Fouqués „Held des Nordens“ und Macphersons „Ossian“
„Rüdiger und Dietrich im Nibelungenlied und bei Hebbel“
„Das Nibelungenlied und die Märchen“
„Die Nibelungen als Fantasy-Stoff“ und
„Die Geburt des Rechts aus der Rache – Orestie und Nibelungenlied im Vergleich“.
Normalerweise werden diese Vorträge auch auf die angegebene Website gestellt, jedenfalls findet man dort auch die Vorträge früherer Jahre.
Alles Weitere auch noch en detail aufzuzählen, sprengt den Rahmen dieses Überblicks. Es gab noch mehrere verschiedene Märchenabende mit Harfenbegleitung, Theater-Aktionstage für Kinder und Jugendliche, neben dem Kikeriki-Theater noch weitere neue Kindertheaterstücke um Drachen und Ritter. Da die Festspiele in die Ferienzeit-Programme fallen, gab es darüber hinaus von vielen kleineren Anbietern Thematisches zu Siegfried und den Nibelungen. An weiteren Musikveranstaltungen spielten „Il Cinquecento“ im Dominikanerkloster Musik der Renaissance und „Capella Antiqua Bambergensis“ mittelalterliche Musik. An Ausstellungen zum Nibelungen-Thema gab es gleich vier an verschiedenen Orten: „Siegfriede – Auf der Suche nach Helden unserer Zeit“ (sehr freie, moderne Interpretationen im Kunsthaus und im Historischen Museum), „Bilder zum Nibelungen-Buch im ARUN-Verlag von Linde Gerwin und Nibelungenskulpturen von Jens Nettlich“ (Nibelungen-Museum) – http://www.nibelungenkunst.de/ – und in der Sparkasse eine Bilderreise zu den Schauplätzen des Nibelungenliedes aus dem |dtv|-Buch „Wo Siegfried starb und Kriemhild liebte“.
Für die Wormser Bevölkerung gibt es eineinhalbstündige Backstage-Vorführungen hinter den Kulissen, die einen Blick auf die Masken, das Anprobieren etc. erlauben und durch das tolle Ambiente mit dem Wormser Dom sowieso sehr außergewöhnlich sind. Die Sakristei des Gotteshauses ist abends sogar plötzlich zur Garderobe umfunktioniert, in welcher hektisch die Bekleidung gewechselt wird. Die kirchlichen Vertreter sind da auch ganz ambivalent, sie erlauben wohlwollend das ganze Spektakel, sind aber auch kritisch, dass ihre christliche Kulisse jährlich zur Todesbühne wird, wo ein Schrecken und Schauer auf den anderen folgt.
Neben den Schauspieler-Talkrunden gab es auch ähnliche kleine Gespräche vor Publikum mit sonstig im Rahmenprogramm Tätigen, wie Christian Quadflieg, der ja seinen persönlichen Hebbel in einer Veranstaltung präsentierte. Ebenso mit Otto Sander, auch einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler („Die Blechtrommel“, „Das Boot“, „Der Himmel über Berlin“), der über sich und sein Leben sprach, was der SWR live im Radio übertrug.
_Ausblick_
2006 noch nicht, aber 2007 werden die Festspiele eine Woche länger gehen. Das Rahmenprogramm wird noch weiter ausgebaut und qualitativ gesteigert werden. Dieter Wedel will auch während der Festspiele eine Art „Meisterschule“ mit Workshops für Theaternachwuchs aus der Region aufmachen. Dazu wird mit den umgebenden Theatern Kontakt aufgenommen und auch das jeweilige Festspiel-Ensemble eingebunden. 2006 hat auch ein Jugendtheaterprojekt seine Premiere.
An Inszenierungen gibt es in den nächsten beiden Jahren wieder das Stück von Moritz Rinke, das in den ersten beiden Festspieljahren aufgeführt wurde. Mit diesem hatten die Wormser Festspiele 2002 begonnen und es war erstmals wieder eine ganz neue Fassung der Nibelungen. Dies wird nun aber in der Länge stark erweitert, so dass 2006 der erste Teil zur Aufführung kommt und erst 2007 der zweite Teil folgt. Regie wird dann auch wieder Dieter Wedel selbst führen. Die Besetzung des Ensembles soll zur Auflockerung allerdings eine völlig andere sein. Otto Sander ist als Hagen im Gespräch, aber Manfred Zapatka ist gigantisch und schwer ersetzbar. Bleiben werden wohl Maria Schrader als Kriemhild und Götz Schubert als Siegfried. Ein Schauspieler-Team von der Güte des jetzigen Ensembles zusammenzustellen, ist ein großes Problem. Auch soll die Besetzung viel größer sein als dieses Jahr.
Für die Zeit danach denkt man an ein Nibelungen-Musical, die „Nibelungen“ zumindest mit großer Musikbegleitung, wenn nicht sogar an eine Rock-Oper. Selbstverständlich würde für die Rolle des Siegfried dann ein bekannter Rocksänger verpflichtet. Im Ideenspektrum Wedels für das Rahmenprogramm ist auch „Das Leben des Siegfried“ – eine Collage aus Pantomime, Liedern und Szenen, ausschließlich auf Siegfried bezogen, comicstripartig. Nicht umsonst erinnert der Arbeitstitel an Monty Python`s satirischen Filmklassiker „Das Leben des Brian“. Götz Schubert schlägt im Beiprogramm ein Kammerstück vor, in dem geschildert wird, was in den sieben Ehejahren zwischen Kriemhild und Siegfried passiert – „Szenen einer Nibelungenehe“. Oder auch, welche Verbindungen zwischen Siegfried und Brunhild bestehen, schon vor ihrem Zusammentreffen, bei dem sie von den Burgundern getäuscht wird. Die Möglichkeiten für zusätzliche Geschichten in der eigentlichen Sage sind endlos. Das Hebbel-Stück als Inszenierung ist für die nächsten Jahre jedenfalls zu den Akten gelegt.