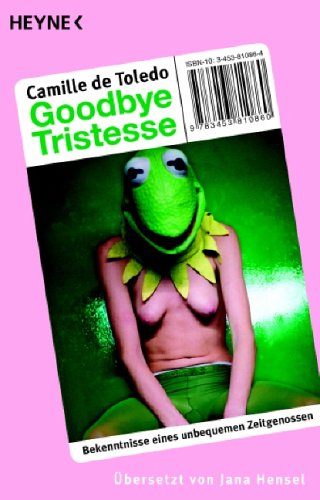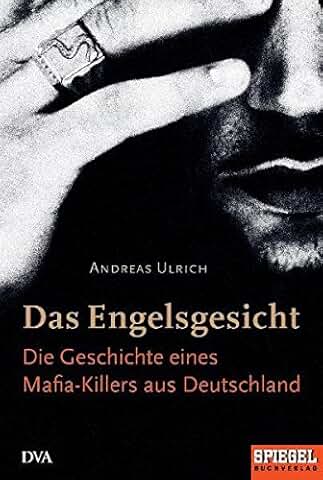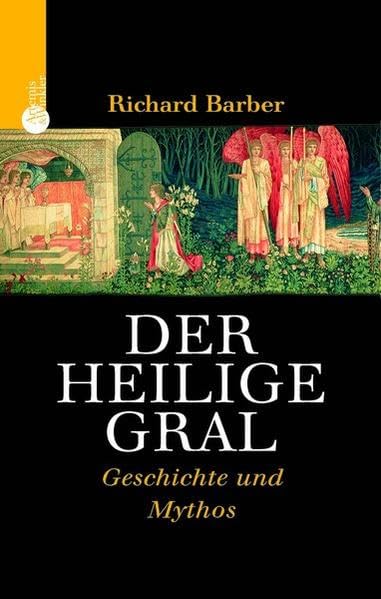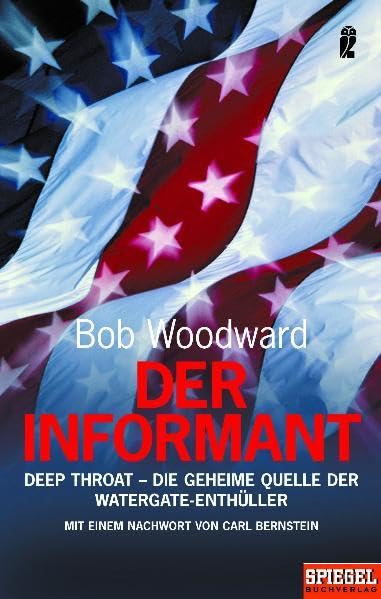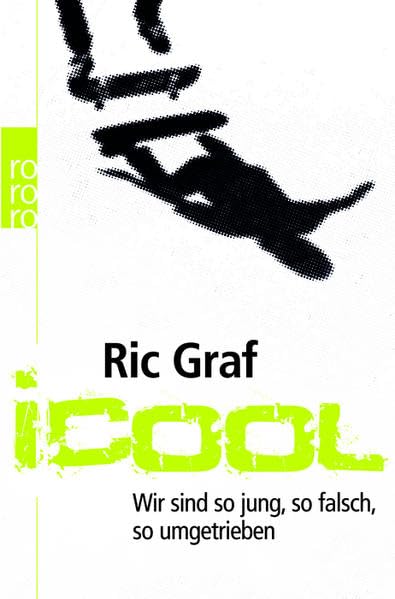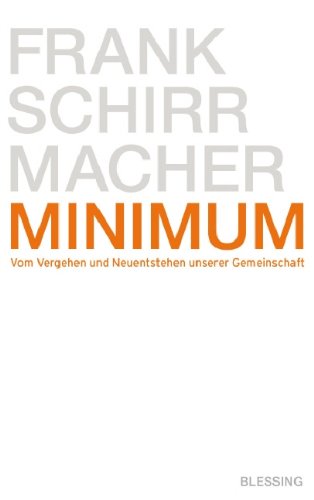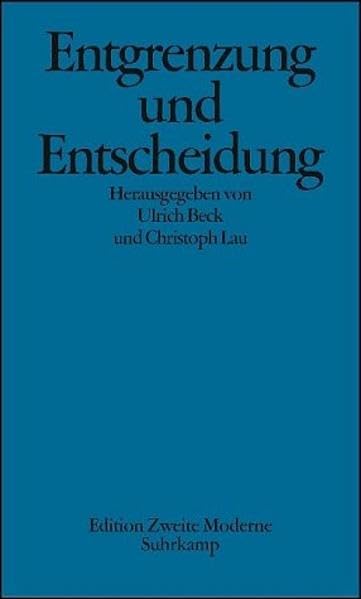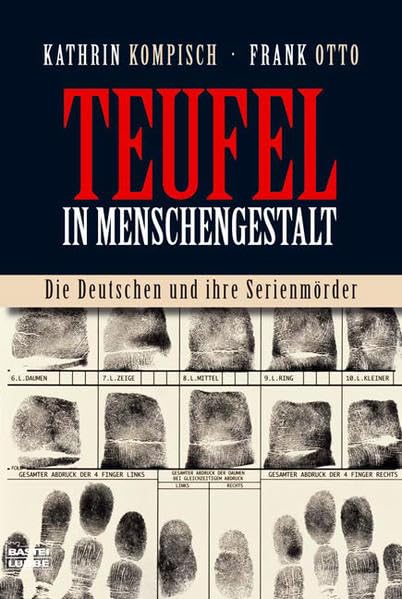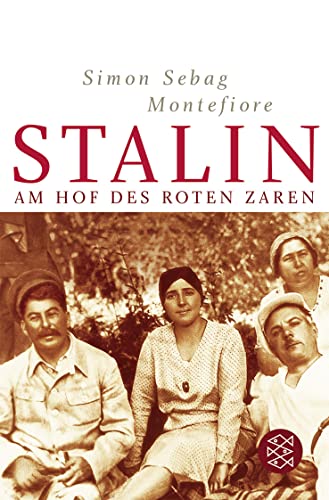Belgien, 28. Mai 1996: Die zwölfjährige Sabine fährt wie jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule. Sie ist früher dran, die Straßen sind noch leer. Plötzlich hält ein Lieferwagen neben ihr und ein Mann zerrt sie und das Rad hinein. Alles geht so schnell, das sich das kleine, schmächtige Mädchen kaum wehren kann. Während ein Mann fährt, verabreicht der andere dem Kind Medikamente, um es zu betäuben. Sabine wird nach zwei Stunden Fahrt in ein unordentliches Haus gebracht und in ein Kellerverlies gesperrt.
Ihr Entführer ist der wegen Vergewaltigung vorbestrafte Marc Dutroux, ein Kinderschänder und Mörder, der bereits vier Mädchen vor ihr dort gefangen gehalten und bis zu deren Tod missbraucht hat. Sabine ist sein neues Opfer. Achtzig Tage lang wird sie im Keller gefangen gehalten. Sie darf sich kaum waschen, erhält oft ungenießbares Essen und wird jeden zweiten Tag missbraucht und vergewaltigt. Ihr Peiniger behauptet, ein gefährlicher „Chef“ habe eine Rechnung mit ihrem Vater offen und wollte sie entführen. Dutroux habe sie angeblich vor ihm gerettet und sie müsse nun bei ihm bleiben, damit er nicht erfährt, dass sie noch am Leben ist. Immer wieder erzählt er dem verängstigten Kind, dass er sie schützen wolle und der „Chef“ sie noch viel schlimmer behandeln würde.
Trotz ihres Misstrauens schenkt Sabine ihm Glauben. Sie hasst und beschimpft ihn zwar für den Missbrauch, den er ihr antut, doch sie glaubt, dass er ihre Eltern wie behauptet informiert hat und diese ihr übermitteln, dass sie ihm gehorchen soll. Sabine ahnt nicht, dass ganz Belgien verzweifelt nach ihr sucht und Dutroux alles nur erfunden hat, um sie zu beruhigen. Stattdessen verfasst sie traurige Briefe an ihre Eltern, die sie nie erreichen. Nach über siebzig Tagen Gefangenschaft bringt Dutroux ein zweites Mädchen in ihr Verließ: Die vierzehnjährige Laetitia soll ihre neue Freundin werden. Sie erleidet das gleiche Schicksal wie Sabine. Nach achtzig Tagen gelingt den Behörden endlich die Festnahme von Dutroux und die Befreiung der beiden Mädchen. Doch das Leiden ist nicht vorbei. Es kommt zu einem Aufsehen erregenden Prozess, der international Schlagzeilen macht …
Wohl kaum jemand ist Ende der Neunzigerjahre am Fall Marc Dutroux vorbeigekommen. Die spektakulären Entführungen und die Bergung der beiden letzten lebenden Opfer gingen um die Welt. Fast zehn Jahre nach ihrer Entführung hat Sabine Dardenne ein Buch über ihr Schicksal verfasst, das nicht nur die Erlebnisse während der Gefangenschaft, sondern auch noch den Prozess und die Verurteilung im Jahr 2004 schildert.
|Mitgefühl und Bewunderung|
Sie will kein Mitleid, sagt Sabine spät im Buch, doch als Leser kann man nicht anders, wenn man ihre ergreifende Geschichte liest. Der rasche Einstieg lässt die Entführung auf offener Straße miterleben, ebenso das Martyrium im Keller, die unhygienischen Umstände und den Missbrauch. Sabine ist ein ganz normales Mädchen, als sie in den Fängen von Dutroux landet.
Sie ist klein und schmal für ihr Alter, aber sie ist ein trotziges, energisches Kind, das bis zum Schluss nicht aufhört, sich zu wehren. Sie ist weder eine Musterschülerin noch ist sie immer artig. Im Gegenteil, sie streitet sich oft mit ihren Eltern und ihren Schwestern, sodass nach ihrem Verschwinden zunächst die Vermutung aufkam, sie sei einfach davongelaufen. In Wahrheit erlebt sie achtzig grausame Tage, die sie nur mit eisernem Willen durchsteht.
Dutroux schlägt sie nicht, doch das ist auch schon das Einzige, was man ihm zugute halten kann. Ihr Verlies ist dreckig, die Schlafmatratze mit Insekten übersäht, statt einer Toilette gibt es nur einen Eimer, einmal die Woche wird sie von Dutroux gewaschen. Wochenlang trägt sie die gleiche Unterhose, ihre Kleidung starrt vor Dreck. Zu essen gibt es oft nur verschimmeltes Brot und kalte Konserven. Sabine schlägt die Zeit mit Briefeschreiben, mit Zählen und Malen tot. Ein winziges Dachfenster ist der einzige Kontakt zur Außenwelt.
Etwa jeden zweiten Tag nimmt Dutroux sie in sein Schlafzimmer, wo er Pornofilme laufen lässt und das Kind missbraucht. Schließlich vergewaltigt er sie und Sabine muss nicht nur starke Schmerzen, sondern auch tagelange Blutungen erleiden. Immer wieder bettelt sie um Freilassung, doch er wiederholt unermüdlich die erfundene Geschichte, die ihn als Retter darstellt. In all der Zeit weiß Sabine nur, dass sie durchhalten wird und leben will. Auch wenn sie kaum noch Hoffnung hat, ihre Familie wiederzusehen, ergibt sie sich nicht in ihr Schicksal. Sie beschimpft ihren Peiniger und wehrt sich, so gut es ein zierliches Kind eben kann, um sich den Stolz zu bewahren.
|Von Schuld und Sühne|
Eine besondere Perversion im Fall Dutroux liegt darin, dass nicht der Entführer und Kinderschänder, sondern sein Opfer bis heute mit Schuldgefühlen kämpfen muss. Je länger ihre Gefangenschaft dauert, desto einsamer fühlt sich Sabine. Daher bettelt sie immer wieder um eine Spielkameradin, um Besuch von Freundinnen. Da sie nicht ahnt, dass Dutroux sie bei weitem vor niemandem schützt, sondern sie gezielt entführt hat, glaubt sie, es sei nicht ausgeschlossen, dass ein gleichaltriges Mädchen ihr Gesellschaft leisten kann, ohne ihr Schicksal zu teilen.
Tatsächlich bringt Dutroux siebzig Tage nach ihrer Entführung die vierzehnjährige Laetitia mit; wie sie am helllichten Tag gefangen genommen. Er betäubt und missbraucht auch sie und steckt sie in das dreckige Verlies. Zwar weiß Sabine heute, dass sie keine Schuld an Laetitias Entführung trägt. Vielmehr hatte Dutroux bereits früher paarweise Mädchen gefangen gehalten, so die achtjährigen Melissa und Julie sowie die siebzehn- und neunzehnjährige An und Eefje. Während Melissa und Julie zur Zeit einer Haftstrafe, die er verbüßen musste, im Kerker verhungerten, wurden An und Eefje betäubt und anschließend lebend begraben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er sich ein zweites Mädchen zu Sabine holen würde, doch bis heute nagt der Gedanke an der jungen Frau, dass ihr Wunsch nach einer Freundin auf so perverse Weise erfüllt wurde und ein weiteres Leben zerstörte.
|In seine Augen sehen|
Im Jahr 2004 war es soweit, dass Sabine Dardenne als Zeugin beim Prozess auftrat und mehrmals Gelegenheit hatte, Marc Dutroux gegenüberzutreten. Sabine nutzt diese Möglichkeiten, sie spricht ihn offen im Gericht an, konfrontiert ihn mit Vorwürfen, lehnt seine halbherzige Entschuldigung ab. Noch ein weiteres Mal begegnet sie ihm, bei der Besichtigung ihres einstigen Verlieses, bei der auch Laetitia und die Geschworenen teilnehmen. Beide jungen Frauen machen keinen Hehl aus ihrer Verachtung gegenüber dem Mann, der ihnen ihre Unschuld geraubt hat, in jeglicher Hinsicht.
Trotz der Erleichterung über diese Konfrontation, bei der sie ihren Gefühlen Luft machen kann, bringt der Prozess gleichzeitig auch große Belastung mit sich. Sabine muss sich mit Zweiflern auseinandersetzen, die glauben, dass ihre Aussagen unzuverlässig sind, weil sie vermuten, dass Dutroux das Kind unter Drogen setzte. Schon im Vorfeld herrschte großer Tumult um die Verhandlung, da etliche Zeugen unerwartet verstarben. Die Angeklagten, neben Dutroux seine Frau und weitere Komplizen, beschuldigen sich gegenseitig und der erste Untersuchungsrichter wurde wegen angeblicher Befangenheit abgesetzt. Die Vorwürfe mehren sich, dass hohe Beamten- und Regierungskreise in die Affäre verstrickt sind, das Misstrauen der Bevölkerung wächst zunehmend. Zu allem Überfluss vertritt das zweite überlebende Opfer Laetitia die Ansicht, dass Dutroux nur ein Täter einer großen Kette von Kinderschändern war, während Sabine ihn für einen Einzeltäter hält.
|Eindrucksvolles Portät|
Dem betroffenen Leser bietet sich die Darstellung einer beeindruckenden jungen Frau dar, die gelernt hat, mit ihrem schweren Schicksal umzugehen und dabei teilweise recht ungewöhnliche Wege gewählt hat. Sabine verzichtete auf psychologische Hilfe, sie ist trotz ihres Traumas in der Lage, Beziehungen zu führen und hat die Medien seit jeher gemieden. Bereits kurz nach ihrer Befreiung überraschte sie die Polizeibeamten durch ihre körperliche wie seelische Stärke und ebenso ihre Familie. Es ist irritierend aber auch bemerkenswert zugleich, dass sie auch weiterhin ihrem sturen und eigensinnigen Charakter treu bleibt. Die Gefangenschaft hat sie nicht gebrochen.
Auch nach ihrer Rückkehr in den Schoß der geliebten Familie gibt es dort die gleichen Konflikte wie vor ihrer Entführung über Schule, Hilfe im Haushalt, Bevorzugung der älteren Schwestern. Das mag verwundern, zeigt aber andererseits, dass Sabine sich nicht auf eine lange Schonzeit berufen hat, sondern sich bemühte, so rasch wie möglich wieder am normalen Leben teilzunehmen.
Ihre einfache, direkte Sprache lädt dazu ein, das Buch in einem Rutsch zu verschlingen, eine Mischung aus Entsetzen und Respekt hervorrufend. Für besondere Betroffenheit sorgen die Auszüge aus den intimen Briefen, die sie im Verlies an ihre Eltern schrieb und die als wichtiges Beweismaterial im Prozess dienten. Es sind die Worte eines gequälten Kindes, das sich trotz allen Leids noch an seinen einstigen Alltag klammert, nach Geschenken der Schwestern und ihren Haustieren fragt, im nächsten Satz darum bittet, Dutroux dazu zu bringen, mit seinen Taten aufzuhören und den Leser damit mitten ins Herz trifft. Im Grunde gibt es nur einen Kritikpunkt, nämlich das Fehlen jeglicher Bilder. Nicht umsonst mussten die Geschworenen das Haus und den Kerker vor Ort besichtigen, um sich eine annähernde Vorstellung zu machen. Auch für den Leser wäre es gut gewesen, ein paar der Fotos, die durch die Medien gingen, hier vorzufinden.
_Als Fazit_ bleibt ein intensives Buch über die Erlebnisse eines Entführungs- und Missbrauchsopfers und einen Fall, der weltweit Schlagzeilen machte. Sabine Dardenne präsentiert sich als bewundernswerte und starke junge Frau, deren Schicksal berührt, bewegt und aufrüttelt, angenehmerweise ohne dabei unnötig auf die Tränendrüse zu drücken. Schade ist lediglich, dass auf Fotos verzichtet wurde.
http://www.droemer-knaur.de