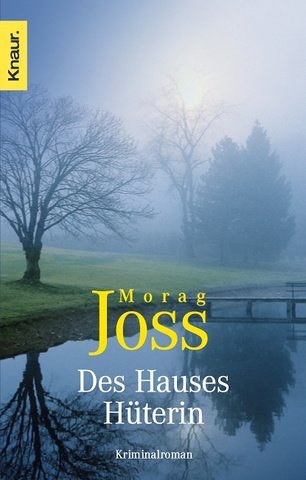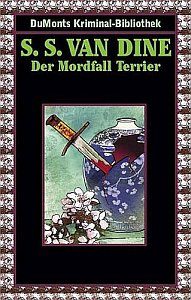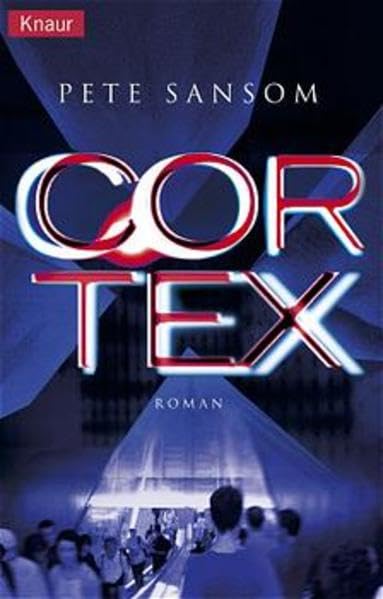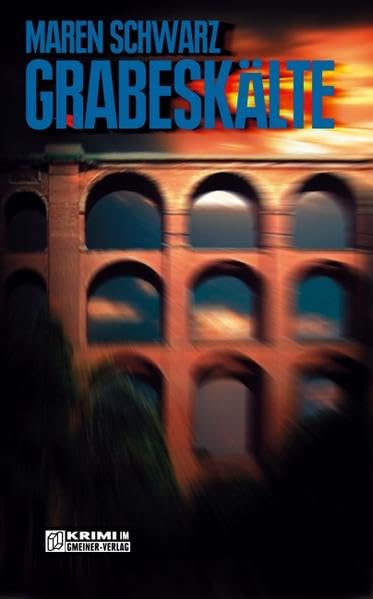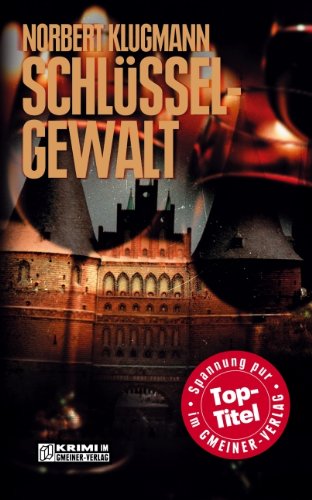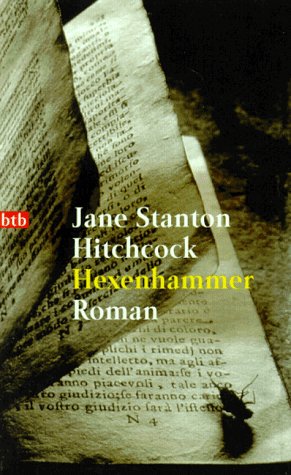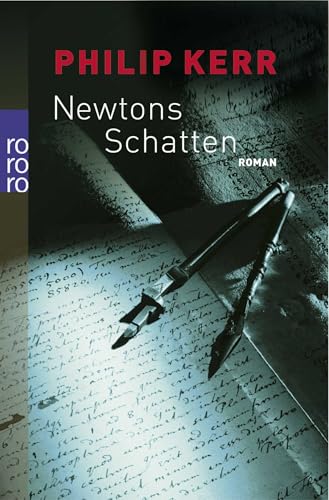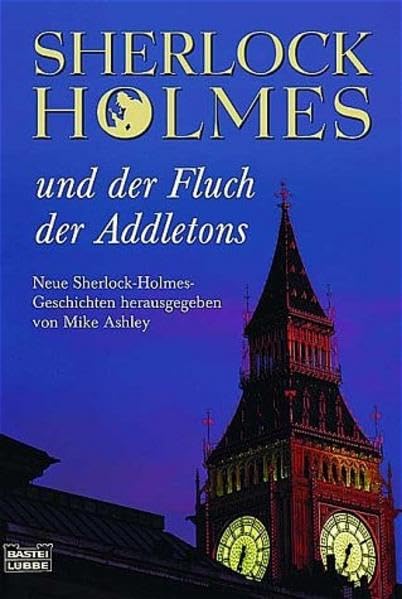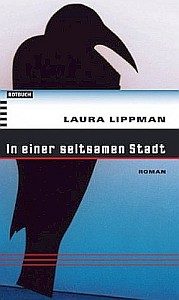Der neue Fall beginnt spektakulär aber trügerisch: Detective Inspector John Rebus von der Kriminalpolizei Edinburgh und sein Chef Frank Lauderdale verfolgen zwei junge Männer, die angeblich die Tochter von Lord Provost gekidnappt haben. Die Jagd endet im Desaster; Rebus und Lauderdale verunglücken mit dem Wagen, die in die Enge getriebenen „Entführer“ – die keineswegs taten, wessen man sie verdächtigt – stürzen sich lieber in den Tod als ins Gefängnis zu wandern.
Rebus kann diesen Vorfall nicht verwinden. Er stellt Nachforschungen an, die wie üblich seine Vorgesetzten missmutig stimmen, sobald die Spur in höchste politische und wirtschaftliche Kreise weist. Offenbar arbeiten Beamte wie besagter Lord Provost – aber nicht nur er – mit großen Konzernen zusammen. Gewaltige Fördergeldsummen und Privilegien werden zweckentfremdet, um Schottland in eine Hard- und Softwareschmiede zu verwandeln.
Schleunigst wird Rebus auf einen anderen, weniger brisanten Fall angesetzt. Vor den Augen des Stadtrats Tom Gillespie hat sich der Ex-Sträfling Hugh McAnally mit einer Schrotflinte den Schädel vom Hals gesprengt. Im zunächst verärgerter Rebus erwacht Eifer, als er entdeckt, dass auch Gillespie zur Gruppe der Verschwörer gehört. Anscheinend sollte er eindringlich gewarnt werden, denn der Stadtrat beginnt offenbar die Nerven zu verlieren.
Für Rebus kommt es knüppeldick. Er ist den inneren Kreis der Verschwörer inzwischen zu nahe gekommen. Der Polizeichef selbst tanzt nach deren Pfeife. Rebus wird „beurlaubt“, was ihn jedoch nicht abhält, auf eigene Faust seine Nachforschungen fortzusetzen. Er öffnet den Deckel zur Büchse der Pandora. Dort lauern keine Monster, sondern die eiskalten Großspekulanten einer globalisierten Oberschicht, die sich an die Gesetze und Regeln der „normalsterblichen“ Bürger nicht gebunden fühlen. Sie schicken Rebus keine Schläger auf den Hals, sie haben ganz andere, erschreckende Möglichkeiten, um ihren Gegner „legal“ auszuschalten.
Freilich kennen sie John Rebus nicht. Dessen Privatleben ist wieder einmal ein Chaos, und die Angst, seinen Job und damit seine einzige Stütze zu verlieren, lässt ihn erst recht die Flucht nach vorn antreten. Mit dem Mut der Verzweiflung foppt er seine Feinde, tritt sie in die Kniekehlen, schreckt selbst vor nächtlichen Einbrüchen nicht zurück, um ihnen begreiflich zu machen, dass die Welt nicht ihr persönliches Eigentum ist …
Kein irrer Serienmörder, kein Rätsel schmiedender Kidnapper, kein „richtiger“ Verbrecher treibt dieses Mal sein Unwesen. Nicht zum letzten Mal trifft John Rebus auf eine viel gefährlichere Kategorie von Schurken. Es sind die Herrscher der Gegenwart, denen ihre Macht zu Kopf gestiegen ist. Längst haben auf dieser Welt nicht mehr Könige das Sagen. Auch ihre demokratisierten Nachfolger mussten das Feld längst räumen. Heute tanzen sie wie die Mehrheit ihrer Bürger nach der Melodie, die gesichtslose Großkonzerne anstimmen.
Mit perfider „Logik“ verwischen diese die Grenze zwischen „Falsch“ und „Richtig“. Simple Gesetze kümmern sie nicht, die das „Ganze“ im Auge behalten. Naiv ist, wer glaubt, man könne eine Industrie ansiedeln, indem man sie einlädt zu kommen. Im Rahmen des Gesetzes sind gewisse Investitionsanreize möglich. Sie reichen längst nicht mehr aus. „Interessenten“ müssen mit Fördergeldern, Steuernachlässen und anderen Sonderrechten massiv umworben werden.
Wenn das Gesetz keinen ausreichenden Spielraum bietet, solche Firmen zu locken, dann muss man dieses Gesetz halt biegen oder auch brechen: Arbeitsplätze winken als „Preis“ für solche Mauscheleien, welche die Unbeweglichkeit der Justiz in einer schnellen, globalisierten und letztlich eigenen Regeln gehorchenden Geschäftswelt ausgleichen.
So reden sich jedenfalls jene ihr Handeln schön, die in dieses „Spiel“ verwickelt sind. Nicht einmal die Tatsache, dass sie selbst finanziell von ihren Manipulationen profitieren, bringt ihre Selbstgerechtigkeit ins Wanken: Dies ist die Belohnung, die wagemutigen Kämpfern gegen die Rezession zusteht; wir kennen diese Argumentation aus diversen realen Prozessen gegen gestrauchelte, aber niemals einsichtige Finanzgenies.
Wie Ian Rankin seinen John Rebus herausfinden lässt, ist es auch zu einfach: Besonders im angeblich vereinten Europa ist die Subventionspraxis so verwickelt, dass eigentlich niemand ihr Funktionieren wirklich begreift. Das öffnet dem Betrug Türen und Tore. Manche Kapitel lesen sich etwas zäh, wenn Rankin aufdröselt, wie dies in Schottland funktionieren könnte. Tatsächlich erfasst den Leser Verzweiflung, wenn er (oder sie) begreift, dass der Kontinent Europa wohl niemals eine echte Gemeinschaft bilden wird. Jedes Land blickt auf eine viele Jahrhunderte währende individuelle Geschichte zurück. Einheit lässt sich nicht erzwingen. Kompromisse sollen sie gedeihen lassen. Diese sind unendlich kompliziert in ihren Details. Wer sich in diesem Gestrüpp auskennt, kann sein Wissen kriminell in blanke Münze verwandeln.
Schottland ist ein ideales Beispiel. Einst war dies ein eigenes Königreich und erbitterter Feind des Herrschers von England. Die „Vereinigung“ erfolgte durch Gewalt, und die britische Insel ist längst noch nicht zusammengewachsen. So existiert Schottland um des lieben Friedens willen heute als „quasi-selbstständiges“ Land im Norden Großbritanniens. Die politischen Konsequenzen sind unendlich kompliziert – und teuer für die Bürger, die mit ihren Steuern die daraus resultierenden Streitigkeiten und Absurditäten brav finanzieren.
Auch John Rebus ist keineswegs ein unbeirrbarer Idealist, der den gordischen Knoten der Korruption durchschlagen will. Er macht sich seine Gedanken darüber, dass sein Handeln die Schiebereien auffliegen lässt und das Aufblühen einer Industrie verhindern wird, deren Arbeiter sich einen Dreck um die Unrechtmäßigkeit ihrer Entstehung kümmern würden. Rankin hat die wichtigste Währung der Gegenwart und Zukunft bereits erkannt: Es sind Arbeitsplätze, die heute als politisches Druckmittel eingesetzt werden. Rankin gönnt sich die literarische Freiheit, noch einmal „das Recht“ obsiegen zu lassen. Freilich ist er nicht so naiv zu glauben, dass die Entlarvung einzelner Konzernkrimineller das System noch aus dem Gleichgewicht bringen könnte.
Man glaubt es kaum, aber Ian Rankin gelingt es noch jedes Mal, die Welt für seinen John Rebus ein wenig düsterer zu gestalten, ohne damit aufdringlich oder unglaubhaft zu wirken (d. h. die sog. „Wallander“-Verdrießlichkeit heraufzubeschwören). Dieses Mal ist es vor allem die echte und gut nachvollziehbare Furcht unseres „Helden“ vor Gegnern, die sakrosankt erscheinen und sich mit normalen kriminalistischen Methoden – die Rebus so perfekt beherrscht – nicht aus der Reserve locken lassen.
Darüber hinaus ist Rebus‘ Privatleben sogar noch bemitleidenswerter als sonst. Seine geliebte Dr. Patience Aitken hat ihn vor die Tür gesetzt. An Versöhnung ist nicht zu denken, nachdem Rebus nach einer für ihn üblichen Unbedachtsamkeit auch noch ihre geliebte Katze gekillt hat (eine der für Rankin typischen, von knochentrockenem Humor geprägten Episoden, an denen „Ein eiskalter Tod“ wieder einmal so reich ist).
Im Büro setzt man ihm als neue Vorgesetzte ausgerechnet Gill Templer, eine andere Ex-Gefährtin, vor die Nase, die durch forcierte Unfreundlichkeit deutlich zu machen gedenkt, dass Rebus keine Sonderrechte genießt. Da ist dessen Kampf mit dem schleimigen Kollegen Flower fast eine Erleichterung, weil dieser dem ebenso boshaften wie einfallsreichen Inspektor nicht wirklich gewachsen ist.
In und um das Revier St. Leonard’s tummeln sich wie immer Rebus‘ geplagte, verärgerte, schockierte, sarkastische, abgebrühte Kolleginnen und Kollegen. Ihr Auftritt bietet jeweils ein willkommene Ablenkung von den deprimierenden Heimlichkeiten der „Ehrenmänner“, mit denen es Rebus in diversen Ministerien, Konsulaten oder Firmenpalästen zu tun bekommt. Die Polizisten Siobhan Clarke und Brian Holmes, die es noch am besten mit Rebus aushalten, müssen sich freilich dieses Mal mit Nebenrollen begnügen.
Ian Rankin wird 1960 in Cardenden (Verwaltungsbezirk Fife), einer Arbeitersiedlung im Kohlerevier der schottischen Lowlands, geboren. In Edinburgh studiert er ab 1983 Englisch, zunächst mit dem Schwerpunkt Amerikanische, später Schottische Literatur.
Schon früh hat Rankin zu schreiben begonnen. Zunächst ein hoffnungsvoller Poet, wechselt er als Student zur Prosa. Nach zahlreichen Kurzgeschichten versucht er sich an einem Roman, findet aber keinen Verleger. Erst der Bildungsroman „The Flood“ erscheint 1986 in einem studentischen Kleinverlag.
Nachdem sein Stipendium ausgelaufen ist, verlässt Rankin 1986 die Universität. Gemeinsam mit seiner frisch angetrauten Gattin geht er nach London, wo er u. a. als Redakteur für ein Musik-Magazin arbeitet. Nebenher veröffentlicht er den Kolportage-Thriller „Westwind“ (1988) sowie den Spionageroman „Watchman“ (1990).
Allmählich beginnt sich der Erfolg einzustellen. Unter dem Pseudonym „Jack Harvey“ verfasst Rankin in rascher Folge drei actionlastigen Thriller. 1991 greift Rankin eine Figur auf, die er vier Jahre zuvor im Thriller „Knots & Crosses“ (1987; dt. „Verborgene Muster“) zum ersten Mal hat auftreten lassen: Detective Sergeant (später Inspector) John Rebus von der Kriminalpolizei der schottischen Metropole Edinburgh. „Knots & Crosses“ war 1987 weniger als Kriminalroman, sondern eher als intellektueller Spaß im Stil Umberto Ecos gedacht, den sich der literaturkundige Autor mit seinem Publikum machen wollte. Schon die Wahl des Namens, den Rankin seinem Helden gab, verrät das Spielerische: Um Bilderrätsel – Rebusse – dreht sich die Handlung.
Mit John Rebus gelingt Rankin eine Figur, die im Gedächtnis seiner Leser haftet. Als man ihn immer wieder auf das weitere Schicksal des Sergeanten anspricht, wird er sich dessen Potenzials bewusst. Die Rebus-Romane ab „Hide & Seek“ (1991; dt. „Das zweite Zeichen“) spiegeln das moderne Leben (in) der schottischen Hauptstadt Edinburgh wider. Rankin spürt seither den dunklen Seiten nach, die den Bürgern, vor allem aber den (zahlenden) Touristen von der traulich versippten Führungsspitze aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kirche gern vorenthalten, aber nicht selten von ihr, deren Angehörige sich über die ‚Normalsterblichen‘ und ihre Regeln und Gesetze erhaben fühlen, mit verursacht werden. Daneben lotet Rankin die Abgründe der menschlichen Psyche aus. Simple Schurken, deren möglichst malerisches, weil „gerechtes“ Ende bejubelt werden kann, gibt es bei ihm nicht.
Ian Rankins Rebus-Romane kommen nach 1990 in Großbritannien, aber auch in den USA stets auf die Bestsellerlisten. Die renommierte „Crime Writers‘ Association of Great Britain“ zeichnete ihn zwei Mal mit dem „Short Story Dagger“ (1994 und 1996) sowie 1997 mit dem „Macallan Gold Dagger Award“ aus. 1992 ehrt man ihn in den USA mit dem „Chandler-Fulbright Award“ als „vielversprechendsten Nachwuchsautoren des Jahres“. Rankin gewann im Jahre 2000 weiter an Popularität, als die britische BBC begann, die Rebus-Romane zu verfilmen.
Ian Rankins Website (http://www.ianrankin.net ) ist höchst empfehlenswert; über die bloße Auflistung seiner Werke verwöhnt sie u. a. mit einem virtuellen Gang durch das Edinburgh des John Rebus.
Die John-Rebus-Romane erscheinen in Deutschland im |Wilhelm Goldmann Verlag| (Stand: Herbst 2004):
01. Verborgene Muster (1987, Knots & Crosses) – TB-Nr. 44607
02. Das zweite Zeichen (1991, Hide & Seek) – TB-Nr. 44608
03. Wolfsmale (1992, Wolfman/Tooth and Nail) – TB-Nr. 44609
04. Ehrensache (1992, Strip Jack) TB-Nr. 45014
05. Verschlüsselte Wahrheit (1993, The Black Book) – TB Nr. 45015
06. Blutschuld (1994, Mortal Causes) – TB Nr. 45016
07. Ein eisiger Tod (1995, Let it Bleed) – TB Nr. 45428
08. Black & Blue (1997)
09. The Hanging Garden (1998)
10. Dead Souls (1999)
11. Der kalte Hauch der Nacht (Set in Darkness, 2000) – TB Nr. 45387
12. Puppenspiel (The Falls, 2001) – TB Nr. 45636
13. Die Tore der Finsternis (Resurrection Man, 2002)
14. Die Kinder des Todes (A Question of Blood, 2003)
15. Fleshmarket Close (2004; noch kein dt. Titel)
Darüber hinaus gibt es zwei Sammlungen mit Rebus-Kurzgeschichten: „A Good Hanging & Other Stories“ sowie „Beggars Banquet“.