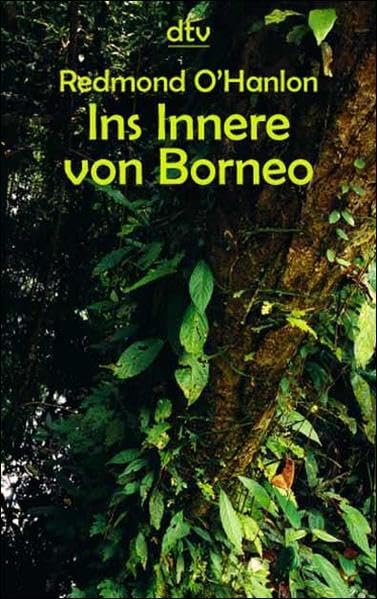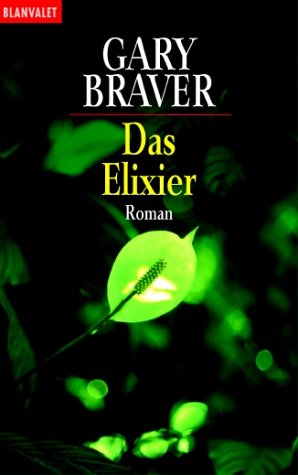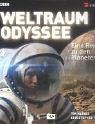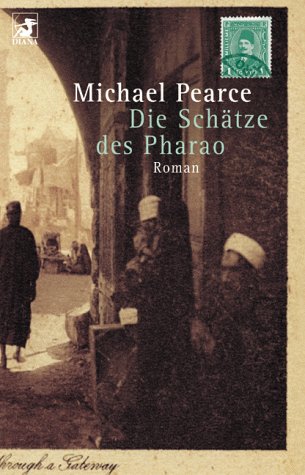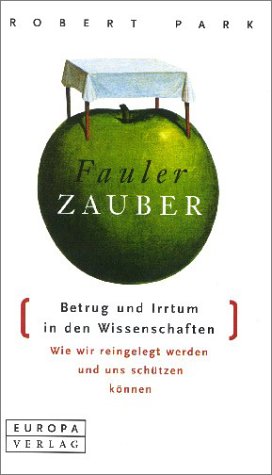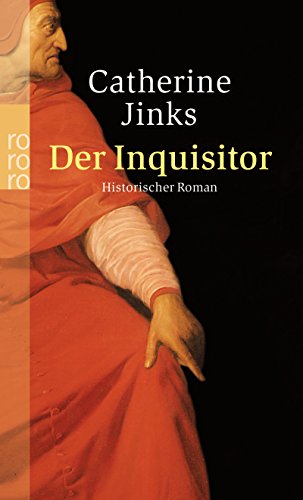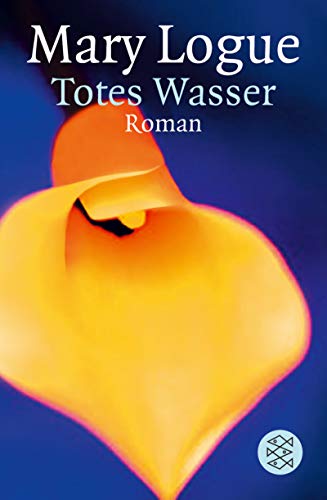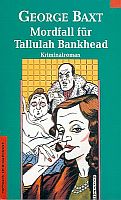Catherine Aird – Schlossgeheimnisse weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
O’Hanlon, Redmond – Ins Innere von Borneo
Natürlich ist ein Urlaub der etwas extremeren Art heutzutage auch für den Herausgeber der „Literarischen Beilage“ (Ressort Naturgeschichte) einer so ehrwürdigen Zeitung wie der britischen „Times“ nichts Außergewöhnliches mehr. Dennoch stellt sich der Leser dieses Reiseberichtes bald die Frage, wieso die Wahl Redmond O’Hanlons ausgerechnet auf den Dschungel der Insel Borneo fiel. So genau geht er selbst auf diesen Punkt nicht ein, aber wenn man zwischen den Zeilen nach einem Motiv sucht, wird es wohl dasselbe ein, das sein ehrgeiziger Landsmann George Mallory einst vor seiner letzten Reise zum Mount Everest so in Worte fasste: Weil er da ist.
Zur Everest-Expedition von 1924 gibt es noch eine bemerkenswerte Parallele: Mit Redmond O’Hanlon und seinem Freund und Begleiter, dem Lyriker (!) James Fenton, begeben sich zwei Männer auf große Fahrt, die man mit Fug und Recht (sie würden es selbst sogleich zugeben) auch als Gewinner eines Wettstreits der inkompetentesten Reisenden dieser Welt bezeichnen könnte. Dabei ist auch das Borneo des 20. Jahrhunderts (O’Hanlon & Fenton unternahmen ihren Ausflug bereits 1984) kein ungefährliches Pflaster; nur die Medikamente sind inzwischen besser geworden, was zu preisen unsere Reisenden mehr als eine Gelegenheit finden werden.
Nicht dass der Bücherwurm und der Dichtersmann völlig ahnungslos im Land des Orang-Utans gelandet wären. Sie betreten es sogar mit recht dezidierten Vorstellungen, die man wiederum als romantische Selbstmord-Phantasien umschreiben könnte: Was O’Hanlon über Borneo zu wissen glaubt, entnahm er großzügig den Reiseberichten seiner Vorgänger. Zwar dunkel ahnend, dass in den vielen Jahrzehnten, die seither verstrichen, sich einiges geändert haben könnte, freut er sich dennoch auf und fürchtet sich vor einer feuchtheißen Tropenhölle, die von blutrünstig-primitiven Kopfjägern und tückisch-faszinierendem Fabelgetier bevölkert wird.
Darauf will er lieber vorbereitet sein, trainiert mit den britischen Ledernacken und reist später wie jeder europäische Entdecker von altem Schrot und Korn schwer bewaffnet in die Wildnis, was auf dem Flughafen von Singapur unter reger Beteiligung der örtlichen Polizeibehörden für eine erste aufregende Episode sorgt. Endlich trotzdem auf Borneo (bzw. in Sarawak, einer Provinz des malaysischen Inselreiches) angekommen, wird zudem rasch deutlich, dass es nicht mehr weit her ist mit der insgeheim erträumten kolonialen Herrlichkeit vergangener Zeiten, als O’Hanlon und sein Gefährte sehr prosaisch im örtlichen „Holiday Inn“- unterkommen: Die Zivilisation hat die Tropeninsel längst erreicht.
Glücklicherweise findet sie dann doch unweit der wenigen größeren Städte ihr rasches Ende. Mit dem Wagemut der absolut Ahnungslosen haben sich O’Hanlon und Fenton für eine Expedition die Flüsse Rejang und Baleh hinauf in jenes Land entschieden, in dem das seltenste Tier der Welt (vielleicht) sein sagenhaftes Dasein fristet: das (ironischerweise nach seiner eigentlichen Heimat benannte) Sumatra-Nashorn. Klein, dunkel und mit einem Fell (!) bekleidet ist es dank der über Jahrzehnte ungeteilten Aufmerksamkeit von Wilderern und Jägern aus aller Welt heute so selten, dass jede Sichtung als Sensation gefeiert wird.
Sollte dieses Unternehmen scheitern, bleibt ja noch immer der aufregende Kontakt mit den Iban, den menschlichen Bewohnern Borneos, die nach Ansicht O’Hanlons stets ein wenig zu laut bekräftigen, die Kopfjagd inzwischen aufgegeben zu haben. Allerdings ist der echte Horror Borneos eher im Mikrokosmos angesiedelt. Dort warten u. a. 250 Fleisch fressende Ameisenarten und 1.700 höchst unterschiedliche Parasitenwürmer auf unvorsichtige Besucher. O’Hanlon spart nicht an gruseligen Details, die das Schicksal jener schildern, die sich nicht wie er und Fenton an jedem Morgen in Insektenpulvern und -sprays buchstäblich wälzen.
Überbordende Fruchtbarkeit auf der einen und ständiger Zerfall und Verwesung auf der anderen Seite machen auch den übrigen Teilnehmern der Expedition tüchtig zu schaffen: Alfred Russell Wallace, James Keppel, Charles Hose und Tom Harrisson sind nur die wichtigsten aus dem Kreise derer, die zumindest im Geiste allzeit um O’Hanlon sind; in Gestalt ihrer Bücher über Borneo nämlich, die der unverbesserliche Romantiker in großer Zahl dorthin geschleppt hat, wo ihre Lebensdauer arg begrenzt ist und aus denen er gern und oft zitiert. Von der Kritik ist ihm dies zum Vorwurf gemacht worden, doch hier gilt es wohl eher den Stil des Autoren zu achten. Die Zitate sind nicht nur klug gewählt und informativ, sondern sie konterkarieren auch das Dilemma, dem sich O’Hanlon ausgesetzt sieht: In Borneo ist die Steinzeit zwar an vielen Orten noch nicht zu Ende gegangen.
Trotzdem ist die Insel nicht das magische Wunderland, das er sich im heimischen Elfenbeinturm zu Oxford erträumt hat. Dort, wo die Vergangenheit noch fortlebt, enthüllt sie immer wieder recht hässliche Seiten. So muss der Reisende feststellen, dass die ihn bezaubernde weibliche Jugend in den Dschungeldörfern schlicht deshalb in der Überzahl ist, weil die meisten Einheimischen einer der vielen schrecklichen Krankheiten zum Opfer fallen, bevor sie alt werden können. O’Hanlon und Fenton bereisen Borneo nicht in Slapstick-Manier als zwei Männer im Boot (vom Rhinozeros ganz zu schweigen), wie der Klappentext suggeriert, sondern durchaus offenen Auges und wachen Geistes. Deshalb entgehen ihnen auch keineswegs die allgegenwärtigen Schrecken eines ungehemmten Raubbaus an der Natur: Es gibt keine Bodenschätze auf Borneo, nur das Edelholz des Dschungels, der deshalb rücksichtslos niedergeholzt wird. Die Menschen sind sich der Folgen durchaus bewusst, doch sie sehen keine Alternativen – und sie haben auch keine Lust, zum Frommen naturromantischer Westler ein tarzanoides Naturkinder-Dasein zu fristen.
Anlass zu echter Negativ-Kritik gibt indes ein Verdacht, der sich schon auf den ersten Seiten einstellt und im Verlauf der weiteren Lektüre schnell zur Gewissheit wird: O’Hanlon mischt Fakten und Fiktion um des Effektes vielleicht etwas zu freizügig in dem Bemühen, eine an sich interessante, aber eben nicht spektakuläre Reise für den Leser dramatischer zu gestalten, und inszeniert, übertreibt und überspitzt. James Fenton, O’Hanlons Begleiter, ist beispielsweise keineswegs der weltfremde Barde, der sich ebenso wagemutig wie ahnungslos ins Abenteuer stürzt, sondern ein erfahrener Kriegsberichterstatter, der in der Vergangenheit einigen Mut bewiesen und wohl nicht von ungefähr auf dem ersten nordvietnamesischen Panzer gesessen hat, der 1975 nach dem Fall von Saigon in die von den Amerikanern aufgegebene Stadt rollte. Auch mit dem Sumatra-Nashorn ist das so eine Sache; So selten es ist, man kann es immer noch finden, nur eben nicht dort, wo O’Hanlon es angeblich versucht hat. Das muss er auch gewusst haben, aber natürlich ist es im Nachhinein publikumswirksamer, eine Reise, die ihr Ziel aus verschiedenen Gründen verfehlt hat, zu einer romantischen Queste zu verklären.
So verbissen darf man aber vielleicht gar nicht an „Ins Innere von Borneo“ herangehen. Die Übergänge zwischen dem klassische Reisebericht und dem Abenteuerroman sind seit jeher fließend; wenn unsere beiden wackeren Briten auch nicht gerade viel Neues entdecken, lesen sich ihre Abenteuer doch amüsant, zumal O’Hanlon wirklich schreiben kann und seine wohl gesetzten Worte ihren Umweg zum deutschen Leser über die Übersetzung gut überstanden haben.
Übrigens hat der Autor die vielen drastischen Zwischenfälle der Borneo-Reise wohl besser verkraftet als er dies 1984 selbst gedacht hätte: Seither ist Redmond O’Hanlon noch mehrfach in anderen Dschungeln dieser Welt unterwegs gewesen und hat auch diese Reisen literarisch aufgearbeitet. „Kongofieber“, die Bilanz eines fünfmonatigen Aufenthaltes in den Tiefen des afrikanischen Kongos im Jahre 1989, hat in Form und Inhalt sogar die Ausmaße eines echten Epos‘ angenommen und gilt inzwischen als echter Klassiker der Reiseliteratur; ein Werk, das die O’Hanlons der Zukunft mit auf ihre Entdeckungsreisen nehmen werden.
Gary Braver – Das Elixier
1980 spürte Biochemiker Dr. Christopher Bacon im Dschungel von Papua-Neuguinea heilsamen Pilzen nach, Weil er dabei seinem einheimischen Begleiter, dem Schamanen Iwati, das Leben rettete, weihte ihn dieser in das Geheimnis der Tabukari-Pflanze ein, die dem Menschen Unsterblichkeit schenkt; er selbst sei auch schon 130 Jahre alt, eröffnete Iwati damals dem staunenden Freund.
Sechs Jahre später tüftelt Bacon immer noch an einer Version des Wundermittels, das er „Tabulon“ nennen möchte. Inzwischen werden seine Labormäuse steinalt. Bacon würde gern selbst die eigene Medizin versuchen, gäbe es nicht hässliche Nebenwirkungen gäbe: So manche Maus holt plötzlich die Zeit ein, die sie dank Tabulon betrügen konnte. Das Ende ist ebenso spektakulär wie tödlich, was Bacon klugerweise zur Zurückhaltung mahnt. Allerdings muss er erfahren, dass ihn sein alter Freund und Mitforscher Dexter Quinn, den er als einzigen ins Vertrauen zog, schnöde hinterging: Quinn hat sich heimlich Tabulon injiziert. Die Wirkung entsprach tatsächlich dem Sturz in den Jungbrunnen, bis es ihm eines Tages ergeht wie besagten Mäusen. Gary Braver – Das Elixier weiterlesen
Haines, Tim / Riley, Christopher – Weltraum-Odyssee. Eine Reise zu den Planeten
Die fünfköpfige Besatzung des Raumschiffs „Pegasus“ begibt sich auf eine mehr als sechs Jahre währende Reise durch das Sonnensystem. Planeten, Monde, die Sonne und ein Komet werden be- und untersucht, unzählige Experimente durchgeführt, gefährliche Unfälle gemeistert, bis man, das zerbeulte Schiff bis unters Dach mit Daten und Proben vollgepackt, im Triumph zur Erde zurückkehrt.
Wobei eine imaginäre Reise ins Weltall nicht gerade ein taufrischer Plot ist. Auch im Sachbuch hat es das schon gegeben. Das eigentlich Neue ist die verblüffend gut gelungene Verklammerung, welche die Grenze zwischen Fiktion und Fakten praktisch aufhebt. Die Reise der „Pegasus“ wurde von der BBC in Zusammenarbeit mit echten Wissenschaftlern so ‚realistisch‘ wie möglich geplant und ‚durchgeführt‘. So intensiv wie es eben im Rahmen einer TV-Show machbar und praktikabel ist, orientierte man sich an den Raumflügen der Vergangenheit, deren Realität man unter Berücksichtigung dessen, was in mehr als drei Jahrzehnten unbemannte Raumfahrt erkundet wurde, auf das „Pegasus“-Unternehmen projizierte.
Auf eine Expedition zu sämtlichen Planeten unseres Sonnensystems wird deshalb verzichtet: Die Physik verbietet es, da ein direktes Ansteuern derselben gar nicht möglich ist. Sonden und potenzielle Raumschiffe müssen die Gravitation anderer Planeten oder großer Monde nutzen, um zu beschleunigen oder abzubremsen, sonst reicht der Treibstoff nicht. Also wurde die Reiseroute gemäß der zum Zeitpunkt der „Pegasus“-Reise aktuellen Planetenkonstellation festgelegt. Sie lautet wie folgt: Venus (Landung) – Mars (Landung) – Sonne (Umkreisung in geringer Entfernung) – Planetoidengürtel – Jupiter (Vorbeiflug) – Jupitermond Io (Landung) – Saturn (Vorbeiflug und Ring-Untersuchung) – Pluto (Landung) – Komet Yano-Moore (Rendezvous).
„Weltraum-Odyssee“ ist das angebliche Protokoll dieser Reise. ‚Authentische‘ Einsatzbeschreibungen (in welche aktuelles Forschungswissen mehr oder weniger unauffällig einfließt) und persönliche Kommentare der Planetenforscher wechseln sich mit Artikeln zur realen Weltraumforschung in Vergangenheit und Gegenwart ab. Diese sind an den astronomischen Laien gerichtet, der sich anschließend tatsächlich informiert vorkommt, woran klare, einleuchtende Grafiken und vor allem eine verschwenderische Fülle großformatiger, meist farbiger ‚Fotos‘ (= tatsächliche Aufnahmen, die oft farbbereinigt, nachgeschärft oder sonst wie bearbeitet oder gleich vollständig digital geschaffen wurden) großen Anteil haben.
Doch nicht Information oder informative Unterhaltung allein lockt die Leser. Es geht auch um einen Traum: Was wäre, wenn … die Menschen endlich wieder selbst Raketen & Raumschiffe besteigen würden, um persönlich die Rätsel und Wunder des Alls in Augenschein zu nehmen, statt dies Raumsonden & Robotern zu überlassen? Natürlich können es die Maschinen besser und billiger. Eine Flut bemerkenswerter Daten und Bilder wurde gerade in den letzten Jahren vom Mars oder vom Jupitermond Europa gefunkt. Astronauten müssen sich nicht ewig in winzige Blechbüchsen quetschen, von kosmischer Strahlung rösten lassen, sich in permanente Lebensgefahr bringen.
Ein echter Fortschritt also – und doch … Der Mensch ist ein seltsames Tier: Ihm genügt der Eindruck aus zweiter Hand nicht. Er will die Welt be-greifen. Ohne diesen Drang säße er wohl immer noch in einer Höhle und würde einen Stock anbeten, wie es einst in einer klassischen TV-Comedy hieß. Allen berechtigten Einwänden zum Trotz will er selbst hinauf ins All, was natürlich gar nicht so dumm ist, weil sich ferngesteuerte Forschungsdrohnen trotz Hightech stets sehr beschränkt geben, was vor allem die Suche nach außerirdischem Leben frustrierend gestaltet. Diesen Zwiespalt zwischen Vernunft und Vision versucht das Team Tim Haines und Christopher Riley mit seinem aktuellen Filmprojekt zu schließen. Bisher ließ der britische Sender diverse Donnerechsen („Dinosaurier – Im Reich der Giganten“) und deren säugetierischen Nachfolger („Die Erben der Saurier – Im Reich der Urzeit“) digital wiederbeleben und außerordentlich quotenträchtig über die Bildschirme stapfen. Weil sich der daraus resultierende Aha-Effekt inzwischen abgenutzt hat, brach man buchstäblich zu neuen Ufern auf. Schon in früheren Serien hatte man sich unauffällig vom Konzept der strikt wissenschaftlichen Rekonstruktion verabschiedet und immer neue Gimmicks einfließen lassen; so konnte es beispielsweise durchaus geschehen, dass einem interviewten Forscher während seines Referats ein Digitaldino über die Schulter schaute oder ein Kollege eine Zeitreise in die Urzeit unternahm („Monster der Tiefe“).
Das Prinzip Brot & Spiele bzw. Infotainment, wie man diese Mischung aus Science und Fiction heute nennt, prägt auch und noch viel mehr als zuvor die „Weltraum-Odyssee“. Dieses Mal schlagen die Fakten die Fiktion indes um Längen. Selten zuvor ist eine Reise durch das Sonnensystem so faszinierend und langweilig zugleich gewesen. Der Spagat ist insofern misslungen, als der gut gemeinte und kluge Versuch, den ‚Faktor Mensch‘ in die fiktive Weltraumfahrt zu integrieren, auf TV-Format und mit politisch geradezu aggressiv korrekten Mustermensch-Schauspielern realisiert wurde, während die Bilder Kinoformat besitzen. An Bord eines Raumschiffs setzt sich trotz der permanenten Krisensituation, in der man sich eigentlich befindet, eine gewisse Routine durch, denn der Mensch ist anpassungsfähig. Routine fesselt freilich keine Fernsehzuschauer. Also werden diverse dramatische Zwischenfälle konstruiert. Diese sehen am Bildschirm spannend aus, lesen sich aber denkbar unspektakulär, weil sie in demselben pseudo-offiziellen, um Sachlichkeit bemühten Stil wie die Tagesberichte beschrieben werden. ‚Private‘ Aufzeichnungen der Raumfahrer sollen dagegen deren Einsamkeit, innere Ängste, Trauer etc. deutlich machen. Leider wurde auch hier jeglicher Funken echter Emotion getilgt – sei es absichtlich, um ein unpassendes Star-Trek-Feeling zu vermeiden, oder sei es, weil die Autoren mit der Niederschrift einer echten Rahmenstory schlicht überfordert waren.
Bleiben die eingeschobenen Sachartikel mit ‚echten‘ Bildern von Planeten und Monden und den dazu geleisteten Erläuterungen. Hier klappt die Vermittlung von Weltraumforschung ohne Schwierigkeiten, hier spielt das Team von „BBC Worldwide“ seine langjährige Erfahrung bei der Herausgabe inhaltlich auf den Punkt gebrachter, perfekt layouteter Sachbücher voll aus. „Weltraum-Odyssee“, der Film, ließ sich am besten genießen, wenn man (auch wegen der kriminell zu nennenden deutschen Synchronisation) den Ton abdrehte und sich auf die Bilder konzentrierte. Die sind einfach unglaublich. Der modernen Tricktechnik sind offensichtlich keine Grenzen mehr gesetzt – die Schauspieler stehen überzeugend auf fremden Planeten, deren Eigenheiten im Rahmen der bekannten Fakten jederzeit glaubhaft inszeniert werden. Für die Zukunft bzw. die weiteren Projekte der BBC in Sachen (Re-)Konstruktion des Unmöglichen wünscht man sich deshalb – egal ob Film oder Buch – ein Zurück zum Dokumentarischen & den Verzicht aufs allzu Zirzensische.
Volker Dehs – Jules Verne. Biographie

Volker Dehs – Jules Verne. Biographie weiterlesen
Ferreras, Pipín – Tiefenrausch
Francesco „Pipín“ Ferreras ist nach eigener Auskunft schon als Kind mehr Fisch als Mensch gewesen. Im bereits revolutionär angegammelten Kuba der 1960er Jahre bleibt ihm trotz castrogläubiger Eltern der Glanz des realen Sozialismus‘ verborgen. Pipín geht lieber tauchen und entwickelt dabei rasch bemerkenswerte Talente, die indes lange brachliegen müssen: Kuba ist kein Ort, an dem man wassertaugliche Bürger schätzt; Miami, die Höllenstadt des Erzteufels USA, liegt verführerisch nahe am Horizont.
Aber zum Ruhme Kubas lässt Fidel Castro den jungen Mann schließlich doch seine Tauchkunststücke auf der ganzen Welt vorführen. Pipín entwickelt sich rasch zu einem der besten Apnoetaucher der Welt: Mit nur einem Atemzug taucht er möglichst rasch und tief ins Meer, um erst Minuten später wieder aufzutauchen – „No Limits“ nennt sich dieses nutzlose, ja lebensgefährliche Gladiatorenspiel, das die Medien zunehmend fasziniert. Pipín will endlich an die Weltspitze, will viel Geld verdienen. 1993 flieht er aus Kuba und fängt ein neues Leben als professioneller Extremtaucher an.
Nach schwierigen Anfangsjahren kann er an seine früheren Erfolge anknüpfen. Er tritt im Fernsehen auf, wird interviewt, von Sponsoren umworben – und taucht tiefer und tiefer. Privat sieht es eher düster aus. Der junge Mann kann ist bereits zweimal geschieden und gilt als jähzorniger Kotzbrocken. 1996 lernt Pipín die deutlich jüngere Meeresbiologin Audrey Mestre kennen. Eine Liebe epischen Ausmaßes entspinnt sich, zwei Herzen schlagen fürderhin im Einklang & was der Hollywood-Klischees mehr sind. Vor allem aber findet Audrey Geschmack am Apnoetauchen. Sie übertrifft ihren Seelenverwandten, bald Ehemann und Lehrmeister bald deutlich.
Diese Gunst der Stunde will der in die Jahre kommende Pipín nutzen. Statt selbst zu tauchen, vermarktet er seine zunehmend erfolgreiche Frau. Audrey ist jung, hübsch und ertaucht zuverlässig Spitzentiefen. So kommt sie dem Weltrekord für Männer und Frauen immer näher. Eines Oktobertages im Jahre 2002 will sie ihn endgültig brechen und 170 Meter Wassertiefe erreichen. Sie schafft es, aber zurück an die Oberfläche findet sie nicht mehr …
Die Geschichte von Pipín & Audrey adelt ein Buch, für das sich ansonsten wohl nur die kleine Schar der Extremsportler interessieren würde. Aber „Tiefenrausch“ kann mit einer grandiosen Lovestory prunken – mit einer tragischen sogar, was ja den Kaufdrang der Tränendrüserdrücker-Fraktion seit jeher beflügelt. Gut, dieser Pipín Ferreras ist nicht gerade Brad Pitt – er bezeichnet sich selbst treffend als „glatzköpfigen, machohaften Kubaner“. Seine Ungeduld, seinen alle Grenzen der Vernunft sprengenden Ehrgeiz, seinen Neid auf – womöglich erfolgreiche – Konkurrenten spart er in der Aufzählung seiner Unarten lieber aus und lässt sie vorsichtig in seine biografische Rückschau einfließen.
Audrey dagegen muss wohl ein Engel auf Erden (bzw. unter Wasser) gewesen sein. Pipín sagt es uns in jedem Satz und wer’s immer noch nicht glauben mag, für den gibt es unzählige ganzseitige Fotos – farbig und schwarzweiß -, die immer wieder Audrey, Audrey, Audrey zeigen: beim Training, beim Gewinnen, bei Tanz mit einem erstaunten Rochen … Es will kein Ende nehmen, „Tiefenrausch“ ist ein gedruckter Audrey-Schrein.
Da gibt es freilich einige Schönheitsfehler. Vor allem müssen wir uns darauf verlassen, was Pipín Ferreras uns über seine Liebe und seine Tauch-Obsession erzählt. Audrey können wir ja leider nicht mehr fragen. Der Skeptiker weiß: Engel auf Erden gibt es eigentlich nicht. Kein Mensch ist ohne Fehler und Tadel, sonst wäre er ziemlich langweilig. Was Pipín selbst angeht, so spart er (s. o.) nicht mit Schlägen gegen die eigene Stirn. Er übernimmt sogar die Mitschuld für ihren Tod. Offensichtlich ist „Tiefenrausch“ einer von vielen Versuchen Ferreras, den tragischen Tod von Audrey zu verarbeiten.
Zumal dieser einerseits auf ein banales Versehen zurückzuführen ist: Der Luftsack, der Audrey an die Oberfläche tragen sollte, war nur teilweise gefüllt. Niemand hatte das nachgeprüft, stattdessen verließ sich ein Teammitglied auf das andere. Unter Wasser fehlte ein Begleittaucher; der Rekordversuch fand trotzdem statt – bisher war ja stets alles gut gegangen. So ging es weiter; eine Kette von minimalen Versäumnissen führte direkt in die Katastrophe. Man war eingelullt von der spielerischen Eleganz, mit der Audrey immer neue Rekordtiefen erreichte. Das machte leichtsinnig, was kein guter idealer Zustand ist, wenn einem 170 Meter unter Wasser die Luft wegbleibt.
Andererseits ist Pipín Ferreras die treibende Kraft hinter Audrey Mestre – und oft genug wohl ihr Dämon. Sie tauchte nach eigener Auskunft einfach gern, er machte daraus ein Rekordgeschäft. Wieso sie sich dagegen nicht wehrte, muss offen bleiben; Ferreras drückt sich in diesem Punkt recht vage aus und schwadroniert von der Macht der Liebe, die sich für ihn und Audrey vor allem unter Wasser entfaltete und das delfingleiche Paar als kosmische Einheit funktionieren ließ. (Allerdings merkt er sehr richtig an, dass er seiner lungenstarken Gattin keinen Sack mit Steinen um den Hals gebunden und sie dann ins Meer gestoßen hat; Audrey war erwachsen.) Außenstehende, d. h. Nicht-Apnoeisten, könnten das sowieso nicht verstehen. Damit liegt er zweifellos richtig; der boshafte Skeptiker mag zum Beispiel einwenden, man könne sich auch einen Backstein auf den Kopf schlagen, um Gott und viele Sterne zu sehen – und das ohne besondere Lebensgefahr. Genau die ist aber integraler Bestandteil des Extremsports, auch wenn das lieber nicht so deutlich formuliert wird.
Wie jeder Paulus blickt auch Pipín Ferreras mit wehmütigem Stolz auf seine Saulus-Jahre zurück. Natürlich findet er die weltweite Jagd nach immer neuen „No Limits“-Rekorden verwerflich, seit Audrey umkam und er nicht mehr mittun kann und mag. Bis er zu dieser Einsicht gelangte, war Ferreras jedoch die treibende Kraft unter den Apnoe-Extremtauchern dieses Planeten. Endgültig „geheilt“ von seinem Tauchwahn ist er wohl doch nicht; die Grenzen zwischen Sport und Spinnerei sind meist fließend.
Was man nicht Ferreras sondern eher seiner (nur auf dem inneren Titelblatt erwähnten) „Mitautorin“ Linda Robertson (Pipín hat übrigens schon mehrere Bücher „schreiben lassen“, da er sich eigentlich nicht zum Literaten berufen fühlt, aber kein Problem damit hat, seine erzählten Tauch- und Lebensgeschichten in gut honorierte Prosa verwandeln zu lassen) ankreiden muss, das ist sicherlich der schauerliche Auftritt Audreys als glücklicher Geist aus dem Jenseits, der dem gebrochenen Pipín bei dessen Gedächtnis- Rekordtauchgang von 2003 unter Wasser ein letztes Hallo zuwinkt. Solcher Schwachsinn wäre ansonsten nur verzeihlich, wenn der arme Pipín doch ein wenig zu lange die Luft angehalten hätte … Vielleicht ist diese Passage auch nur ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung von James Cameron. Der Regisseur von „Titanic“, der seit 1997 keinen Spielfilm mehr gedreht hat (bis auf zwei Dokumentationen), aber dem Meer treu geblieben ist, plant angeblich, Pipín und Audrey zu Helden eines neuen, nassen Blockbusters zu erheben (worauf man sich lieber nicht verlassen sollte).
Richard Condon – Der Manchurian Kandidat
1951 gerät in Korea ein US-amerikanischer Spähtrupp in einen chinesisch-sowjetischen Hinterhalt. Die Männer werden in die nordostchinesische Mandschurei verschleppt, wo sie der Neurologe Yen Lo einer neuen Form der Gehirnwäsche unterzieht. Aus jungen Patrioten werden kommunistisch programmierte „Schläfer“, die als Kriegshelden in die USA zurückkehren, während sie weiterhin geistig „ferngesteuert“ werden.
Sergeant Raymond Shaw ist ein idealer (mandschurischer) Kandidat für dieses Projekt. Als Sohn einer einflussreichen Familie hat er Kontakte bis ins Weiße Haus. Er sieht gut aus und kommt in den Medien an. Das verschafft ihm die notwendige Bewegungsfreiheit. Richard Condon – Der Manchurian Kandidat weiterlesen
Michael Pearce – Die Schätze des Pharao
Kairo, die alte Metropole am Nil, ist im Jahre 1908 die Hauptstadt der autonomen osmanischen Provinz Ägypten. Doch das Osmanische Reich – der „kranke Mann am Bosporus“ – ist politisch zerrüttet und wirtschaftlich am Ende. In Ägypten mussten die Osmanen schon vor dreißig Jahren die Hilfe der Briten erbitten, um sich an der Macht zu halten. Die Briten kamen gern – und blieben. Seither ist der Zhedife – der einheimische Herrscher über Ägypten – nur eine Galionsfigur; die wahre Macht übt der Generalkonsul aus, der seine Anweisungen aus London erhält.
Die Ägypter hat niemand um ihre Meinung gefragt. Sie sind die Fremdherrschaft allerdings gewöhnt und haben sich in ihrer Mehrheit damit abgefunden. Nichtsdestotrotz gibt es eine nationalistische Untergrundbewegung, die von den Briten scharf im Auge behalten wird. Das ist die Aufgabe der Geheimpolizei, der in Kairo Captain Gareth Owen, der „Mamur Zapt“, vorsteht. Offiziell sorgt er für die öffentliche Ordnung in der Stadt und verfolgt Verbrechen, die an Reisenden aus dem Ausland begangen werden.
In diesem Zusammenhang lernt Owen die junge amerikanische Kunstexpertin Enid Skinner kennen. Sie unternimmt eine Studienreise und hat einen Onkel, der womöglich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Unter diesen Voraussetzungen bemühen sich ihre britischen Gastgeber, Miss Skinner sehr zuvorkommend zu behandeln, obwohl diplomatische Zurückhaltung für sie ein Fremdwort ist. So macht sie sich für eine strenge Ausfuhrkontrolle für altägyptische Bodenaltertümer stark. Überall im Land graben Archäologen im Auftrag europäischer und amerikanischer Museen, Kunsthändler oder privater Sammler nach den Schätzen der Pharaonenzeit. Mit großer Selbstverständlichkeit werden sie anschließend außer Landes geschafft.
Bisher verhallten die Protestrufe der wenigen Mahner, die diese Kleinodien im eigenen Land halten wollen, ungehört. Sollte sich allerdings jemand finden, dessen Stimme Gewicht hat und sich im Ausland gegen die organisierten Plünderungen erhebt, könnte das lukrative Geschäft in Gefahr geraten. Hat aus diesem Grund jemand versucht, Miss Skinner vor einen Straßenbahnwagen zu stoßen? Als sie wenig später die Ausgrabungsstätte Deir al Bahari im Süden des Landes besucht, wird ein weiterer Anschlag auf ihr Leben verübt. Captain Owen reist Miss Skinner nach. Er möchte die Gelegenheit nutzen, sich selbst ein Bild von den Grabungs- und Kunsthandelspraktiken zu machen – und stößt in ein Wespennest …
Archäologie zwischen Fundsicherung und Grabraub
„Die Schätze des Pharaos“ ist der sechste (und nicht der zweite, wie uns der Klappentext weismachen möchte) Fall des „Mamur Zapt“ Gareth Owen im Ägypten der britischen Kolonialzeit. Die buchstäblich farbenfrohe Kulisse des Orients ist es, die diesen Krimis ihre Originalität verleiht. Ägypten um die Jahrhundertwende ist ein hochinteressanter Schauplatz, der sich für einen Thriller geradezu anbietet, liefern sich hier doch gleich vier Staaten (Osmanisches Reich, Ägypten, England und Frankreich) einen stillen, hinter den Kulissen erbittert geführten Machtkampf um das strategisch wichtige Land als Einfallstor zum afrikanischen Kontinent.
Im vorliegenden Band rücken die politischen Querelen ein wenig in den Hintergrund. Pearce greift ein Thema auf, das den meisten Lesern in der geschilderten Deutlichkeit wahrscheinlich unbekannt ist. Streift man heute durch die großen Museen für Altertumskunde in Europa, um die riesigen Sammlungen exquisiter Kunstschätze aus Ägypten, dem antiken Griechenland oder Rom zu bestaunen, denkt man meist nicht darüber nach, wie diese Kostbarkeiten an Orte gelangten, für die sie definitiv niemals bestimmt waren.
Diese Sammlungen sind die eindrucksvollen Zeugen einer Ausgrabungspraxis, die einst allerorts üblich war: Finanziere eine archäologische Grabung in einem fremden Land, zahle den Einheimischen ein wenig Kleingeld – du kannst es beschönigend „Zoll“ nennen – und lasse alles dorthin schaffen, wo du es zu sehen wünscht. Klar, dass hier dem Missbrauch buchstäblich Tür und Tor geöffnet wurden. Es gab freilich kaum ein Unrechtsbewusstsein, denn schließlich kamen die Kostbarkeiten in die kundigen Hände derer, die sie zu würdigen wussten.
Auch die Ägypter hatten nichts gegen diesen Kunst-‚Handel‘ einzuwenden, denn er brachte Geld ins Land. Den Rahm schöpften zwar neben dem Zhedifen die örtlichen Paschas und anderen aristokratischen Würdenträger ab, aber die Bevölkerung fand immerhin sichere Arbeitsplätze auf den Grabungen und verdiente mit Grabraub, Schmuggel und dem Verkauf von Fälschungen gut nebenbei.
Lästige Beeinträchtigungen eines lukrativen Geschäfts
„Die Schätze des Pharao“ spielt in einer Epoche, in der sich erster Protest gegen solche systematischen Plünderungen zu formieren beginnt. Es muss bitter für Idealisten vom Schlage einer Miss Skinner gewesen sein: Sie mögen damit gerechnet haben, dass sie sich in ihrem Bestreben, die Kunstschätze Ägyptens zu retten, den Zorn der ausländischen ‚Kunstfreunde‘ zuzogen. Doch auch die Ägypter selbst, für die sie besagte Schätze retten wollten, leisteten Widerstand oder blieben uninteressiert. Nach Jahrhunderten der Fremd- und Misswirtschaft existierte in der breiten Bevölkerung kein Bewusstsein für oder Stolz auf die eigene große und großartige Geschichte. Erst das Ende der Kolonialzeit brachte hier einen Wandel.
Aus der geschickten Umsetzung dieses Themas und den sich daraus ergebenden Konsequenzen zieht „Die Schätze des Pharaos“ seinen Unterhaltungswert. Auch der Rückblick in die Geschichte der britischen Schatten-Kolonie Ägypten besticht durch das offensichtliche Wissen des Autors um Land und Leute; Michael Pearce kennt die späte Phase der afrikanisch-britischen Kolonialgeschichte noch aus seiner Jugend im ägyptischen Sudan, in den er nach einigen Jahren in England als Lehrer zurückkehrte.
Wohl aus diesem Grund ist Pearce die Figurenzeichnung ausgezeichnet gelungen. Was aus der „Mamur-Zapt“-Serie hätte werden können, zeigen die in ähnlichen Kulissen spielenden, überlangen, vor angelesenem Buchwissen raschelnden, peinlich ‚komischen‘ Abenteuer um die viktorianische Archäologin Amelia Peabody, ihren Göttergatten und den unsäglichen Wundersohn Ramses, mit denen Elizabeth Peters viel zu viele Jahren die Freunde des Historienkrimis traktierte.
Land mit echten Leuten
Gareth Owen ist nicht der Tee trinkende, knarzige britische Offizier, der die ‚Wilden‘ väterlich Mores lehrt, sondern ein Mann, der selbst zu einer Minderheit zählt; er ist Walliser, was seinen Aufstieg in die höheren gesellschaftlichen Schichten und damit eine echte berufliche Karriere verbaut, ihn aber hellhörig macht für die Stimmen des ‚gewöhnlichen‘ Volkes.
Auch die einheimischen Ägypter müssen sich nicht mit der Rolle der pittoresken, wahlweise treuherzigen oder schurkischen ‚Eingeborenen‘ bescheiden. Pearce erspart ihnen auch das Schicksal des politisch korrekten Historienthrillers, der die Rolle des Bösewichts stets dem Ausländer überträgt, während die ‚edlen Wilden‘ sich als tragische Helden und Opfer darstellen lassen müssen. Pearces Ägypter sind – egal ob armer Wasserhändler, frustrierter Regierungsbeamter oder feudaler Pascha – Menschen mit den üblichen Ecken und Kanten. Die Schwierigkeiten einer quasi mittelalterlichen Gesellschaft im beginnenden 20. Jahrhundert gehen nicht nur auf die koloniale Fremdherrschaft zurück, sondern sind durchaus hausgemacht. Pearce verdichtet dies geschickt in der schwierigen Beziehung Owens zur unkonventionellen Aristokratentochter Zeinab, die weder von den Vorgesetzten und Kollegen des einen noch von der Familie der anderen gern gesehen wird.
Dass Michael Pearce neben feinem Humor Sarkasmus keineswegs fremd ist, stellt das zwiespältige aber sehr konsequente Finale seiner Geschichte unter Beweis. Glanzvoll kann Captain Owen die diversen Verbrechen des bis dato rätselhaften Falls aufklären und alle daran Beteiligten festsetzen – nur um sie sogleich wieder ziehen lassen zu müssen, da ihnen die riesigen Gesetzeslücken in Sachen Kunst-‚Handel‘ besser bekannt sind als dem Mamur Zapt. Der Verzicht auf den im Krimi auch heute noch üblichen Sieg des ‚Guten‘ rundet das Bild eines nicht tiefgründigen aber in den Grenzen seines Genres stimmigen, immer unterhaltsamen Romans ab. Dennoch merkwürdig mutet die Entscheidung der britischen „Crime Writers‘ Association“ an, dieses Buch 1993 mit einem „Last Laugh Dagger“ als humorvollsten Kriminalroman des Jahres auszuzeichnen.
Autor
Michael Pearce (*1933) wuchs im britisch beherrschten Sudan auf. Er verließ das Land nach einer Ausbildung zum Übersetzer, kehrte aber später als Lehrer dorthin zurück. Seine Kenntnis der russischen Sprache setzte Pearce während des Kalten Krieges für den militärischen Geheimdienst ein.
Herkunft und Berufserfahrung schlagen sich in der schriftstellerischen Karriere nieder. Pearce war bereits Mitte 50, als er seinen ersten Roman veröffentlichte. „The Mamur Zapt and the Return of the Carpet“ war gleichzeitig Start einer bis heute fortgesetzten Serie um den britischen Geheimpolizisten Gareth Owen im kolonialen Ägypten um 1900.
2004 begann Pearce eine zweite Reihe. Stets mit „A Dead Man in…“ beginnend, spielen die Abenteuer von Sandor Seymour, einem Officer in Scotland Yards 1883 gegründeter Special Branch, den das Außenministerium ruft, wenn es gilt, in der politisch turbulenten Ära vor dem I. Weltkrieg Verbrechen in Diplomatenkreisen aufzuklären.
Taschenbuch: 272 Seiten
Originaltitel: The Mamur Zapt and the Spoils of Egypt (New York : HarperCollins Publishers Ltd. 1992)
Übersetzt von Peter Pfaffinger
http://www.randomhouse.de/diana
Der Autor vergibt: 



Park, Robert – Fauler Zauber. Betrug und Irrtum in der Wissenschaft
„Voodoo Science“: Dieser wunderbare Begriff – im Deutschen nur unzulänglich mit „Fauler Zauber“ übersetzt – kennzeichnet ein Phänomen, das zwar so alt ist wie die menschliche Zivilisation selbst, aber erst in den letzten Jahrzehnten eine wahrhaft weltweite Dimension erreicht hat: Im Gewand der seriösen Wissenschaft erscheinen Scharlatane auf der Bildfläche und verheißen ihren Mitmenschen allerlei Wunder, die sie reich machen und ewig leben lassen werden. Doch hinter ihren aufregenden Versprechungen verbergen sich nur Dummheit, Selbsttäuschung oder gar Betrug. Sie täuschen nicht nur ihre Opfer mit oft traurigen Folgen, sondern fügen der Wissenschaft ernsten Schaden zu, indem sie ihren Ruf untergraben, ihr finanzielle Mittel und intellektuelle Kapazitäten entziehen und somit den echten Fortschritt verhindern. (Achtung: Ich warne gleich – Ihr Rezensent ist zwar dem Neuen gegenüber durchaus aufgeschlossen, reagiert aber trotzdem allergisch auf Maté-Tee & Sandelholz und zieht bei Grippe einen ordentlich Antibiotika-Stoß jedem Stussmorchel-Sud vor.)
Der Autor
Robert Park war bis 1981 ein Rädchen im Gefüge der Naturwissenschaften, die herauszufinden versuchen, wie die Welt tickt, in der wir leben. Obwohl er sich gut aufgehoben fühlte im Schoße der Forschung, war er kein weltfremder Reagenzglas-Schwenker, sondern durchaus vertraut mit der Realität außerhalb des Labors, die geprägt wurde von einem Werteverfall, der nicht nur das Ansehen der Wissenschaft, sondern sogar ihre Existenz bedrohte. Mittel wurden gekürzt, Forschung war „out“ und wurde besonders im Umfeld einer erstarkenden Umweltbewegung (gut) und eines anschwellenden „New Age“-Gewabers (ganz, ganz übel) geradezu verteufelt.
Statt sich in den Schmollwinkel zurückzuziehen, trat die Wissenschaft die Flucht nach vorn an – und das bedeutete schon 1981, die Medien und damit die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. So sah sich Professor Park schließlich in Washington, der Schaltzentrale der Macht in den USA, wo er dem neu gegründeten Büro für Öffentlichkeitsarbeit der „American Physical Society“ vorstand. Nur ein Jahr wollte er eigentlich bleiben – es wurden zwei Jahrzehnte daraus. Park gibt selbst offen zu, dass er, der sich bis dato mit der „Molekularstruktur kristalliner Oberflächen“ beschäftigt hatte, den aufregenden Alltag an der Publicityfront nicht mehr missen mochte. Zu wichtig ist ihm außerdem der Kampf gegen Voodoo Science, dem er sich inzwischen verschrieben hat.
Inhalt
In zehn Kapiteln öffnet Park sein Gruselkabinett des Pseudo-Wissens, das manchmal erheitert, noch öfter allerdings erschreckt, weil so mancher Mosaikstein, den der Leser fest ins Gefüge seines Weltbildes zementiert hat, ins Bröckeln gerät. In welchem Maße wir alle uns manipulieren lassen und Opfer von Voodoo Science werden, ohne uns dessen bewusst zu sein – das ist schon eine deprimierende Erfahrung!
„Wie Voodoo Science verpackt wird“ belegt die alte Weisheit, dass sich seit den Tagen der Marktschreier & Rosstäuscher eines nicht geändert hat: Die meisten Menschen glauben dem am liebsten, der ihnen etwas erzählt, das sie hören möchten und sich dabei möglichst kurz fasst. Komplexe Erklärungen und Erläuterungen sind aber nicht nur dem Pöbel, sondern auch viel beschäftigten Politikern, (scheinbar) kühlköpfigen Geschäftsleuten und vor allem den Medien ein Gräuel. Davon profitieren seit jeher Betrüger, denen es bis auf den heutigen Tag immer wieder gelingt, zahlende Anhänger der eierlegenden Wollmilchsau, des Perpetuum Mobiles oder der „kalten“ Kernfusion zu gewinnen.
In „Das Gen des Glaubens – Die Strategien der Wissenschaft zur Wahrheitsfindung“ macht Park die Schwierigkeiten deutlich, vor denen umgekehrt die Wissenschaft steht, wenn sie – konfrontiert mit angeblichen Wundern, die clevere Köpfe ohne Schlaumeier-Diplom kreiert haben – quasi mit einem auf den Rücken gebundenen Arm erläutern muss, wieso trotzdem nicht ist, was naturgesetzlich nicht sein kann. Nach wie vor funktioniert der Fortschritt primär so: „Wissenschaft ist der systematische Versuch, möglichst viel Wissen über die Welt zu sammeln und dieses Wissen durch überprüfbare Gesetze und Theorien umzusetzen.“ (S. 53) Das ist in der Regel ein mühsamer, langwieriger und vor allem langweiliger Weg, denn „1. Neue Gesetze und Ergebnisse müssen zur unabhängigen Überprüfung durch andere Wissenschaftler freigegeben werden“, und „2. Anerkannte Fakten und Theorien müssen aufgrund neuer, verlässlicher Einsichten korrigiert werden.“ (S. 54) So und nicht anders ist die Prozedur, doch sie ist unbeliebt in einer Gesellschaft, die über den Geldbeutel denkt bzw. lieber dem Herzen (oder dem Bauch) folgt als dem Hirn: „Der Glaube an etwas, das jeglicher Vernunft zuwiderläuft, wird als Standfestigkeit und Courage interpretiert, während Skepsis zumeist als Zynismus einer schwachen Persönlichkeit angesehen wird.“ (S. 51) Hinzu tritt das übliche Misstrauen gegen „die da oben“, die sich hinter schwer verständlichen Worten und weißen Kitteln verbergen und den einfachen und daher redlichen Mann um sein schwer verdientes Geld bringen wollen.
Wie besagter Mann (und natürlich auch die Frau) sich auf diese Weise erst recht übers Ohr hauen lässt, verdeutlicht Park im Kapitel „Placebos haben Nebenwirkungen, die Menschen zur ‚Naturmedizin‘ bringen“. Hier dürfte ihm die Aufmerksamkeit seiner Leser – Freunde wie Feinde – sicher sein, ist die Homöopathie doch eine regelrechte Industrie mit Milliardenumsätzen. Welche Mechanismen ausgefeilten Schwachsinns es möglich machen, den gesunden Menschenverstand davon zu überzeugen, dass ein Tropfen Schlangenöl in drei Millionen Litern „erinnerungsfähigen“ Wassers ein unfehlbares „Heilmittel“ erzeugen, stellt der Verfasser ebenso knapp wie drastisch vor.
Mit „Der virtuelle Astronaut lässt die Menschen von künstlichen Welten träumen“ wird sich Park ebenfalls keine Freunde schaffen. In den USA ist er in Raumfahrtkreisen schon lange gefürchtet und verhasst für seine (gut begründete, aber halt unromantische) These, dass der Mensch im Weltraum nichts verloren habe, da er dort rein gar nichts ausrichte, das hoch entwickelte Roboter und Sonden nicht sehr viel besser erledigen können.
„Wir brauchen endlich ein Gesetz gegen die Thermodynamik“ umschreibt ironisch den Zorn der Pseudo-Wissenschaftler und ihrer Anhänger angesichts der Tatsache, dass es manchmal eben doch Kontrollinstanzen und sogar Gesetze gibt, die Deppenfang und Sektierertum und die damit verbundenen Verdienstmöglichkeiten ärgerlich einschränken.
„Perpetuum Mobile – Der Menschheitstraum von frei verfügbarer Energie“ wird auch im 21. Jahrhundert mit derselben Inbrunst geträumt wie im Mittelalter. Die Konzepte für eine sich selbst in Gang haltende Maschine mögen zwar moderner anmuten, doch die Negierung der Naturgesetze und der inbrünstige Glaube von Menschen, die es eigentlich besser wissen müssten, an das Unmögliche sind klassische Größen, auf die sich Voodoo Science stets verlassen kann.
„Der Strom der Angst – Verursachen Hochspannungsleitungen Krebs?“ – Eine Mode-Furcht der jüngsten Vergangenheit, geboren aus Irrtümern, entwickelt von Toren und am Leben gehalten von skrupellosen Möchtegern-Forschern zum Erhalt von Fördergeldern und Arbeitsplätzen – und von jenen unverbesserlichen Predigern, die davon überzeugt sind, dass aller technischer Fortschritt letztlich von Übel ist und den Tag förmlich herbeisehnen, an dem sich Mutter Erde gegen ihre unverfrorenen Mieter wendet.
In „Am Tag des Jüngsten Gerichts wird die Pseudowissenschaft angeklagt“ beschreibt Park die infame Verbindung zwischen Voodoo Science, ihren verblendeten Opfern und opportunistischen Anwälten, die besonders in den USA die Eigenheiten eines Rechtssystems, das zwölf geistig möglichst schlichten Bürgern ein verbindliches Urteil selbst in hochkomplexen Tatbeständen zubilligt, eiskalt ausnutzen, um profitable Klage gegen die Naturgesetze zu führen.
„Nur Pilze wachsen im Dunkeln – und geheimgehaltene Voodoo Science“ – und natürlich ihre vielleicht hartnäckigsten Jünger: die UFO-Gläubigen, deren Adel jene Zeitgenossen bilden, an denen wissbegierige Außerirdische geni(t)alische Experimente vornahmen. Am Beispiel des „Untertassen-Absturzes“ von Roswell 1947 zeigt Park die absurden Automatismen auf, die ein Geheimnis oder eine Verschwörung genau dort am besten gedeihen lassen, wo keinerlei handfeste Beweise existieren.
„Wie seltsam ist das Universum? Wie alter Aberglaube als Pseudowissenschaft wiedergeboren wird“ markiert Parks fast hilflosen Versuch, noch einmal sachlich zu erklären, wieso die Sterne nicht den geringsten Einfluss auf die Menschen nehmen und Astrologie reiner Humbug ist. Aber gegen Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens, lautet ein altes Sprichwort, und Park ist klug genug, diesen Faktor in seine Darstellung einzubeziehen.
Bücher wie dieses sind rar: kundig recherchiert, klug gegliedert, ebenso informativ wie unterhaltsam in Worte gegossen. Menschen wie Robert Park verdanken wir es, dass ein frischer Wind durch unsere Hirne weht, der so manche Spinnweben davonbläst. Natürlich werden dies nur jene zu schätzen wissen, die sich im Vollbesitz jenes zarten Pflänzchens wissen, das wir den gesunden Menschenverstand nennen. Park selbst weist resignierend darauf hin, dass er diejenigen Zeitgenossen, denen ein wenig Nachhilfe in Sachen Vernunft und Objektivität bitter Not täte, wohl nicht erreichen wird. Er erinnert an den Verschwörungs-Fetischisten Fox Mulder, in dessen Büro ein Poster mit der Aufschrift „I want to believe“ hängt. Es ist nicht ohne Grund im realen Leben ein unerhörter Verkaufsschlager geworden, denn es spricht ein Grundbedürfnis des Menschen an: In einer zunehmend konformen, globalisierten, kommerzialisierten Welt bietet Voodoo Science ein willkommenes Hintertürchen, der schnöden Realität zu entfliehen. Da gleichzeitig nicht nur die Schere zwischen Reich und Arm, sondern auch die zwischen Wissen und Ignoranz immer weiter klafft, gewinnen die Pseudo-Wissenschaften weitere Anhänger. Sie bieten einfache Lösungen für komplexe Fragen an, die immer weniger Menschen verstehen können – oder wollen. So beginnt der schlichte Glaube das Wissen, das man sich nun einmal erarbeiten muss, zu verdrängen – mit verhängnisvollen Folgen.
Dankbar muss man Park auch für seine offenen Worte zur Verteidigung der Wissenschaft sein. Heutzutage neigt man als Mitglied dieser scheinbar so elitären Kaste, der indes Menschen wie du und ich angehören, sehr oft dazu, sich selbst klein zu machen, sein Wissen zu verbergen und sich quasi dafür zu entschuldigen, von gewissen Dingen mehr zu verstehen als seine Zeitgenossen. Park stellt klar, dass dies der falsche Weg ist, der nur der Voodoo Science in die Hände spielt. Er findet damit die Zustimmung Ihres Rezensenten, der schon lange fest davon überzeugt ist, dass echte, unverfälschte und unheilbare Dummheit eigentlich selten ist, während Unwissenheit häufiger vorkommt, aber keine Schande ist – es sei denn, sie ginge einher mit der aus Faulheit geborenen Weigerung etwas zu lernen. (Das Talent, Geld zu scheffeln, gilt nach dieser Definition übrigens nicht zwangsläufig als Indiz für Intelligenz.) Park bietet diese Chance zum Lernen und zum Überdenken; in der Einleitung gibt er bekannt, dass er sich nicht in Expertendunst hüllen, sondern in klaren Worten die Dinge beim Namen nennen möchte. Er hält sich daran und zerstört damit womöglich manchen Traum – ein Preis, den man (trotz der nach Ansicht fachlich kundigerer Kritiker mäßigen, weil diverse Fachtermini falsch oder missverständlich wiedergebenden Übersetzung) gern zahlt, weil man den wahren Lumpen dieser Welt nach der Lektüre nicht mehr gar zu leicht auf den Leim kriecht!
Taschenbuch: 255 Seiten
ISBN-13: 978-3203810058
Europa
Jinks, Catherine – Tod des Inquisitors, Der
Südfrankreich im Jahre des Herrn 1318. Sechs Jahrzehnte sind seit dem zweiten Kreuzzug gegen die Katharer oder Albigenser verstrichen. Diese Asketen-Sekte, deren Mitglieder die Bibel rigide auf eine Weise auslegten, die der offiziellen Deutung durch die katholische Kirche widersprach, wurde im Bund mit dem König von Frankreich erbarmungslos bekämpft und beinahe ausgerottet. Aber die Kirche vergisst nie jene, die es wagten, ihr die Stirn zu bieten. Das „Heilige Amt“, die Inquisition, ist stark in der Provinz Narbonne, einem Kernland der Albigenser, die hier länger als irgendwo sonst ausgehalten hatten, wo die nahen Pyrenäen Schutz und Flucht nach Spanien versprachen. Deshalb lebt die Häresie fort, heimlich zwar, doch hartnäckig.
Die kleine Stadt Lazet beherbergt in ihren Mauern die Priorei der Predigenden Brüder, eine Klostergründung des Dominikanerordens. 28 Mönche, 17 Laienbrüder und 12 Studenten leben, beten und arbeiten hier – und 178 Gefangene, verdächtig der Ketzerei, schmachten derzeit im Gefängnis des Heiligen Amtes. Der Papst – aktuell ist es Johannes XXII. – bedient sich gern der Bettelmönche als Inquisitoren; sie gelten als unbestechlich und streng in der Verfolgung der Glaubensfeinde. In Lazet ist gerade Jacques Vaquier, der oberste Inquisitor, gestorben. Sein Stellvertreter Bernard Peyre de Prouille fühlt sich der Nachfolge allein nicht gewachsen und bittet das Mutterhaus im fernen Paris, ihm einen Pater zu schicken.
Es erscheint Augustin Duese, ein fanatischer Ketzerfresser, der weder sich noch seine Mitbrüder schont, wenn es gilt, den Weisungen des Papstes Folge zu leisten. In Lazet hat sich im Laufe der Jahre ein gewisser Friede oder Waffenstillstand zwischen der Kirche, der einheimischen Bevölkerung und Roger Descalquencs, Seneschall König Philipps V. von Frankreich und Repräsentant der weltlichen Macht vor Ort, eingestellt. Duese fühlt sich nicht daran gebunden, wittert überall Ketzerei, Verderbnis und Verschwörung, ordnet Massenverhaftungen und -verhöre an, bringt die Menschen gegen sich auf, schürt geradezu vorsätzlich die Unruhe, die ihn nur noch bestätigt in seiner Mission. Doch zum Pulverfass wird die Situation erst, als Duese tatsächlich Hinweise auf heimliche Häresie, Korruption und politischen Verrat entdeckt. Schlimmer noch: Der verstorbene Inquisitor Vaquier war offensichtlich darin verwickelt. Nun gibt es für Duese kein Halten mehr: Die Inquisition kommt über Lazet!
Doch bevor sie richtig beginnen kann, werden Augustin Duese und vier Soldaten, die ihn begleiten und schützen sollten, auf einer Reise über Land überfallen, unweit des Dorfes Casseras getötet und in Stücke gehackt, die über den ganzen Landstrich verstreut werden. Die Täter verschwinden zunächst spurlos; Misstrauen und Furcht breiten sich aus. Der Schrecken eskaliert, als dem Fanatiker Duese als Inquisitor der engstirnige Pierre-Julien Fauré folgt, der überall nicht nur Ketzer, sondern Hexen und Teufel sieht und außerdem seit vielen Jahren Bernard Peyres Erzfeind ist. Gar zu gern würde Fauré ihm schaden – und die Gelegenheit ist günstig: Bernard, der zur Keuschheit verpflichtete Gottesmann, hat sich in die kluge und tapfere (und natürlich schöne) Edelfrau Johanna de Caussade verliebt, eine Beziehung, die beide in allerhöchste Lebensgefahr bringt …
„Der Inquisitor“/“Der Tod des Inquisitors“ (Taschenbuchtitel), ein Roman über das europäische Mittelalter, wurde verfasst von einer Autorin, die zumindest geografisch der Narbonne nicht ferner stehen könnte: Catherine Jinks wurde 1963 in Brisbane in der australischen Provinz Queensland geboren. Es wird noch exotischer: Ihre Jugendjahre verbrachte sie auf der Insel Neu-Guinea (deren Ostteil übrigens bis 1918 deutsche Kolonie war), bevor sie aufs Festland zurückkehrte, um an der Universität von Sydney Mittelalterliche Geschichte zu studieren. In dieser Stadt blieb sie und lebt hier mit ihrer Familie. Als Schriftstellerin wurde Jinks durch ihre Kinderbücher bekannt (und zweimal mit dem „Children’s Book Council Award“ ausgezeichnet), bevor sie sich 1996 mit „An Evening with the Messiah“ (dt. „Der Notar“) auch dem „erwachsenen“ Roman widmete.
Ob es wohl die Entfernung ist, die dem „Inquisitor“ eine erfreuliche Ausnahmestellung auf dem strapazierten Forum des Historien-Thrillers verschafft? Dieses Genre bietet nicht nur denen, die sich von Berufs wegen mit dem Mittelalter beschäftigen, immer wieder gute Gründe zu Zorn und Ärger. „Das Mittelalter“ scheint nach Ansicht gar zu vieler Schreiberlinge („Schriftsteller“ sollte als Berufsbezeichnung eigentlich gesetzlichem Schutz unterliegen!) ein Spielfeld zu sein, auf dem wie in der Science-Fiction oder im Horror grundsätzlich jeder Zug gestattet ist, da zwischen dem 11. Jahrhundert auf der Erde, dem 11. Jahrtausend irgendwo im Weltall oder dem 11. Kreis der Hölle nur marginale Unterschiede gemacht werden. Das Mittelalter verkommt zur exotischen Kulisse, in der sich Uralt-Allerweltskrimis abspielen, die zu allem Überfluss kräftig mit Seifenoper-Elementen versetzt werden. Selbst gut recherchierende Autoren repetieren oft seelenlos angelesenes Wissen, während ihnen ein echtes Verständnis des Mittelalters abgeht bzw. Normen und Geisteshaltungen der Gegenwart in die Vergangenheit projiziert werden.
So entsteht nur ein Disneyland-Mittelalter: Alles sieht halbwegs echt aus und ist doch nur Tand und Trug, wie St. Penetrantius, der Schutzheilige aller mönchischen Amateurdetektive vom Schlage eines Bruder Cadfael, wohl sagen würde. Auch Catherine Jinks hätte leicht in diese Falle tappen können. Sie lässt ihre Geschichte ausgerechnet im Umfeld der katholischen Inquisition spielen. Auf dieser Institution lastet eine Jahrhunderte dicke Schicht aus Legende, Missverständnis und wohlig übler Nachrede. Dumme, bornierte, fanatische, geile Pfaffen martern unschuldige, kluge, fortschrittlich denkende Frauen, Andersgläubige oder (mit weitem Abstand folgend) sogar männliche Gutmenschen: So könnte ein typischer Historien-Krimi um die Inquisition aussehen. Den Rest erledigt dann zuverlässig die politisch korrekte Empörung des klug gewordenen Lesers der Gegenwart über die gar schreckliche Vergangenheit.
Mit solchen billigen Tricks arbeitet Jinks nicht. Sie versteht es, das „Heilige Amt“ und jene, die ihm dienen, harmonisch in das historisierende Umfeld zu integrieren. Zwar übertreibe ich es jetzt, doch im zeitgenössischen Bewusstsein dürfte die Inquisition etwa dieselbe Präsenz wie heutzutage das Finanzamt besessen haben: unsichtbar über den Menschen schwebend und ihr Recht fordernd, aber doch nur selten auf sie herabstürzend, um einen Unglücklichen aus ihrer Mitte zu reißen. Das mittelalterliche Europa wurde keineswegs auf Jahrhunderte nachts von den Feuern der Inquisition erleuchtet, Ketzer und Hexen nicht wie Kaminholz verheizt. Unbestritten sind allzu viele scheußliche Verbrechen und Massenmorde im angeblichen Namen Gottes, aber objektiv fanden sie zeitlich und örtlich begrenzt statt.
Eine Zeitreise zurück ins Südfrankreich des 13. Jahrhunderts wünscht sich wohl allerdings kein denkender Mensch mit historischen Grundkenntnissen. Hier wurde über viele Jahre tatsächlich kein Pardon gegeben. Doch selbst hier ist 1318 wieder Ruhe eingekehrt. Die Inquisition gehört zum Alltag, Verhaftungen und Hinrichtungen kommen vor, aber das ist halt das Risiko der Ketzerei, die von der Mehrheit der Bevölkerung ohnehin nicht toleriert wird – und werden schließlich nicht Verrat, Mord und hundert andere Verbrechen von der weltlichen Gerichtsbarkeit mit Folter und Tod geahndet? Die Inquisitoren selbst sind keine Bestien in Menschengestalt, sondern fromme und hart arbeitende Männer (so fremd uns dies heute auch erscheinen mag). Bernard Peyre, unser Ich-Erzähler, ist sogar ein sehr sympathischer Zeitgenosse, freundlich, humorvoll, ein wenig schwach im Fleische – und doch ein sehr erfolgreicher Inquisitor, obwohl er brennende Scheiterhaufen nur schwer erträgt. Diesen Widerspruch löst Jinks nicht auf; sie überlässt es den Lesern, sich mit ihm auseinander zu setzen. Dabei fährt man am besten, wenn man akzeptiert, dass es ihn im Mittelalter so nicht gab.
Die differenzierte Figurenzeichnung hält Jinks bemerkenswert gut durch. Nicht einmal der düstere Augustin Duese oder sein unfähiger Nachfolger geraten ihr zur bloßen Karikatur, und ihre Frauengestalten stellt sie nie als präfeministische und lächerlich anachronistische Streiterinnen bloß, die anders als die Mönche, Ritter oder Patres (= die dummen Männer) nur Güte, Vernunft und menschliche Überlegenheit verstrahlen. Stattdessen findet Jinks die Nischen der nun einmal männlich bestimmten Gesellschaft des Mittelalters und platziert Frauen dort, wo sie sich nachweislich tatsächlich selbstständig entfalten konnten. Weil dies so stimmig ins Gesamtbild passt, merkt auch der historische Laie, dass ihm (oder ihr) hier nicht die nächste Schüssel des geschmacksneutralen Bruder-Katzenfell-Quarks vorgesetzt wird. Da kann er sich auch damit abfinden, dass die Auflösung des Krimiplots wie so häufig nicht halten kann, was zuvor versprochen wurde. Immerhin gibt’s nur ein gedämpftes Happy-End, was angesichts der in ihrer Vielfalt etwas konstruiert wirkenden Verwicklungen nur logisch scheint.
Bleibt noch die sorgfältige Übersetzung zu loben, die Catherine Jinks nie im Stich lässt. Sie hat sich überaus große Mühe gegeben, ihre Figuren nicht nur in eine mittelalterliche Welt zu versetzen, sondern bemüht sich, sie auch mittelalterlich denken und sprechen zu lassen. Da Bernard Peyre ein gelehrter Kleriker ist, führt dies zu einer Flut von Zitaten und Exkursen aus mehr oder weniger frommen Werken der Kirchengeschichte und bildhaft-biblischen Vergleichen. So etwas liest sich natürlich nicht so glatt herunter wie der aktuelle Ich-habe-nur-einen-Wortschatz-von-100-Wörtern-und-bin-stolz-darauf-Grisham-Reißer, besitzt aber seine ganz eigene Logik und seinen eigenen Reiz, der sich während der Lektüre rasch mitteilt. Dazu kommt ein fast unmerklicher, weil knochentrockener Humor, der gleichzeitig deutlich macht, dass auch die angeblich so vernagelten Menschen des Mittelalters sich der Widersprüche ihrer Zeit durchaus bewusst waren oder längst nicht in furchtsamer Ergebenheit vor der Obrigkeit ihr freudloses Dasein fristeten.
Hill, Reginald – Wald des Vergessens, Der
Detective Superintendent (dieses Mal in der Übersetzung seltsamerweise & unnötig als „Kommissar“ betitelt) Andrew Dalziel, „der dicke Andy“ (auch „das Ekelpaket“, „der fette Bastard“ usw.) genannt, absolutistischer Herr der Kriminalpolizei von Mid-Yorkshire, muss zu seinem Ärger kurzfristig auf seinen besten Ermittler und Freund Peter Pascoe verzichten. Dem ist seine streitbare Oma Ada gestorben, um deren Bestattung und Nachlass er sich nun zu kümmern hat. Dabei fällt ihm aus einem Geheimfach des großmütterlichen Sekretärs ein altes Foto in die Hände. Es zeigt seinen Urgroßvater, der während des Ersten Weltkriegs in einer der vielen Schlachten bei Ypern 1917 gefallen ist.
Peter wird neugierig. Über ihren Vater hatte Ada nie reden wollen. Stattdessen stellte sie einen lebenslangen Hass auf alles Militärische zur Schau. Weil ihn das schlechte Gewissen plagt – mit der Großmutter hatte er sich vor Jahren zerstritten -, stellt er Nachforschungen über seinen Vorfahren an. Aus Interesse wird rasch Besessenheit, denn Peter stellt fest, dass ein düsteres Geheimnis das gar nicht so offizielle Ende des alten Soldaten umgibt.
In Mid Yorkshire lauert freilich schon Andy Dalziel auf seine Rückkehr. Militante Tierschützer haben ein versteckt im Wald gelegenes Pharmalabor überfallen. Es misslang ihnen, durch den Sperrgürtel ins Innere vorzudringen. Stattdessen fanden sie in einem Schlammloch ein menschliches Skelett. Dies lag dort wohl schon länger als das Labor existiert. Trotzdem ist Dalziel misstrauisch. Ihn irritiert der enorme Sicherheitsaufwand, der hier getrieben wird. Der Laborleiter ist auffallend nervös. Unter dem paramilitärisch gedrillten Wachpersonal erkennt Dalziel alte Bekannte, die manches Gefängnisjahr abgebrummt haben. Was geht also wirklich vor hinter diesen vorzüglich abgeschirmten Mauern – und hat Dalziels neue Liebe, die anarchistische Cap Marvell, etwas damit zu tun …?
Die Lektüre eines Dalziel/Pascoe-Romans von Reginald Hill bereitet dem vergnügten Leser jedes Mal eine Überraschung: Was hat sich der Verfasser nun wieder einfallen lassen, um sein Publikum zu unterhalten? Es gibt D/P-Krimis à la Agatha Christie, Politthriller, Noir-Parodien, Geister treten auf … Hills Fantasie sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Mit Genreelementen treibt er sein intelligentes Spiel. Puristen mögen ihm das übel nehmen. Wagemutige Leser dagegen schätzen es, immer wieder intelligent aufs Glatteis geführt zu werden – nun mit einem Historien-Drama; einem halben jedenfalls, denn Hill vergisst auch jene nicht, die einen „richtigen“ Mordfall gelöst sehen möchten (um stattdessen doch wieder aufs Kreuz gelegt zu werden).
Der Erste Weltkrieg, den man in England immer noch den „Großen“ nennt, gehört in die Reihe der nationalen Triumphe und Tragödien der Inselnation. Der zeitlich nähere Kampf gegen Nazideutschland verdeckt manchmal die Erinnerung an die unmenschlichen Schützengrabenschlachten zwischen 1914 und 1918, denen 750.000 Engländer zum Opfer fielen.
Der Triumph bestand darin, dass Großbritannien 1918 zu den Siegernationen gehörte. Auf diese Seite wird vor allem von offizieller Seite gern und oft aufmerksam gemacht. Von der Tragödie spricht man dagegen weniger gern: Tatsache ist, dass dieser Sieg nicht wegen, sondern trotz militärischer Befehlshaber errungen wurde, die ihre Soldaten unzureichend ausgerüstet in völlig sinnlose Kämpfe schickten, wo sie nicht selten täglich zu Zehntausenden umkamen. Erst recht nur ansatzweise thematisiert wird das Schicksal von Kämpfern wie dem älteren Pascoe, die zwar überlebten, durch das erlebte Grauen in den Kraterlöchern und Schützengräben jedoch buchstäblich verrückt wurden. Sie verdarben das glanzvolle Siegesbild, befleckten es gar, denn manchmal taten sie das Undenkbare: Statt für das Vaterland in einem namenlosen Schlammloch zu verrecken, ergriffen sie die Flucht, wollten nur nach Hause. Die Konsequenz: der Tod durch ein Hinrichtungskommando, das aus den eigenen Kameraden bestand. Es braucht keinen Feind, um vom Krieg verschlungen zu werden. Diese bittere Lektion ist es, die Peter Pascoe lernen muss, der auf seiner Zeitreise seine schwierige Familiengeschichte bewältigt und erleidet.
Wem das zu schwermütig klingt, sei auf die Eskapaden des fidelen Falstaff-Kriminalisten Andy Dalziel hingewiesen. In regelmäßigen Abständen tritt er in seiner unnachahmlichen Art auf die Bühne. Als Polizist dieses Mal kaum gedämpft von seinem Partner, läuft er zu ganz großer Form auf. Wie ein Tornado fällt er über Freund und Feind, über Verdächtige, Kollegen und ignorante Amtsträger gleichermaßen her. Kein bisschen lässt er sich durch die ungeschriebenen Regeln des Establishments beeindrucken: Hilfst du mir, dann geb’ ich dir – und Maul gehalten vor dem dummen Pöbel! Nichtsdestotrotz kennt Dalziel sich aus im Gefüge der Macht. Er ist seinen Gegnern stets einen Schritt voraus und verwirrt sie mit unerwarteten Schachzügen. So dröselt er den rätselhaften Todesfall am Großlabor denn auch von hinten auf und schlägt bei den Ermittlungen erstaunliche Hasenhaken. Natürlich löst er den Fall – aber der Leser darf sich an einer wendungsreichen Jagd erfreuen.
„Fröhliches Mäandern“ ist ohnehin ein Markenzeichen der Dalziel/Pascoe-Romane. Viele Krimileser der alten Schule (Untat – Ermittlung – Überführung – Sühne) ärgern sich über die Abschweifungen, die den Verfasser manchmal den roten Faden aus den Augen verlieren lassen. Reginald Hill hält sich nicht daran. Wieso auch, ergänzt er den klassisch strengen Handlungsablauf doch durch unterhaltsame Episoden, die zudem eine Chronik von Mid-Yorkshire erkennen lassen, die über nun schon viele Bände fortgesetzt wird. Und Vorsicht: Es kann durchaus sein, dass eine scheinbare Nebensache an anderer Stelle oder gar in einem späteren Roman wieder aufgegriffen wird. Insofern ist es natürlich schade, dass die D/P-Serie in Deutschland völlig planlos erscheint.
Nebenbei streut Hill, der Literaturkenner, wieder reichlich Zitate aus alten, halb oder ganz vergessenen Buch- oder Theaterklassikern ein. Man muss sie nicht zur Kenntnis nehmen. Sie bieten ein zusätzliches (intellektuelles) Vergnügen, denn sie kommentieren das Geschehen und geben versteckte Hinweise auf den Fortgang der Handlung. Zum ersten Mal folgt dem Roman zudem ein Glossar, das jene Anspielungen auflöst, welche die Übersetzung nicht überstanden – Hill ist ein Meister des Wortspiels – oder zu schade zum Überlesen sind; ein hübscher Einfall.
Mehr Raum als sonst räumt Reginald Hill wie schon gesagt dem unvergleichlichen Dalziel ein. Normalerweise dosiert er dessen Auftritte klug, so dass man sich freut, ihn wirken und wüten zu sehen. Peter Pascoe und – auf seine eigene, stille Weise – Sergeant Wield puffern seine Einmannfeldzüge normalerweise ab. Wir lesen außerdem oft nur indirekt über Dalziels Eskapaden, die von ehrfürchtigen Kollegen, Freunden und den vom Dalziel-Blitz Getroffenen im Stile von Heiligenlegenden erzählt werden. So nutzt sich die Figur nicht ab und kann ihre Einzigartigkeit sichern.
Dieses Mal stellt Verfasser Hill seinen Helden vor eine sogar für ihn schwere Herausforderung: Dalziel verliebt sich. Das ist für einen Mann seines Charakters eine ernste Sache, zumal die Angebetete erstens ebenfalls über einen veritablen Dickkopf verfügt und zweitens als Verdächtige in mindestens einem Mordfall gilt, was den auf Freiersfüßen wandelnden (oder besser stampfenden) Dalziel zu einem aberwitzigen Eiertanz zwischen Balz- und Ermittlungsspielchen zwingt.
Peter Pascoe ist der zögerliche oder besser nachdenkliche Part des dynamischen Duos. Nur zu oft muss Dalziel darauf achten, dass aus Denken nicht Grübeln wird. Pascoe neigt dazu, die Welt sehr schwer zu nehmen. Ihm geht das Talent seines Vorgesetzten und Freundes ab, Unerfreuliches an sich abtropfen zu lassen wie eine Ente das Wasser. Die Suche nach dem getilgten Urgroßvater ist ein Beispiel für Pascoes Engagement sowie sein Talent, sich in eine Sache zu verrennen. Dazu kommt seine liberale Ader, die ihm manchen inneren Konflikt beschert. Pascoe ist nicht zufrieden mit dem System, das allzu viele Schlupflöcher für schlaue Strolche mit guten Beziehungen bietet, während mancher arme Tropf auf der Strecke bleibt. Forciert wird dieser Konflikt durch Peters Gattin Ellen, eine nur mühsam zu mäßigende Radikale, die um der guten Sache gern bereit ist, öffentlichen Ärger zu beschwören, was der Karriere ihres Ehemanns verständlicherweise nicht gerade förderlich ist.
Dieses Mal geht es also gegen die Pharmaindustrie bzw. ein Labor, in dem Präparate an Tieren getestet werden. Ein militantes „Rettungskommando“ Mid-Yorkshirer Aktivistenfrauen begibt sich auf einen nächtlichen Einsatz. Was mit den befreiten Kreaturen geschehen soll, die in der freien Natur schneller umkommen würden als im besagten Labor – darüber haben sie sich keine Gedanken gemacht. Das ist auch unwichtig, denn es geht primär um „die Sache“: Hier macht sich Hills ironischer Witz besonders deutlich bemerkbar. Die meisten seiner Figuren sind leicht überzeichnet. Den Dalziel/Pascoe-Romanen fehlt der seifenoperliche Grundton, der pseudodramatisch-kitschige Beziehungsdramen aus einem schwierigen Polizistenleben in den Kriminalplot zwingen will. Hill kann ernst, nachdenklich, traurig werden. Er stülpt dies der Handlung jedoch nicht über oder lässt es diese gar überwuchern. (Man lese nur einen Elizabeth-George-Thriller aus jüngerer Zeit, dann ist sogleich klar, was gemeint ist.)
Lässt Hill also den nötigen Ernst vermissen? Wer legt eigentlich fest, dass nur ein „ernster“ Krimi ein „guter“ Krimi ist? Genau diese Haltung räumt zumindest hierzulande einem Henning Mankell immer das Primat vor einem Reginald Hill, einem Ian Rankin, einem Carl Hiaasen ein, die wichtige Themen und kluge Gedanken mit Witz präsentieren. Das ist ausgesprochen ungerecht sowie falsch, und das scheint auch dem deutschen Publikum klar geworden zu sein, das inzwischen die D/P-Serie so aufmerksam zur Kenntnis nimmt, dass sich die Lücken zwischen den übersetzten Bänden allmählich schließen.
Reginald Hill wurde 1936 in Hartlepool im Nordosten Englands geboren. Drei Jahre später zog die Familie nach Cumbria, wo Reginald seine gesamte Kindheit verbrachte. Später studierte er an der University of Oxford und arbeitete bis 1980 als Lehrer in Yorkshire, wo er auch seine beliebte Reihe um die beiden ungleichen Polizisten Andrew Dalziel und Peter Pascoe ansiedelte.
Deren Abenteuer stellen nur eine Hälfte von Hills Werk dar. Der Schriftsteller ist fleißig und hat insgesamt mehr als 40 Bücher verfasst – längst nicht nur Krimis, sondern auch Historienromane und sogar Science-Fiction. Einige Thriller erschienen unter den Pseudonymen Dick Morland, Charles Underhill und Patrick Ruell. Erstaunlich ist das trotz solcher Produktivität über die Jahrzehnte gehaltene Qualitätsniveau der Hill-Geschichten. Das schlägt sich u. a. in einer wahren Flut von Preisen nieder. Für „Bones and Silence“ zeichnete die „Crime Writers‘ Association“ Hill mit dem begehrten „Gold Dagger Award“ für den besten Kriminalroman des Jahres 1990 aus. Fünf Jahre später folgte der „Diamond Dagger“ für seine Verdienste um das Genre. Reginald Hill lebt mit seiner Frau Pat in Cumbria.
In Deutschland erschienen die frühen Dalziel/Pascoe-Romane im Wilhelm-Goldmann-Verlag. Nach mehr als zehnjähriger (beklagenswerter) Pause nahm sich das Verlagshaus |Europa| der Serie an und veröffentlichte die neueren Episoden vorzüglich übersetzt und angemessen im Hardcover. Die Taschenbuch-Ausgaben erscheinen bei |Knaur|. Inzwischen hat der Erfolg wohl auch hierzulande Reginald Hill endlich gefunden: Der 20. D/P-Roman („Die Launen des Todes“) erscheint bei Droemer, zeitgleich bringt Europa den „Wald des Vergessens“ auf den Buchmarkt.
Die Dalziel/Pascoe-Serie:
01. A Clubbable Woman (1970, dt. „Eine Gasse für den Tod“) – Goldmann Krimi Nr. 4070
02. An Advancement of Learning (1971, noch kein dt. Titel)
03. Ruling Passion (1973, noch kein dt. Titel)
04. An April Shroud (1975, noch kein dt. Titel)
05. A Pinch of Snuff (1978, dt. „Der Calliope-Club“) – Goldmann Krimi Nr. 4836 u. 4991
06. A Killing Kindness (1980, dt. „Der Würger von Yorkshire“) – Goldmann Krimi Nr. 5230
07. Deadheads (1983, dt. „Welke Rosen muss man schneiden“) – Goldmann Krimi Nr. 4996
08. Exit Lines (1984, noch kein dt. Titel)
09. Child´s Play (1987, dt. „Kein Kinderspiel“) – Goldmann Krimi Nr. 5054
10. Under World (1988, dt. „Unter Tage“) – Goldmann Krimi Nr. 5108
11. One Small Step (1990, noch kein dt. Titel)
12. Bones and Silence (1990, dt. [„Die dunkle Lady meint es ernst“) 194 – Europa Verlag
13. Recalled to Life (1992, dt. [„Ins Leben zurückgerufen“) 350 – Europa Verlag
14. Asking for the Moon (1994, noch kein dt. Titel)
15. Pictures of Perfection (1994, dt. [„Der Schrei des Eisvogels“) 206 – Knaur TB Nr. 62441
16. The Wood Beyond (1996, dt. „Der Wald des Vergessens“)
17. On Beulah Height (1998, dt. „Das Dorf der verschwundenen Kinder“) – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 61984
18. Arms and the Women (1999, dt. [„Das Haus an der Klippe“) 633 – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 61983
19. Dialogues of the Dead (2001, dt. [„Die rätselhaften Worte“) 857 – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 62400
20. Death´s Jest-Book (2002, dt. „Die Launen des Todes“) – Droemer Verlag (geb.)
21. Good Morning, Midnight (2004, noch kein dt. Titel)
22. For Love nor Money (2005; noch kein dt. Titel)
23. Secrets of the Death (2005; noch kein dt. Titel)
Wir treffen unsere Helden außerdem in:
Pascoe´s Ghost and Other Brief Chronicles of Crime (1979, dt. „Das Rio-Papier und andere Kriminalgeschichten“) – Goldmann Krimi Nr. 5216
Arnaud Delalande – Das Vermächtnis von Mont Saint-Michel

Diana Norman – An den Ufern der Dunkelheit

Mary Logue – Totes Wasser
Pepin County ist abgelegener Landstrich im US-Staat Wisconsin. Farmer bilden die Mehrheit der Bevölkerung, die Umgebung wird von schier endlosen Getreidefeldern geprägt. Das Verbrechen blieb bisher durchschaubar. Auch der neue Fall der Polizistin Claire Watkins scheint Routine zu sein: Aus einer Scheune ist eine große Menge kostspieliger Pestizide verschwunden. Was nach einem simplen Diebstahl aussah, wird jedoch rasch bedrohlich Direkt vor dem Polizeirevier wird ein Blumenbeet vergiftet, dann eine Schar Hühner ausgerottet.
Dahinter steckt kein Kinderstreich. Vor Ort findet die Polizei jeweils einen menschlichen Fingerknochen. Die Drohung ist klar: Hier ‚übt‘ ein Wahnsinniger mit dem Gift und lernt es zu dosieren. Ebenso sicher sind sich Watkins und ihre Kollegen, dass sich der Dieb nicht mit Attentaten auf Grünzeug und Federvieh zufrieden geben wird. Tatsächlich hat der Rachefeldzug für eine ungesühnte Bluttat begonnen. Vor fünfzig Jahren wurde die gesamte Familie Schuler auf ihrer Farm niedergemetzelt. Sieben Personen fanden einen grausamen Tod. Jeder Leiche wurde ein Finger abgeschnitten. Das Verbrechen wurde niemals aufgeklärt. Vielleicht haben sich die braven Bürger und Nachbarn auch nicht besonders intensiv bemüht: Die Schulers stammten aus Deutschland und galten nach dem Ende des II. Weltkriegs als unerwünschte Zeitgenossen. Mary Logue – Totes Wasser weiterlesen
Dan Simmons – Das Schlangenhaupt
Darwin Minor ist ein Mann mit Vergangenheit; ein Vietnam-Veteran mit typischem Trauma, was ihn aber nicht hinderte, zum Doktor der Physik zu promovieren. Im Zivilleben verdient sich Minor seine Brötchen als Spezialist für die Rekonstruktion von Unfallursachen. Seit er nicht mehr für den Öffentlichen Dienst arbeitet, sondern bei einer kleinen für Schadenregulierungen angeheuert hat, die vom grantigen Lawrence Stewart und seiner Gattin Trudy geleitet wird, bereiten ihm seine Schwierigkeiten im Umgang mit Vorgesetzten und Respektspersonen keine gravierenden Probleme mehr. Minor gilt als As und wird gern bei allen möglichen und vor allem unmöglichen Zwischenfällen zu Rate gezogen, die Menschenleben kosten und versicherte Sachschäden verursachen.
Obwohl sich darunter delikate Fälle befanden, hatte Minor bisher mit dem organisierten Verbrechen wenig zu tun. Das ändert sich, als ihn eines Tages russische Mafiakiller auf offener Straße mit Maschinengewehren beschießen. Der Anschlag misslingt, und Minor bringt die Strolche zur Strecke. Um die Hintermänner zu fassen, arbeitet er unwillig mit der Polizei und dem Geheimdienst zusammen. Dan Simmons – Das Schlangenhaupt weiterlesen
George Baxt – Mordfall für Tallulah Bankhead
New York, 1952: Die Hexenjagd des paranoiden US-Senators Joseph McCarthy ist auf ihrem Höhepunkt. Sie richtet sich gegen „Kommunisten“, echte oder eingebildete, die sich vor dem „House Committee on Unamerican Activities“ (HUAC) zu ihren „unamerikanischen Aktivitäten“ äußern müssen. Befindet sie dieses Tribunal für schuldig, werden sie bestraft, finden sich auf einer Schwarzen Liste wieder und erhalten praktisch Berufsverbot.
Die Künstlerwelt ist dem HUAC schon lange ein Dorn im Auge. Sie gilt als Stall allzu freidenkender Salon-Kommunisten, den es endlich auszumisten gilt. Um ihre Pfründen bangend schlagen sich die großen Filmstudios in Hollywood, aber auch Radiostationen, Theater und sogar Nachtclubs im ganzen Land auf die Seite der Hexenjäger. Diese zwingen ihre Opfer unter Androhung hoher Strafen dazu, Namen von „Kommunisten“ zu nennen. Die Folge: ein blühendes Denunziantentum. George Baxt – Mordfall für Tallulah Bankhead weiterlesen
Monaldi, Rita / Sorti, Francesco – Imprimatur
11. bis 25. September 1683: zwei Wochen im heißen römischen Spätsommer, welche die Weltgeschichte verändern könnten. In der Locanda del Donzello, einer der zahllosen kleinen Herbergen der Ewigen Stadt, stirbt ein Gast, der alte französische Edelmann de Mourai. Die Umstände weisen auf einen Pestfall hin, was die Stadtverwaltung umgehend und rigoros handeln lässt: Die Herberge wird mit Brettern vernagelt und bewacht, ihre Bewohner unter Quarantäne gestellt.
Diese sind empört und voller Furcht. Dabei schließt Cristofano, ein berühmter Arzt aus Siena, die Seuche als Todesursache aus. Er tippt vielmehr auf Gift. Dass sich ein Mörder unter ihnen befinden könnte, kann die Gruppe ganz und gar nicht beruhigen. Aber die Theorie scheint sich zu bewahrheiten, als Pellogrino des Grandis, der Wirt der Herberge, einen mysteriösen Unfall erleidet und schwer verletzt aufgefunden wird.
Der Abbé Atto Melani aus Pistoia beschließt, sich als Detektiv zu versuchen. Ihm zur Seite steht der Hausbursche der Locanda del Donzello. Der junge Mann, ein Waisenkind, das eine gute Ausbildung erfuhr, begrüßt begeistert die Möglichkeit, die Grenzen seiner engen Welt zu erweitern. Die Schar der Verdächtigen ist bunt. Roberto Devizé, Musiker aus Paris, gehört zu ihnen, dazu gesellen sich Pater Juan des Robleda, Jesuit aus dem spanischen Granada; Domenico Stilone Priàso, Dichter aus Neapel; Angélo Brenozzi, Glasbläser aus Venedig; Pompeo Dulcibeni aus Fermo, des Verstorbenen de Mourais Reisebegleiter; Eduardus Bedfordi, ein Engländer – und Clorida, die wunderschöne Kurtisane.
Sie alle, so erfahren die Detektive rasch, sind nicht jene, für die sie sich ausgeben. Alle hüten sie ein düsteres Geheimnis, scheinen verwickelt in ein mörderisches Intrigenspiel, das ganz Europa umspannt. Es geht um nichts weniger als die Verteidigung Europas gegen die Türken, deren offenbar unüberwindlichen Heere Wien, das letzte Bollwerk des Abendlandes, belagern. Der habsburgische Kaiser ist geflohen. Papst Innozenz XI. will sich statt seiner zum Haupt des Widerstands aufschwingen. Die Könige Europas hören auf ihn – mit einer Ausnahme: Louis XIV., Frankreichs „Sonnenkönig“, missgönnt Innozenz den politischen Machtzuwachs. Wie es scheint, ist der machtgierige Souverän sogar bereit, sich mit den Türken zu verbünden.
Alle Parteien setzen Geheimagenten ein. Ausgerechnet in der Locanda del Donzello scheinen sich einige der berühmtesten Vertreter ihrer geheimnisvollen Zunft versammelt zu haben. Ihre Aktivititäten setzen sie trotz der Quarantäne fort. Dabei gehen sie durch düstere Geheimgänge – und über Leichen. Der Größte unter diesen Spionen ist – der Hausbursche erkennt es mit Schrecken – Atto Melani, der „Ratgeber“ des Sonnenkönigs. Den übrigen „Gästen“ traut er noch weniger. Wohl oder übel hält er sich deshalb an Melani. Der hat aber noch eine private Rechnung offen, die zu tilgen ihn und alle, die sich in seinem Umfeld bewegen, in Lebensgefahr bringen wird …
Die Welt des Jahres 1683, eine für den Menschen der Moderne fremdartige, exotische Ära, projiziert in die kleine, überschaubare Locanda del Donzello, die gleichzeitig Schauplatz eines „locked room“-Mysteriums des klassischen Kriminalromans wird. Grundsätzlich lassen beide Aspekte kaum Wünsche offen. Zehn Jahre haben die beiden Autoren (laut Klappentext) an ihrem Opus gearbeitet; man glaubt es gern, denn die Fülle der Fakten, die vor dem Leser ausgebreitet werden, ist beeindruckend. Politik, Religion, Medizin, Handwerk, Architektur, Kochkunst, Alchemie, Musik – Das Große, Wichtige mischt sich mit dem Alltäglichen. Dies entfaltet durchaus seine Wirkung, wirkt über weite Passagen freilich wie angelesenes Wissen, das um jeden Preis Eingang in die Handlung finden musste.
Solche gelehrten Vorträge und Diskussionen blähen die Geschichte auf, bis man sie nur mehr in ein backsteindickes Buch pressen kann, das sich fabelhaft als „Bestseller“ auch für „anspruchsvolle Leserschichten“ vermarkten lässt. Dabei ist das Schielen nach dem großem Vorbild mehr als offensichtlich: Umberto Eco verzwirbelte 1980 in „Der Name der Rose“ kongenial Historie und Thriller. Dieses Werk brachte eine quasi industrielle Fertigung von Romanen in Gang, die in und mit der Vergangenheit spielen. Um die meisten schlage man besser einen weiten Bogen. „Imprimatur“ spielt in einer höheren Liga. Die unnachahmliche Leichtigkeit, mit der Eco zwischen Wissenschaft und Unterhaltung wandelte, geht Monaldi & Sorti allerdings ab.
Sie streben wie gesagt allzu deutlich – wenn nicht nach dem „Meisterwerk“, so sicherlich nach dem „Bestseller“. Letzteres mag gelingen, zu Ersterem fehlt eine Menge. So ist es keine gute Idee, die Protagonisten über viele hundert Seiten in der abgeriegelten Locanda festzuhalten. Die Mär von der Europa überspannenden Verschwörung lässt sich partout nicht mit dem klassischen „Mord im verschlossenen Raum“ kombinieren. Folgerichtig kommt erst dann Schwung in die Handlung, als sie durch unzählige Geheimgänge die Herberge verlässt. In den Straßen und Gassen Roms gewinnt die Geschichte sogleich Dynamik, es wird weniger geredet als gehandelt.
Es wurde auch Zeit, denn die Story verdient die Aufmerksamkeit, die ihr endlich zuteil wird. Das Autorenduo hat sich viel Mühe gegeben, ein zentrales Kapitel der europäischen Geschichte auf ungewöhnliche Weise zu „rekonstruieren“. Nie sollte sich der Leser sicher sein, hinter das „Imprimatur“-Mysterium zu blicken – es verwandelt sich ständig, enthüllt neue Seltsamkeiten, mündet in deduktiven Sackgassen, ändert die logische Richtung, schließt Irrtümer und Fehlinterpretationen der Handelnden niemals aus. Die Autoren haben zu jedem Zeitpunkt die Nasen vorn. Noch besser: Die unzähligen Rätsel, die bis dato aufgeworfen wurden, finden im wahrlich großen Finale nicht nur ihre Auflösung. Diese kann ihrer gewaltigen Vorgeschichte standhalten, ohne durch allzu läppische, womöglich aus dem Hut gezogene „Lösungen“ zu verärgern. Die Autoren haben unzählige historische Puzzleteile famos zusammengesetzt. So muss es auch sein am Ende eines Romans, in den man immerhin die Zeit für die Lektüre von mehr als 700 Seiten investiert hat!
Zehn Jahre Arbeit haben Monaldi & Sorti in ihr Werk investiert. Sie möchten offenbaren, welche Mühe sie sich gegeben haben. Viel Staub haben sie in zahlreichen Archiven geschluckt, sich durch meterdicke Stapel staubiger Uralt-Quellen gewühlt, obskure Hinweise kreuz und quer durch Europa verfolgt. Was sie teilweise herausgefunden, teilweise neu entdeckt haben, fließt beeindruckend in „Imprimatur“ ein. Dem eigentlichen Roman folgt indes eine fünfzigseitige wissenschaftliche Abhandlung, die das gerade Geschriebene noch einmal aufgreift und vertieft: Dem Autorenduo gönnt man seinen Triumph, aber es ist zu fürchten, dass die meisten historischen Laien diesen Abschnitt großzügig überspringen. Der skeptische Fachmann wiederum wird sich – die Autoren erwarten nichts anderes – wohl kaum dem Schluss anschließen, das letzte Wort zum Reizthema „Innozenz XI. – Held der Geschichte oder infamer Intrigant“ sei nunmehr gesprochen.
Was die Handlung lange an Wünschen offen lässt, kann die Figurenzeichnung jederzeit ausgleichen. Natürlich gehen die Autoren auch hier an sich schematisch vor: Cristofano ist nicht e i n Arzt, sondern d e r Arzt, d. h. der Modellmediziner für seine Epoche, der immer eine Gelegenheit findet, seine Zuhörer und damit uns, die Leser, über den Stand seiner Wissenschaft (die arg an mittelalterliche Magie erinnert) in Kenntnis zu setzen. Ähnliches gilt für die anderen Protagonisten; sie stellen Repräsentanten weiterer Schichten des ausgehenden 17. Jahrhunderts: Kleriker, Adliger, Künstler, Handwerker, Kurtisane etc. Was sie zu sagen haben, ist wie bereits erwähnt oftmals interessant, nicht selten jedoch abschweifend und langweilig. Vor allem trägt es kaum zur Handlung bei.
Das Schema durchbricht der (stets anonym) bleibende Hausbursche. Die Autoren formen ihn zum Wanderer zwischen den Welten bzw. Ständen, deren Grenzen er als Diener vieler Gäste und nun in der Quarantäne überschreiten kann. Dumm ist er keineswegs, sondern naiv und unerfahren. Das muss er auch sein, denn er mimt nach dem Willen des Autorenduos den „reinen Toren“, der staunend und ohne eigenes Verschulden in ein Abenteuer oder eine Krise gerät. Der Hausbursche vertritt den Leser/die Leserin, die in der Regel wenig Ahnung haben von der Welt des Jahres 1683. Gemeinsam mit ihm werden wir vom Autorenduo durch die übrigen Figuren informiert. Das funktioniert gut, nur manchmal wird dieses Muster ein wenig zu offensichtlich.
Gleichzeitig ist der Hausbursche der „Watson“ in einer Kriminalgeschichte. Von der Kriminalistik bzw. der Unterwelt der zeitgenössischen Geheimdienste versteht er ebenfalls nichts. Deshalb stellt er die dummen Fragen, die auch uns Lesern ständig auf der Zunge liegen. Geduldig werden sie beantwortet vom „Holmes“, hier verkörpert durch den Abbé Melani, der wie alle genialen Schnüffler gern und ausgiebig über seine Arbeit spricht. Auch hier ist Monaldi/Sorti ein farbenfroher Charakter geglückt – Melani ist nicht nur ein mit allen Wassern gewaschener Agent, dem man besser nicht zu viel Vertrauen schenkt, sondern auch ein genialer Sänger, den man zur „Konservierung“ seiner Singstimme in jungen Jahren entmannt hat; auch so eine seltsame Sitte der Vergangenheit, die uns die Autoren nahe bringen …
Der ständigen Unsicherheit darüber, welchem Bewohner/Insasse der Locanda eigentlich zu trauen ist (keinem nämlich), verdankt „Imprimatur“ einen Gutteil seines Unterhaltungswerks. Hier haben die Verfasser wirklich gute Arbeit geleistet. Die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß verschwimmen ständig. Die Bösen sind oft tragisch, ehrlich, witzig, die Guten berechnend, durchtrieben, undurchschaubar. Wie der arme Hausbursche bekommen wir einfach keinen festen Boden unter die Füße und reihen uns in die lange Reihe der „Besiegten“ ein, denen der Hausbursche seine Erinnerungen widmet.
Stets präsent, obwohl nur in wenigen Sätzen anwesend, ist Papst Innozenz, der letztlich alle seine Widersacher niederwirft oder schlicht überlebt. Er ist der wahre Bösewicht in diesem Spiel – ein hochintelligenter, aber skrupelloser Mann, der sein Amt um des eigenen Vorteils willen als Instrument seiner Macht- und Geldgier missbraucht und die Spuren seiner Schandtaten so perfekt zu verwischen weiß, dass spätere Generationen seine Heiligsprechung verlangen.
In diesem Zusammenhang stoßen Monaldi & Sorti selbstverständlich in das Horn der „Alles Böse kommt vom Vatikan“-Fraktion, das in den letzten Jahren von vielen anderen Unterhaltungsschriftstellern mehr oder weniger perfekt gespielt wird. Böse Päpste und uralte katholische Geheimbünde zur Unterdrückung biblischer „Wahrheiten“, die der Amtskirche missfallen, tummeln sich jederzeit in den Bestsellerlisten dieser Welt. Nie wird dieses Motiv freilich so perfekt mit historischen „Wahrheiten“ unterfüttert wie in „Imprimatur“. Diese Intrige ist wahrlich fast zu schön, um nicht wahr zu sein – eine bemerkenswerte Leistung, die den Verdruss über Längen in den ersten beiden Dritteln rasch und nachdrücklich vergessen macht!
Rita Monaldi und Francesco Sorti haben sich – thematisch angemessen ein wenig dramatisierend – in der Rahmenhandlung zu „Imprimatur“ selbst porträtiert: Ehemalige Studenten diverser Geisteswissenschaften sind sie, die sich irgendwann einen Brotjob gesucht haben und als Journalisten arbeiteten. Da die echte Liebe zur Geschichte freilich eine hartnäckige ist, haben sie ihre Forschungen in die Freizeit verlegt und schließlich mit dem Beruf verknüpft. Das Ergebnis angeblich zehnjähriger Aktivitäten in vielen Archiven und Bibliotheken (so der Klappentext) ist eben dieses „Imprimatur“ (sowie – eine so lange Zeit investiert man ungern für nur ein Buch – ein weiterer historischer Kriminalroman – „Secretum“, der sicherlich auch hierzulande bald erscheinen wird).
Louis L’Amour – Man nennt mich Hondo
Im Südwesten der Vereinigten Staaten ist das Leben der wenigen Siedler auf ihren einsamen Farmen hart. 1874 bricht der Große Weiße Vater in Washington wieder einmal einen Vertrag mit den Apachen. Unter ihrem Häuptling, dem charismatischen Vittorio, erheben sie sich. Die US-Kavallerie bekämpft sie, der Konflikt weitet sich zum Krieg aus. Wichtige Informationen transportiert Hondo Lane, ein Kurierreiter, als er auf dem Rückweg zum Stützpunkt von Indianern attackiert und verletzt wird.
Hondo flüchtet sich auf die Farm der Angie Lowe, die dort mit dem sechsjährigen Sohn ausharrt, nachdem sie von ihrem Ehemann, dem Spieler Ed, verlassen wurde. Zwischen Angie und ihrem Gast ist es Liebe auf den ersten Blick, doch selbst ein feiger Gatte rechtfertigt in dieser Zeit keinen Ehebruch. So reitet Hondo mit seinem Kampfhund Sam davon, um sich zurück ins Kampfgetümmel zu stürzen.
Angie lernt inzwischen Vittorio kennen, den die Tapferkeit von Mutter und Sohn beeindruckt. Er stellt Angie und Johnny unter seinen persönlichen Schutz; dies sehr zum Missfallen des grausamen Kriegers Silva, der Angie gern in sein Tipi zwingen würde. Er lauert auf seine Chance.
Hondo kann Angie nicht vergessen. Deshalb macht er sich auf den Weg zur Farm. Er wird verfolgt von Ed Lowe, der ihn zu töten gedenkt, um zu vertuschen, dass er seine Familie im Stich ließ. Hondo kann Lowe töten, wird dabei jedoch von den Indianern gefangen. Sie wollen ihn foltern und umbringen, aber Vittorio entdeckt, dass Hondo Angie und Johnny kennt. Er will den Gefangenen freilassen, doch Silva protestiert und fordert ein Duell auf Leben und Tod. Hondo kann es für sich entscheiden und schont Silvas Leben, der ihm nun ewige Rache schwört.
Auf der Lowe-Farm kann Hondo Angie überreden, mit ihm zu ziehen. Silva gedenkt nicht, seine Feinde entkommen zu lassen. Nachdem Vittorio im Kampf mit den Soldaten fällt, wird Silva Häuptling der Apachen und hat nun freie Hand. Im der Wildnis kommt es zum großen Entscheidungskampf …
Klassisches Dreieck im Wilden Westen
Ein großes Drama in kleinen Worten: „Hondo“ ist eine echte Überraschung; kein „Western“ im eigentlichen Sinn, sondern ein historischer Roman, der zufällig im Wilden Westen spielt. Die Handlung zieht den Leser sogleich in ihren Bann. Es gibt kaum pathetisches Gefasel („Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss“ o. ä.), keine dauerrauchenden Colts, mordlüsternen „Rothäute“, heldischen Cowboys oder hilflosen Frauen, die ständig gerettet werden müssen. Ein hartes Land lässt nüchterne, selbstbewusste Menschen entstehen, weil nur solche überleben können, so L‘Amours Fazit. Geschlecht oder Hautfarbe sind dabei nebensächlich. Indianer und Weiße sind sich ähnlicher, als ihnen das oft selbst bewusst ist. Hondo Lane weiß es: er ist die Schnittstelle zwischen Rot und Weiß, denn er kennt beide Seiten aus eigener Erfahrung.
„Hondo“ ist in einer trügerisch einfachen Sprache gehalten. Die Sätze sind kurz und prägnant, großartige Wortakrobatik bleibt außen vor. Das funktioniert in diesem Handlungsumfeld außerordentlich gut. L‘Amours Landschaftsbeschreibungen sind großartig und erinnern an die Bilder des Western-Regisseurs John Ford: Poesie ohne Furcht vor Sentimentalität. Dies blieb in der außerordentlich stimmigen deutschen Übersetzung (der Erstausgabe) erhalten. Über ein halbes Jahrhundert ist sie inzwischen alt und liest sich weiterhin ausgezeichnet.
Das Land und seine Leute
Die typischen L‘Amour-Helden sind rechtschaffen aber wehrhaft, die Frauen stolz und schön, die Schurken böse und garantiert spätestens im Finale tot, zürnt die strenge Kritik. Mag sein, dass sich der Verfasser im Laufe seiner langen Karriere ein wenig zu schwer auf vertraute Muster und Klischees gestützt hat. In „Hondo“ macht sich das nicht negativ bemerkbar, zumal vermutlich die meisten (deutschen) Leser heutzutage gar keine anderen L‘Amour-Werke mehr kennen.
Außerdem irritieren angesichts der oben erwähnten Kritik immer wieder erstaunlich ‚menschliche‘ Anwandlungen, die sogar den ehrlosen Ed Lowe regelmäßig befallen. Ihn treibt nicht nur der Hass auf Hondo, sondern auch die Angst, als Feigling erkannt zu werden – ein Schlag, der seinen Ruf ruinieren würde. Als Spieler, der darüber hinaus seine Familie im Stich ließ, muss Lowe zwar moralisch Federn lassen, kann sich aber noch blicken lassen. Doch Feigheit hat Ehrverlust zur Folge und ist ein gesellschaftliches Todesurteil. Um dies zu vermeiden, will Lowe sogar zum Mörder werden.
Hinzu kommt Selbsthass, denn natürlich vergleicht nicht nur Angie zwischen dem gleichermaßen engagierten wie pflichtbewussten Hondo und dem ihr angetrauten Ed. Lowe weiß, dass er schlecht abschneidet, was seinen Zorn noch steigert. Solche Ambivalenz, die dem menschlichen Wesen eigen ist, würde man in einem Unterhaltungs-Western eigentlich nicht erwarten.
Die zerstörerische Kraft der Tradition
L’Amour geht noch mehr als einen Schritt weiter: In den 1950er Jahren lag die filmische ‚Rehabilitierung‘ der US-amerikanischen Ureinwohner in der Zukunft. (Man durfte sie sogar noch „Indianer“ nennen.) Weiterhin galten sie neben Staubstürmen oder Dürren als Katastrophe, mit der die Natur den wackeren weißen Mann = Pionier prüfte. Meist blieben sie namen- und gesichtslose Horden, die reihenweise von ihren Pferden geschossen wurden; ansonsten galt es, weiße Frauen vor „einem Schicksal schlimmer als der Tod“ zu retten; das zeitgenössische Publikum, wusste, was gemeint war, und konnte es sich nach eigenem Belieben ausmalen.
Auch das ähnlich verfälschende Gegenbild war schon bekannt: Auf den „edlen Wilden“, eine Ausnahmegestalt unter seinesgleichen, wurde projiziert, was der weiße Gutmensch in Sachen unverfälschter Natürlichkeit vermisste. Tatsächlich waren die Ureinwohner Menschen in einer Umwelt, an die sie sich angepasst hatten. Das machte sie weder ‚besser‘ noch ‚schlechter‘ als die ins Land drängenden Siedler. Der kluge Blick in eine (womöglich gemeinsame) Zukunft oder guter Wille waren auf beiden Seiten ebenso verbreitet wie Vorurteile oder Gewaltlust.
Diese Eigenschaften lässt L’Amour durch seine Hauptfiguren verkörpern, wobei Hondo und Vittorio für die Versöhnung über Grenzen, Ed Lowe und Silva für den kleinlichen Hass stehen. Ebenso klug wie nüchtern entscheidet Angie für sich und ihren Sohn: Sie wird Hondo folgen und an seiner Seite nicht nur überleben, sondern mit einiger Wahrscheinlichkeit ihr Glück finden. Was nach einem typischen Happy-end klingt, wird bei L’Amour ohne Seifenoper-Sentimentalität geschildert und rundet eine bemerkenswerte Geschichte nachdrücklich ab.
„Hondo“ – der Film
„Hondo“ ist die Romanfassung der Kurzgeschichte „The Gift of Cochise“, die L‘Amour 1953 veröffentlichte. Sie erregte das Interesse Hollywoods und wurde noch im selben Jahr verfilmt. Die Titelrolle spielte niemand Geringerer als John Wayne. Unter der Regie von John Farrow bot er – sogar in 3D – eine der vielen Glanzleistungen seiner Karriere. „Hondo“, der Film, wurde ein Klassiker des Western-Kinos. Louis L‘Amour schrieb (nach dem Drehbuch von James Edward Grant) den Roman dazu selbst und schuf einen der ganz großen Erfolge seiner eindrucksvollen Karriere.
1967 entstand die erfolglose, nach 17 Episoden eingestellte TV-Serie „Hondo“ mit Ralph Taeger in der Titelrolle. Für den internationalen Markt wurde daraus ein Film („Hondo und die Apatchen“) montiert, der im Kino ausgewertet werden konnte.
Autor
Louis L’Amour (1908-1988) wurde in Jamestown, North Dakota, als Louis Dearborn LaMoore geboren. Seine Eltern lasen gern und viel und hielten auch ihren Sohn dazu an. Der junge Louis begeisterte sich für Geschichten über die frühen Siedler und Pioniere, aber auch über die indianischen Ureinwohner.
L‘Amours Lebensgeschichte klingt fast zu schön, um wahr zu sein, ist aber belegt. Er versuchte sich als Boxer, Seemann, Elefantenhändler usw. und bereiste die ganze Welt. In den 1930er Jahren kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück. An der „University of Oklahoma“ belegte er Kurse für kreatives Schreiben. 1935 veröffentlichte er sein erstes Werk, eine Gangstergeschichte, 1939 „Smoke from This Altar“, eine Gedichtsammlung (!).
Im II. Weltkrieg kämpfte L‘Amour als Panzerfahrer in Frankreich und Deutschland. Nach seiner Rückkehr in die USA siedelte er nach Los Angeles um und schrieb ab 1946 Western-Stories für Magazine. 1950 folgte mit „Westward the Tide“ ein erster Roman, der allerdings nur in Großbritannien erschien. Im folgenden Jahr kam in den USA L‘Amours US-Debüt mit einem Band der „Hopalong Cassidy“-Serie („H. C. and the Riders of High Rock“); dies allerdings unter dem Pseudonym Tex Burns.
L‘Amour war nicht nur ein fleißiger (er veröffentlichte auch unter dem Pseudonym Jim Mayo), sondern auch ein beliebter Autor, der keineswegs nur Western, sondern auch Seefahrergeschichten („Sitka“, 1957), Thriller („The Last of the Breed“, 1986), Historien-Spektakel („The Walking Drum“, 1984) oder Sachbücher („Frontier“, 1984) schrieb. Angeblich verkaufte er 225 Millionen Exemplare seiner mehr als 100 Bücher, was ihn zum dritterfolgreichsten Schriftsteller aller Zeiten machen würde. Sicher ist, dass L‘Amour-Bücher die Vorlage für etwa 30 Filme lieferten, die meist der B-Kategorie zuzuordnen sind.
Taschenbuch: 206 Seiten
Originaltitel: Hondo (New York : Fawcett Publications, Inc. 1953)
Übersetzung: Hansheinz Werner (bearbeitet von Werner Gronwald)
Der Autor vergibt: 




Peter Straub – Haus der blinden Fenster
Zum zweiten Mal kehrt Tim Underhill, Erfolgsschriftsteller aus Manhattan, in seine Heimatstadt Millhaven zurück, der er vor vielen Jahren den Rücken gekehrt hat. Erst hatte sich Nancy, die Gattin seines ungeliebten Bruders Philip, auf grausame Weise umgebracht. Wenig später verschwindet Mark, ihr Sohn, Tims Neffe, mit dem er sich gut versteht. Er ist nicht der erste Jugendliche, der vermisst wird. In Millhaven treibt ein Serienmörder sein Unwesen, der offenbar die Kontrolle über sich zu verlieren beginnt und die Taktfrequenz seiner Attacken steigert.
Marks tatsächliches Schicksal ist wesentlich bizarrer. Ein verlassenes Haus auf einem Nachbargrundstück hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Es zog ihn an und stieß ihn gleichzeitig ab: Hier ist spürbar Furchtbares geschehen, das die Wände des Gebäudes wie eine Batterie aufgeladen hat. Michigan Street 3323 war vor vielen Jahren die Adresse von Joseph Kalendar, der als Psychopath und Serienmörder in die US-amerikanische Kriminalgeschichte einging. Man hatte ihn erst nach Jahren des Foltern und Mordens erwischt. In einer Anstalt für geistesgestörte Verbrecher wurde er 1985 von einem Mithäftling umgebracht.
Was Mark nicht wusste: Kalendar war ein Cousin seiner Mutter. Es gibt eine seltsame Verbindung zwischen ihr und dem toten Mörder. Dies war der Grund für Nancys Selbstmord. Sie hatte eine alte Schuld nicht länger ertragen: Einst hätte sie dem üblen Treiben ihres Cousins vorzeitig ein Ende machen können, war aber furchtsam zurückgewichen. Mark ist stärker, er wollte es mit Kalendar aufnehmen, zumal er entdeckte, dass dieser seine ebenfalls ermordete Tochter noch immer in den Folterhöhlen des Hauses Nr. 3323 gefangen hält und quält. Immer tiefer drang Mark in die schrecklichen Geheimnisse des alten Hauses ein. Aber dort ist es nicht Kalendar, der ihn vor jene Entscheidung stellt, die zu seinem Verschwinden führt …
Geschichte mit offenen Enden
„Haus der blinden Fenster“ – der Originaltitel „Lost Boy Lost Girl“ wird der Geschichte wesentlich gerechter – ist eine bemerkenswert gelungene Mischung aus Thriller und Gruselgeschichte. Wo man die Grenze zieht, bleibt dem Leser überlassen. Die phantastischen Elemente sind eindeutig, sie lassen sich nicht rational auflösen. Auf der anderen Seite spielt sich vieles von dem, was sich scheinbar ereignet, wohl nur in den Köpfen der Figuren ab.
„Haus der blinden Fenster“ ist wie so oft bei Peter Straub ein Roman, der um die Themen Schuld, Sühne & das Böse an sich kreist und dabei auf Genregrenzen keine Rücksicht nimmt. Darin gleicht er dem Schriftsteller Henry James (1843-1916), mit dem Straub – auch was die literarische Qualität angeht – oft verglichen wird. „The Turn of the Screw“ (1898; dt. „Die Drehung der Schraube“) weist in der Tat dieselbe unwirkliche Atmosphäre realer und übernatürlicher Bedrohung auf wie „Haus der blinden Fenster”.
Viele Fragen wirft Straub auf. Manche beantwortet er, andere können wir uns selbst zusammenreimen. Nicht wenige bleiben jedoch offen. Ist der Sherman-Park-Killer der wiedergeborene Joseph Kalendar? Ist er ein Mensch, der von dessen Geist besessen ist? Wird Nancy Underhill wirklich vom Geist der Kalendar-Tochter, die sie einst feige im Stich ließ, in den Tod getrieben? Bildet sie sich das in nur ein? Wird auf dem privaten Friedhof des Sherman-Park-Killers doch die Leiche Marks zum Vorschein kommen, den sein Onkel in der „anderen Welt“ wähnt? Worum handelt es sich bei dieser “anderen Welt” eigentlich? Ist sie das Jenseits, eine fremde Dimension, eine parallele Erde?
Geschichte ohne sicheren Boden
Straubs komplexer Schreibstil verstärkt geschickt die Unsicherheit, die der Leser mit den Figuren teilt. Wir erleben Zeitsprünge in Vergangenheit und Zukunft. Die Perspektive wechselt; manchmal erzählt Tim Underhill, dann wird er vom (unsichtbaren) Verfasser beobachtet, der im Mittelteil die Handlung fast gänzlich Mark Underhill überlässt. Manche Ereignisse werden parallel geschildert, wobei die Interpretation sehr unterschiedlich ausfallen kann: Tim und Mark sehen die Welt nicht mit denselben Augen.
Das verwunschene Haus, in dem es aufgrund eines lange in der Vergangenheit liegenden Unrechts umgeht, ist längst ein Klischee der Phantastik. Auf jeden Fall ist es schwierig, ihm heutzutage neues Leben einzuhauchen. Auch hier leistet Straub gute Arbeit. Auf dem Grundstück Nr. 3323 lastet wahrlich ein Haus gewordener Alptraum.
Wiederum wurzelt das Grauen ausschließlich in der menschlichen Seele; für Außerirdische, Trolle, Vampire und andere Ausgeburten des klassischen und halbwegs gemütlichen Horrors ist kein Platz in Straubs Welt/en. Auch das Paradies, in dem Mark und seine Lucy sich wiederfinden, entpuppt sich als Stätte zwar ungewöhnlicher aber deshalb nicht weniger bedrohlicher Gefahren.
Kontrollverlust und Seelennöte
Timothy Underhill ist Peter Straubs anderes Ich, sein fiktiver Stellvertreter, den er gegen allerlei eingebildete und echte Dämonen kämpfen lässt, seit er ihn 1988 zum ersten Mal mit dem „Blue-Rose“-Mörder konfrontierte („Koko“), dessen Geheimnis erst 1993 in „The Goat“ (dt. „Der Schlund“) gelüftet wurde. Seither hielt sich Underhill verständlicherweise Millhaven (das Spiegelbild Milwaukees im US-Staat Wisconsin, der realen Heimatstadt Straubs) fern, weil sich für ihn viele unerfreuliche Erinnerungen an diesen Ort knüpfen.
Zu schaffen macht ihm auch die provinzielle Enge der kleinen Stadt, die vortrefflich verkörpert wird durch seinen Bruder Philip. Der hat sich scheinbar im biederen Establishment etabliert und ist doch die personifizierte Unzufriedenheit. Seiner Familie bereitet Philip wenig Freude, er ist gefühlskalt, egoistisch, unsensibel, untauglich als Ehemann und als Vater.
Mark, sein Sohn, ist eher nach Onkel Tim geraten. Mit seinen fünfzehn Jahren steckt er tief in der Pubertät, was seinen Alltag nicht einfacher macht. Seine Gefühle sind außer Kontrolle, seine Hormone laufen Amok. So wird er zum idealen Opfer für das Haus an der Madison Street. Zunächst voller Furcht über das, was er dort entdeckt, wird Mark zum jungen Ritter, der seine Prinzessin Lucy vor dem Drachen Kalendar retten will. Dafür zahlt er einen hohen Preis. Andererseits ist sein Schicksal angesichts der trüben Zukunft, die ihm sein reales Leben bietet, womöglich eine Verbesserung. Wie schon gesagt muss Mark jedoch feststellen, dass auch die „andere Seite“ keineswegs frei von Bedrohungen ist.
Geist oder nicht Geist?
Stets bleibt unklar, ob es wirklich Joseph Kalendar ist, dessen Geist noch immer nicht ablassen will von seiner krankhaften Menschenquälerei. Womöglich ist es der reale Sherman-Park-Killer, der sich mit dem berühmten ‚Kollegen‘ identifiziert und in dessen Haut schlüpft. Weil er uns niemals direkt unter die Augen tritt, ist Kalendar jemand, der für Angst und Schrecken sorgt – ein Schreckgespenst, das viel von dem verkörpert, was man sich unter einem Serienmörder vorstellt: eine schattenhafte Gestalt, die wie ein Mensch aussieht, aber eigentlich keiner mehr ist, sondern etwas Atavistisches, Düsteres, ein Wolf unter Schafen, aber ein gut getarnter, der Jagd auf seine ahnungs- und hilflosen Mitbürger macht.
Atmosphäre und interessante, eindringliche gezeichnete Figuren: Diese beiden Aspekte sind Straub deutlich ebenso wichtig wie die Handlung. Das Ergebnis mag den notorischen Mainstream-Horror-Leser irritieren oder womöglich abschrecken, aber wer sich auf “Haus der blinden Fenster” einlässt, erlebt einen Peter Straub in Hochform.
Autor
Peter Francis Straub wurde am 2. März 1943 in Milwaukee im US-Staat Wisconsin geboren. Der Schulzeit folgte ein Studium der Anglistik an der „University of Wisconsin“, das Straub an der „Columbia University“ fortsetzte und abschloss. Er heiratete, arbeitete als Englischlehrer, begann Gedichte zu schreiben. 1969 ging Straub nach Dublin in Irland, wo er einerseits an seiner Doktorarbeit schrieb und sich andererseits als ‚ernsthafter‘ Schriftsteller versuchte. Während die Dissertation misslang, etablierte sich Straub als Dichter. Geldnot veranlasste ihn 1972 zur Niederschrift eines ersten Romans („Marriages“; dt. „Die fremde Frau“), den er (mit Recht) als „nicht gut“ bezeichnet.
1979 kehrte Straub in die USA zurück. Zunächst in Westport, Connecticut, ansässig, zog er mit der inzwischen gegründeten die Familie nach New York. Ein Verleger riet Straub, es mit Unterhaltungsliteratur zu versuchen. Straub schrieb „Ghost Story“ (1979; dt. „Geisterstunde“), seine Interpretation einer klassischen Rache aus dem Reich der Toten. Der Erfolg dieses Buches (das auch verfilmt wurde), brachte Straub den Durchbruch. Mit „Shadowland“ (1980; dt. „Schattenland“) und „Floating Dragon“ (1983; dt. „Der Hauch des Drachens“) festigte er seinen Ruf – und erregte die Aufmerksamkeit von Stephen King, mit dem er sich bald anfreundete. Die beiden Schriftsteller verfassten 1984 gemeinsam den Bestseller „The Talisman“ (dt. „Der Talisman“), dem sie 2001 mit „Black House“ (dt. „Das schwarze Haus“) eine ebenso erfolgreiche Fortsetzung folgen ließen.
Straubs Werke wurden vielfach preisgekrönt; akademisch penibel zählt der Autor seine Meriten hier auf. Diese Website ist ebenso informativ wie kurios und verrät einen intellektuellen Geist, der über einen gesunden Sinn für hintergründigen Humor verfügt.
Taschenbuch: 379 Seiten
Originaltitel: Lost Boy Lost Girl (New York : Random House, USA 2003)
Übersetzung: Uschi Gnade
http://www.randomhouse.de/heyne
Der Autor vergibt: 




James Munro – Eine Karte aus Kutsk

James Munro – Eine Karte aus Kutsk weiterlesen