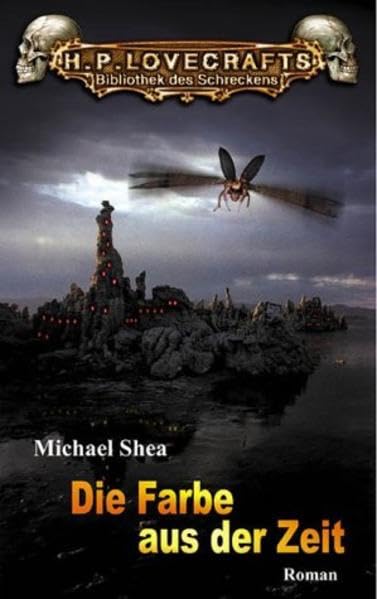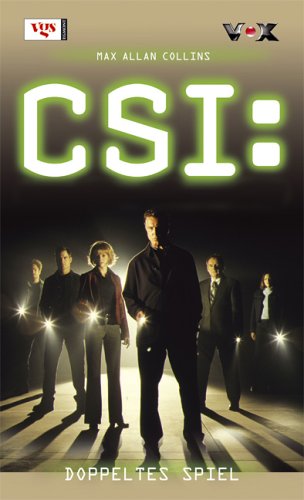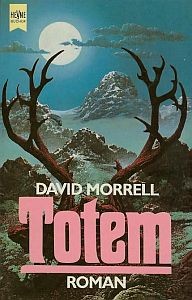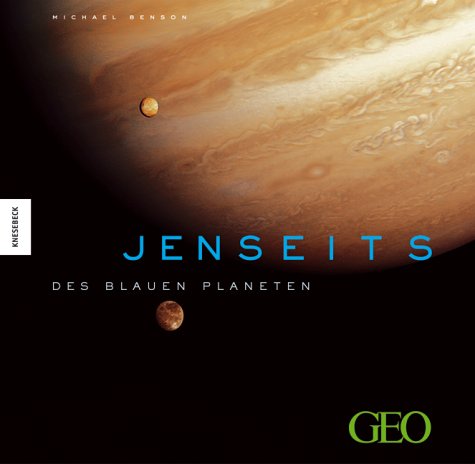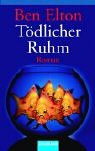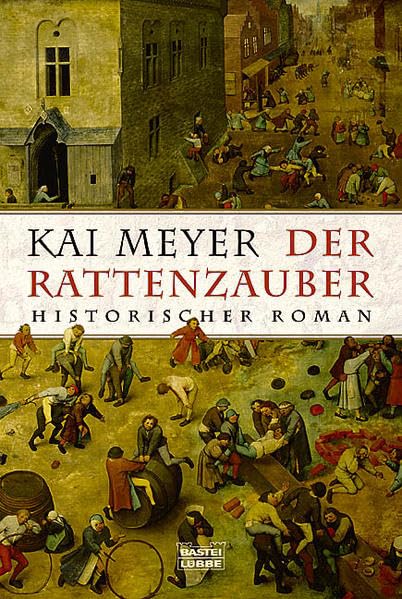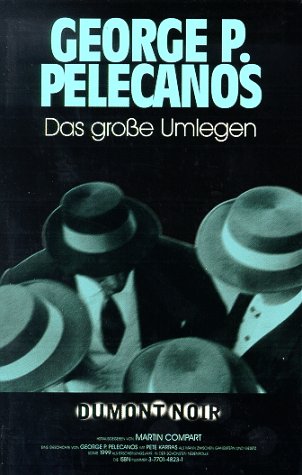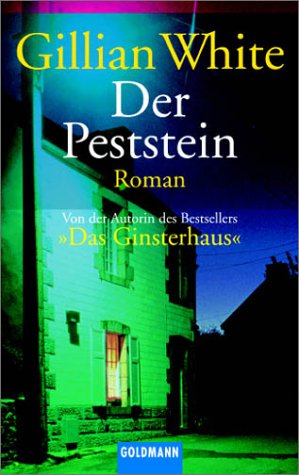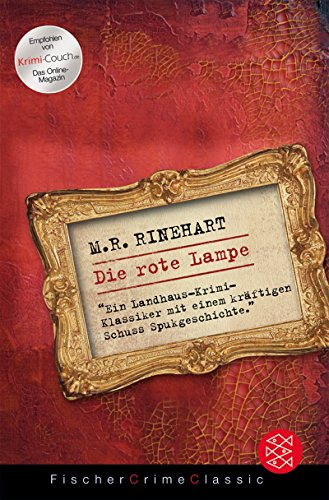
Mary Roberts Rinehart – Die rote Lampe weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Michael Shea – Die Farbe aus der Zeit
Die Freunde Gerald Sternbruck (der Ich-Erzähler) und Ernst Carlsberg verbringen ihren Urlaub an einem Stausee in Neuengland. Dort sticht ihnen ein merkwürdiges Phänomen buchstäblich in die Augen: Des Nachts beginnen Wasser und Ufervegetation in einer Farbe zu schimmern, die auf dieser Erde unbekannt ist.
In dem See lebt ein außerirdisches Wesen, das sich just anschickt, seinen Einflussbereich zu erweitern. Dazu gibt es seine bisher geübte Zurückhaltung auf und überfällt in der Dunkelheit ahnungslose Camper, Jäger und Wanderer, denen es einerseits wie ein Vampir das Blut aussaugt und andererseits die Seele raubt, denn die Kreatur nährt sich auch von der Angst seiner Opfer. Michael Shea – Die Farbe aus der Zeit weiterlesen
Collins, Max Allan – CSI Las Vegas: Doppeltes Spiel
Eine Nacht wie jede andere in Las Vegas, der Stadt in der Wüste des US-Staates Nevada, die noch viel seltener schläft als New York. Gleich zwei Leichenfunde zur selben Zeit sind nichts Ungewöhnliches für das Team der „Crime Scene Investigation“ (CSI) des „Las Vegas Criminalistics Bureau“, das Tatorte sichert, Spuren untersucht und der Kriminalpolizei – meist verkörpert durch Captain Jim Brass von der Mordkommission, der früher selbst beim CSI war – zuarbeitet.
Wie üblich teilt man sich auf. Gil Grissom, leitender Beamter der Nachtschicht, und seine Kollegen Warrick Brown und Sara Sidle machen sich auf ins Beachcomber-Casino-Hotel. Dort ist ein Gast vor den Augen eines entsetzten Etagenkellners buchstäblich hingerichtet worden: Zwei Kugeln jagte der Killer präzise in den Schädel seines Opfers, bevor er unerkannt entkam. Doch Spuren hat er trotzdem hinterlassen, auch wenn wie so oft das gesamte fahndungstechnische Instrumentarium der CSI sowie das geballte Wissen seiner unkonventionell denkenden und arbeitenden Beamten gefordert ist, sie nicht nur zu entdecken, sondern auch zu entschlüsseln.
Nick Stokes und Catherine Willows, die beiden übrigen Mitglieder von Grissoms Team, mühen sich derweil auf einem Baugrundstück ab, wo unter einer wilden Müllhalde die vollständig mumifizierte Leiche eines Mannes entdeckt wurde, die dort wohl mindestens fünfzehn Jahre gelegen hatte. Hier wird es besonders schwierig, die Todesumstände zu rekonstruieren. Eines steht allerdings rasch fest: Mord beendete dieses Leben, genauer gesagt: zwei Kugeln, präzise in den Schädel gejagt …
Lange dauert es nicht, bis den CSI-Leuten die Übereinstimmung auffällt. Zunächst glauben sie noch einen makabren Zufall – bis auf Gil Grissom, der den Zufall generell ausklammert und nur handfeste Beweise gelten lässt. Nur mühsam gehen die Ermittlungen voran, aber ein erster Teilerfolg kann errungen werden: Die Mumie war einst Malachy Fortunato, 1985 plötzlich verschwundener Buchhalter in einem der großen Casinos, gleichzeitig ein Spieler – ein ungute Kombination, wenn man für das Syndikat arbeitet. Las Vegas war in den 80er Jahren noch fest im Würgegriff des organisierten Verbrechens. Gemeinsam mit Fortunato verschwand damals eine große Summe Mafia-Geldes, was seiner Witwe einige unangenehme Besucher ins Haus brachte. Doch sie war tatsächlich ahnungslos, und ihr Gatte womöglich auch.
Wer steckt also wirklich hinter dem Fortunato-Mord? Nach so vielen Jahren ist die Spur erkaltet, die Schar der Verdächtigen groß. Aber in den Labors der CSI setzt man allen Ehrgeiz daran, das Puzzle zusammenzusetzen – und vergisst darüber, dass die Karriere eines Killers durchaus länger als anderthalb Jahrzehnte dauern kann. Der „Deuce“, der die Köpfe seiner Opfer löchert wie die Zwei im Kartenspiel, ist jedenfalls noch sehr aktiv, und er beginnt jetzt allmählich nervös zu werden …
Bücher zu Filmen oder Fernsehserien, die zudem von der Vgs Verlagsgesellschaft herausgebracht werden, sollte man eigentlich meiden. Sie leben allein vom Ruhm der Vorlage, gelten den Studios als nettes Zusatzgeschäft und werden von fix schreibenden, aber minderbegabten Autorenknechten wie am Fließband produziert. Eile tut Not, ist doch das Verfallsdatum solcher „tie-in-Literatur“ identisch mit dem Zeitpunkt, an dem der Film aus dem Kino verschwindet oder die TV-Serie abgesetzt wird.
Zwei Gründe gibt es, das hier besprochene Werk trotzdem eines näheren Blickes zu würdigen. Da ist zum einen der Verfasser: Max Allan Collins hat zweifellos einen guten Namen als „tie in“-Autor, denn er produziert bei aller Hast solide Unterhaltungsware, die mehr ist als die bloße Nacherzählung eines Drehbuchs. Sein Name steht heute über unerhört zahlreichen Film- und Fernseh-Romanen, aber der wahre Leser kennt und ehrt Max Allan Collins als Autor vorzüglicher Kriminalromane, der mit seinen historischen Thrillern noch eines draufzusetzen vermag. Was? Noch nie davon gehört? Kein Wunder, denn Deutschland ist Collins-Diaspora. Man müsste eigentlich bitterlich klagen (oder fluchen): Während dieser Autor mit seinen Butter-aufs-Brot-Büchern in jedem Buchladen vertreten ist, werden seine wahren Kunstwerke nur noch in den Antiquariaten gehandelt – wenn sie denn überhaupt zu bekommen sind! Wer einmal einen der grandiosen Nate-Heller-Thriller gelesen hat, die das Chicago der 30er Jahre mit seinen selbst dem historischen Laien wohl bekannten Gangstern wieder aufleben lassen, wird süchtig nach diesem Stoff, der Reales und Erfundenes so meisterhaft mischt. Theoretisch gäbe es genug davon: Collins ist ein fleißiger Mann (der auch Elliot Ness, den berühmten „Unbestechlichen“, neue-alte Abenteuer erleben lässt). Davon werden wir in Deutschland allerdings nicht profitieren: Nachdem |Bastei-Lübbe| vor vielen Jahren fünf Heller-Bände publiziert hatte, startete der |DuMont|-Verlag in seiner „Noir“-Reihe einen weiteren Versuch. Die Zeit reichte gerade, den dürstenden Fan wie den sprichwörtlichen Tantalus mit einem einzigen neuen Abenteuer zu quälen, dann wurde die Reihe mangels Nachfrage eingestellt: Der deutsche Krimileser mag es lieber gemütlich und nicht gar zu aufregend. So müssen wir uns eben mit einem Collins aus zweiter Hand zufrieden geben.
Der zweite Punkt geht an die Serie: „CSI“ gehört eindeutig zu den besten Thriller-Shows des an Qualität in dieser Hinsicht nicht gerade armen US-Fernsehens. (Ich weiß, dass 99 von 100 amerikanischen Serien Bockmist sind, aber handwerkliche Professionalität und die schiere Quantität der ausgestoßenen Shows garantieren auch heute ein gutes Quantum Sehenswertes.) Die Storys sind krude, aber stets überzeugend, das Tempo rasant (Produzent: Jerry „Pearl Harbor“ Bruckheimer, sonst die Pest der Kinowelt, aber hier in seiner holterdipoltrigen Großkotzigkeit wohltuend gezügelt), die Effekte heftig. Dazu kommt das große Glück einer fabelhaften Besetzung. Zuvor eher unbekannte, aber TV-erprobte Darsteller formen eine Riege, der man einfach gern bei der Arbeit zuschaut. Besonders William L. Petersen als Gil Grissom ist eine Figur mit Ecken und Kanten, die nicht im Reagenzglas des TV-Labors für Instant-Quotenhits lieblos zusammengebraut wurde. Die Chemie stimmt zwischen den Männern und Frauen des CSI-Teams, obwohl sie tüchtig miteinander konkurrieren und streiten.
Collins schafft es, alle diese Punkte in seinen Roman zu retten. Während der Lektüre kann man vor dem inneren Auge einen CSI-Film „Doppeltes Spiel“ ablaufen sehen. Dabei hilft es maßgeblich, dass der Plot mit einer der überdurchschnittlichen TV-Episoden mithalten kann. Der ökonomisch arbeitende Verfasser greift auf die Ergebnisse früherer Recherchen zurück: Mit „The Million Dollar Wound“, dem vierten Nate-Heller-Roman (1986, dt. „Las Vegas 1946“) hatte Collins schon einmal die Geschichte der Casino-Stadt als Kulisse für einen Thriller genutzt. Sein Wissen hat er klug genutzt und ein leichtes, aber rundum lesenswertes Krimivergnügen realisiert, das sich der Genreliebhaber spätestens als nicht mehr gar so teures Taschenbuch auf die Leseliste setzen sollte.
Michael Connelly – Schwarzes Echo
Der Lake Hollywood ist das Trinkwasserreservoir für die Großstadt Los Angeles. Die Hügel der Umgebung sind durchzogen von Zu- und Ableitungsrohren, die den Obdachlosen und Fixern der Umgebung einen willkommenen Unterschlupf bieten. Dass von diesen Untermietern immer wieder einer tot gefunden wird, ist ein Ärgernis, an das die Polizei gewöhnt ist. Als an diesem Sonntag anonym eine Leiche am Damm gemeldet wird, hat Hieronymus „Harry“ Bosch Bereitschaftsdienst. Er ist ein Vollblut-Kriminalist und auch nach vielen Polizeijahren nicht in Routine erstarrt. Bosch erkennt den Toten: William Meadows war vor zwanzig Jahren mit ihm Soldat in Vietnam, wo sie Seite an Seite den Vietcong im Gewirr jener Gänge bekämpften, die dieser tief unter der Erdoberfläche anlegte. Der mörderische Kampf in der Finsternis ließ eine verschworene Gemeinschaft entstehen ließ: die „Tunnelratten“.
Meadows gehörte zu den Veteranen, deren Psyche in Vietnam einen Knacks erhielt. Lange Jahre war er rauschgiftsüchtig, doch die Indizien, die auf eine Überdosis hindeuten, wurden manipuliert. Die Ermittlungen ergeben weiter, dass Meadows in einen spektakulären Bankeinbruch verwickelt war, der Los Angeles im Vorjahr in Atem hielt und bei dem die Täter mit einer Riesenbeute unerkannt entkommen waren. Michael Connelly – Schwarzes Echo weiterlesen
Hartmann, Christian / Hürter, Johannes – letzten 100 Tage des Zweiten Weltkriegs, Die
„Die letzten 100 Tage …“ bietet „Geschichte light“, d. h. als Mischung historischer Fakten und persönlicher Zeitzeugenberichte – leicht verständlich, mit „menschlichem Gesicht“, reich bebildert. Die Darstellung hakt nicht die üblichen „wichtigen“ Ereignisse ab, sondern schildert die letzten Kriegsmonate unter Berücksichtigung aller Beteiligten, Täter wie Opfer, Mitläufer wie Regimegegner, Befreier wie Befreite: ein sinnvoller Einstieg in eine komplexe Materie.
Chronologisch nähert sich die Darstellung ausgehend vom 30. Januar dem Kriegsende am 8. Mai 1945. In fünf Großkapitel gliedert sich der Text (Januar 1945, Februar usw.), von denen die Kapitel „Januar“ und „Mai“ naturgemäß recht kurz ausfallen. Jedes Großkapitel wird durch einen Text eingeleitet, der kurz das Gesamtgeschehen im jeweiligen Monat erläutert und Zusammenhänge herstellt. Jedem Einzeltag sind anschließend zwei Buchseiten gewidmet; dieses Schema wird streng durchgehalten.
Die Einzeltag-Einträge bilden in ihrer Gesamtheit keinen einheitlichen Überblick, denn die Spannbreite der angesprochenen Themen soll möglichst groß sein; sie schließt deshalb das militärische und politische Geschehen ein, berücksichtigt aber stets auch Kunst, Kultur oder Sport. Dem „großen“ Ereignis wird ebenso viel Raum gewidmet wie dem Alltäglichen und dem Einzelschicksal. Zu Wort kommt weniger zeitgenössische Prominenz, sondern der „kleine Mann“ bzw. die „normale Frau“ im Getriebe der Kriegsmaschinerie: der Flakhelfer, die Hausfrau, der KZ-Häftling, die Flüchtlingsfrau, der Kriegsgefangene u. a. Im individuellen Erleben spiegelt sich so der „Endkampf“ wider: primär als Kampf um das nackte Leben, als undurchschaubares Tohuwabohu auch aus alliierter Sicht, als Katastrophe auf allen Ebenen, die selbst den Beteiligten unbegreifbar erschien.
Unterhalb des Textblocks läuft über jede Doppelseite ein „Nachrichtenticker“: Weitere wichtige Ereignisse des Tages, die keine Berücksichtigung im Haupttext finden konnten oder sollten, werden hier im Telegrammstil aufgelistet. Selbst Hitlers Ende im „Führerbunker“ findet nur hier Erwähnung – es bildet nur einen der unzähligen Mosaiksteine, aus denen sich der Leser ein Bild von den letzten 100 Tagen des Zweiten Weltkriegs zusammensetzen muss.
Illustriert wird dieses Buch mit über 160 oft großformatigen Bilddokumenten und Karten, gedruckt auf qualitätsvolles Kunstdruckpapier und deshalb von bemerkenswerter Eindringlichkeit.
Zum 60. Mal jährt sich das Finale des II. Weltkriegs. Eigentlich endete dieser ja zweimal: am 8. Mai in Europa, am 2. September in Asien. Hartmanns & Hürters 100 letzte Tage beschränken sich indes auf den europäischen Schauplatz, was angesichts der Fülle des Materials sowie der Beschränkung auf einen historischen Überblick akzeptabel ist.
Denn „Die letzten 100 Tage …“ ist ein Sachbuch im klassischen Sinn: geschrieben nicht für Spezialisten, sondern für den Laien, der sich für die Geschichte interessiert, aber nicht durch allzu offensichtliches Fachlatein abgeschreckt werden möchte. Schon die historisch sinnfreie Begrenzung auf ausgerechnet 100 letzte Tage ist ein Zugeständnis an die Leserschaft. In diesem Sinne vermitteln die Autoren Wissen auf denkbar moderne Weise: Sie bieten „historische Häppchen“ an, die auch den intellektuell stets fluchtbereiten Mitgliedern der multimedialen MTV/Pisa-Generationen X, Y und Z munden dürften.
Wobei dies keineswegs ein Kniefall vor einer traurigen Realität, sondern eine geschickte Anpassung an das moderne Leseverhalten ist. Wenn der „Lehrer“ gut vorarbeitet, ist es durchaus möglich, sich ein Thema quasi selbst zu erarbeiten, aus Facetten ein Gesamtbild zu verschaffen. Was sogar von Vorteil ist, da es „das“ Bild vom Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich gar nicht gibt.
Hartmann & Hürter legen in kurzen Einstiegskapiteln Zusammenhänge offen. Dann gehen sie in Details. Bei näherer Betrachtung lassen sie freilich die Zeitzeugen nicht einfach nur sprechen. Ihre Äußerungen werden von den Autoren ausgewählt, in ein übergeordnetes Gerüst gebettet, kommentiert, interpretiert, wenn nötig korrigiert, da solche Zeugnisse aus der Vergangenheit trotz (oder wegen) ihrer Unmittelbarkeit nicht zwingend der Wahrheit entsprechen müssen.
Die ein- und überleitenden Texte sind mit großer Sorgfalt verfasst. Gerade in der Beschäftigung mit dem „Dritten Reich“ wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Historikerkollegen, die Medien und selbst berufene Tugendwächter läuten gern die Pestglocke – dies vor allem, wenn sie Relativierungen des NS-Unrechts wittern. Auch wenn hier immer wieder über das Ziel hinausgeschossen wird, so fördert die Gewissheit, von scharfen Kritikeraugen beobachtet zu werden, auf der anderen Seite die Sorgfalt von Autoren, die sich der thematischen Herausforderung stellen. Hartmann & Hürter wagen es und gewinnen. Auch in der erforderlichen Verkürzung achten sie auf historische Präzision.
Ausgewogenheit ist ein weiteres Merkmal ihres Werks. Zu Wort kommen sie alle: die „guten Deutschen“, die „bösen Nazis“, die Mitläufer; die Übergänge sind da fließender als den meisten Zeitzeugen selbst oder den Nachgeborenen klar ist. Die Opfer des Naziterrors werden nicht verklärt, sondern behandelt, wie sie es verdient haben: als ganz normale Menschen, die wegen einer kriminellen Wahnidee buchstäblich aus ihrem Leben gerissen wurden. Die schwer oder gar nicht begreifbare Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit, mit der dies anscheinend möglich war, wirkt viel erschreckender als jedes pathetische Zwangsgedenken, bei denen mit der Gnade der späten Geburt gesegnete Politiker betroffene Minen aufsetzen, Kränze austeilen & „Nie wieder!“-Reden schwingen.
Die letzten 100 Kriegstage werden selbstverständlich auch aus der Sicht der alliierten sowie der sowjetrussischen Zeitzeugen kommentiert. Hier schlägt das noch heute nachwirkende Unverständnis darüber durch, wieso die Deutschen, die selbst am besten wissen mussten, dass für sie der Krieg verloren war, den Kampf bis zum bitteren Ende nicht aufgaben. US-Amerikaner, Briten, Franzosen, Russen – sie alle kamen nicht nur in ein feindliches, sondern in ein zutiefst fremdes Land. So geht es uns Lesern von Heute ebenfalls, zumal der Verdrängungsprozess in Deutschland – die Autoren gehen auch darauf ein – bereits in diesen 100 letzten Tagen mächtig einsetzte.
Schon angesprochen: die Qualität der Bilder, die zudem gut ausgewählt, d. h. nicht tausendfach gesehen wurden und den Text illustrieren, ergänzen, kommentieren. Ein Bild sagt in der Tat oft mehr als tausend Worte. Absurdität und Agonie des „Drittes Reichs“ werden selten so offensichtlich wie in jenem Bild, das Adolf Hitler im Februar 1945 weiterhin in Großmachtsträumen schwelgend tief versunken beim Anblick eines bizarren Metropolis-Modells der geplanten „Führerstadt“ Linz zeigt („Tag 34“). Der Krieg ist längst mehr als verloren, aber er läuft wie geschmiert weiter – man beginnt zumindest zu ahnen wieso.
Christian Hartmann und Johannes Hürter arbeiten als Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München. Dort forschen sie seit Jahren über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Die Ergebnisse geben sie einerseits als Dozenten an der Universität der Bundeswehr München weiter, während sie andererseits für eine Fülle von Publikationen zum Thema verantwortlich zeichnen. Hartmann wirkte außerdem als wissenschaftlicher Berater bei dem Aufsehen erregenden Filmwerk „Der Untergang“ mit.
Patricia Cornwell – Wer war Jack the Ripper?
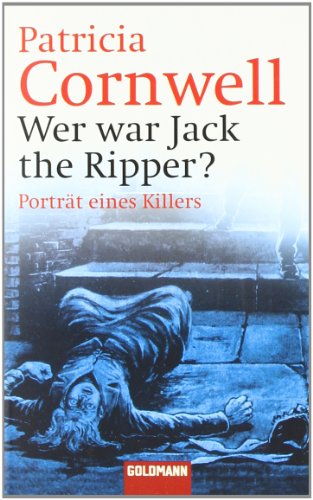
Ian Rankin – Verborgene Muster (John Rebus 1)
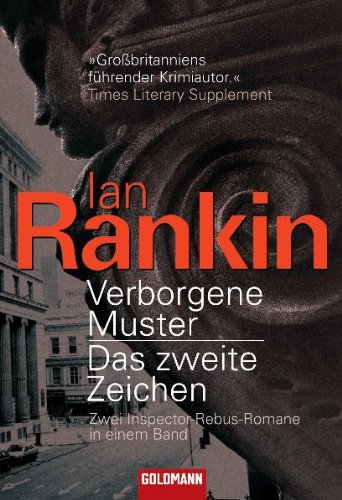
Borsch, Frank – Sternenarche, Die (Perry Rhodan – Lemuria 1)
In den Ochent-Sektor verirren sich seit jeher nur galaktische Glücksritter der besonders hoffnungsvollen (oder verzweifelten) Art. Er bildet eine Pufferzone zwischen den Machtbereichen der tellerköpfigen Blues und der hominiden Akonen, droht jedoch diese Funktion zu verlieren: Seit einiger Zeit mehren sich die Zeichen dafür, dass sich etwas anbahnt in diesem Winkel des Weltraums.
Um Terras Interessen zu wahren, begibt sich Perry Rhodan, seit Jahrtausenden Terras Mann für kosmische Verwicklungen, auf eine diplomatische Mission. Er möchte mit den Akonen verhandeln und sie auf der Seite der Menschheit wissen, sollte um den Ochent-Sektor ein Konflikt ausbrechen. Mit dem Prospektorenraumer „Palenque“ reist er unauffällig an, kommt aber nicht weit: Unter dramatischen Umständen stößt man auf ein riesiges Raumschiff, das erkennbar seit Jahrtausenden unterwegs ist.
Die Überraschung ist komplett, als man im Inneren auf – Menschen stößt! Eigentlich sind es Lemurer, d. h. Angehörige der „Ersten Menschheit“, die vor 50.000 Jahren von der Erde aus ein riesiges Imperium errichteten, Siedlerschiffe in die Galaxis schickten und nach einer Invasion der sechsgliedrigen „Bestien“ die Erde fluchtartig verließen.
Seit Äonen ist die „Nethack Achton“ also unterwegs. Das Wissen um die Herkunft oder den Grund der Reise ist in Vergessenheit geraten. An Bord hat sich ein eigener Mikrokosmos herausgebildet. Das Leben steht im Zeichen der stets begrenzten Ressourcen. Ein strenges Kastensystem mit quasi religiösen Zügen hat sich entwickelt. An der Spitze der Gesellschaftspyramide steht der „Naahk“ – zur Zeit Lemal Netwar -, der mit Hilfe einer Wach- und Schutztruppe – den „Tenoy“ – ein strenges Regime über sein Volk – die „Metach“ – führt. Dabei unterstützt ihn das „Netz“, eine künstliche Intelligenz, deren unsichtbare Fühler fast jeden Winkel der „Nethack Achton“ kontrollieren.
Allerdings nagt der Zahn der Zeit an der Technik. Außerdem mehrt sich unter den Metach der Unwillen über die Beschränkungen, die ihnen Naahk und Netz auferlegen. Was geht jenseits der Schiffsmauern vor, das wollen junge Männer und Frauen erfahren, die solchen Fragen Taten folgen lassen. Die Schiffsführung schlägt hart zurück, fordert Gegenreaktionen heraus. Der Konflikt schaukelt sich stetig hoch. In dieser Situation tritt Perry Rhodan auf den Plan. Um die Lage endgültig eskalieren zu lassen, nähert sich außerdem ein nicht zu Verhandlungen aufgelegtes akonisches Kommando …
Mehr als vier reale Jahrzehnte bringt Perry Rhodan nun schon Zucht & Ordnung ins Universum. Mal glückt ihm das, meist nur halbwegs und oft gar nicht. Unverdrossen versucht es stets aufs Neue. Das ist der Stoff, aus dem „seine“ Serie gestrickt ist, die sich zur „größten Science-Fiction-Serie der Welt“ gemausert hat.
Wobei „größte“ nicht „beste“ bedeutet. Spannende Unterhaltung möchte man den Lesern bieten, nicht mehr, nicht weniger. So lange die Latte auf diesem Niveau liegt, klappt das hervorragend. Übel wird’s dann, wenn „kosmisches Gedankengut“ sich im Geschehen breit macht; es scheint sich stets aus der legendären Schwurbelschaum-Materiequelle zu speisen …
Die „Lemuria“-Miniserie – bereits die dritte, die nach „Andromeda“ und „Odyssee“ im |Heyne|-Verlag läuft – lässt die großen universalen Mysterien außen vor. Stattdessen beackert man ein Feld, das seine Fruchtbarkeit bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Der Zyklus um die „Meister der Insel“ (PR-Bände 200-299) gehört zu den ganz großen Favoriten der Serie. Noch in deren Sturm-und-Drang-Phase entstanden, gelang die beinahe perfekte Mischung aus Science-Fiction und Abenteuer. Praktisch sämtliche Elemente des Genres kamen zum Einsatz, wurden unbekümmert mit Horror, Krimi, Krieg und allem, was die Welt der trivialen Unterhaltung sonst zu bieten hatte, verquickt. Gleichzeitig entstand zum ersten Mal in Vollendung jene „alternative“ Geschichte der Menschheit, für die PR mit Recht gerühmt wird.
Der „MdI-Zyklus“ hat – obwohl bejahrt – seine Faszination behalten. Hier war PR noch jung, bildete das Universum einen Spielplatz, auf dem sich die Autoren tummeln konnten. Sie sprudelten über vor Ideen, die nur zum Teil oder gar nicht bis zum Ende durchgespielt wurden und werden konnten. Viele rote Fäden fransten ins Leere aus – diese Lücken und angerissenen Episoden bildeten ein Futter, von dem die Saga vom „Erben des Universums“ bis heute zehren kann.
Immer wieder forderten die Fans die Rückkehr nach Andromeda. Mehrfach wurde ihnen dieser Wunsch erfüllt, denn PR mit MdI-Touch geht mit einem Bonus ins Rennen um die Gunst der Leser, was deren Griff um die Geldbörse lockert. Auf den Glanz der Vergangenheit setzt nun auch „Lemuria“ – oder möchte setzen, denn in „Die Sternenarche“ ist von dem alten, ins reale 21. Jahrhundert transponierten Zauber nur wenig zu spüren.
Sechs Bände sind zu wenig, um einen „richtigen“ Zyklus mit MdI-Patina zu schaffen. Für einen Episodenzyklus um die „Nethack Achton“ sind es möglicherweise zu viele. Grundsätzlich ist die Idee gut, an Bord eines Generationsraumschiffs zu reisen. Seit die Meister ihr Zepter schwangen, ist viel Zeit vergangen. „Neuigkeiten“ aus Andromeda können dosiert ins Geschehen eingebracht werden. Gleichzeitig kann man sich auf Bekanntes stützen – „Lemuria“ ist auch eine „Nacherzählung“ dessen, was das PR-Team um K. H. Scheer Anfang der 1960er Jahre schuf.
Leider ist so ein Generationsraumschiff auf der anderen Seite ein limitierter Ort für eine spannende, an überraschenden Wendungen reiche Story. In einem Anhang zur „Sternenarche“ gibt Hartmut Kaspar einen Überblick über das „Generationsraumschiff in der Science Fiction“, wo es eine eigene Nische besetzt – eine enge Nische, denn in solchen Dosenraumern geht es in der Regel recht ähnlich zu. Immer ist man schon so lange unterwegs, dass die ursprüngliche Mission in einem mythischen Nebel verschwunden ist. Religiöse Fanatiker und/oder der durchgedrehte Bordcomputer haben die Macht übernommen und knechten ihre „Untertanen“, die ihrerseits vergessen haben, dass sie in ihrer privaten Welt durchs All rasen. Im Schiff selbst gibt die Technik ihren Geist auf; allerlei Improvisationen müssen das ausgleichen.
Diese Melodie erklingt auch in der „Sternenarche“. Frank Borsch gelingt es nie, dem Thema etwas Neues abzugewinnen. Wenn man ihn für etwas rühmen kann, dann ist es u. a. die handwerklich saubere Umsetzung des Plots, die das Bekannte erzählerisch dicht und angenehm lesbar präsentiert. Die pseudodramatische Hast, die schlampig-saloppe, angeblich zeitgemäße und von der jugendlichen Leserschaft gewünschte Sprache (der sog. „Maddrax-Sprech“), welche beispielsweise die Lektüre der aktuellen „Atlan“-Miniserien (zu) oft zur Qual werden lassen, geht diesem ersten „Lemuria“-Band zu seinem Vorteil ab.
Viel geschieht also nicht – im Auftaktband zu einer Serie muss das Terrain halt erst vorbereitet werden für das, was noch folgt. Dies kann dem Verfasser leicht zum Korsett werden. Zudem muss der Nicht-PR-Insider bedacht werden, den man nicht durch die geballte Wucht der Serienfakten vom Buchkauf abschrecken will. Borsch versucht diese kaufmännische Intention wie gesagt nicht zu verschleiern, sondern erzählt ruhig und solide seine Story. PR-Interna streut er nebenbei ein. Der Hardcore-Fan wird sie registrieren.
Man kann folglich nicht Borsch vorwerfen, er ruhe sich auf den MdI/Lemuria-Lorbeeren aus. Er muss mit angezogener Bremse schreiben. Erst die folgenden Bände werden zeigen, ob die Verschmelzung der glorreichen PR-Vergangenheit mit der Gegenwart wirklich gelingt und womöglich etwas für die PR-Chronik Neues, Eigenständiges schafft.
Nichts Neues ebenfalls in Sachen Figurenzeichnung. Perry Rhodan ist ein schwieriger Charakter. Einerseits muss er als „normaler Mensch“ gezeigt werden, an dessen Denken und Handeln man Anteil nimmt. Andererseits ist er wahrlich steinalt und hat so viel Außergewöhnliches erlebt, dass er womöglich ein „kosmischer“ Mensch geworden ist, der in ganz anderen Sphären beheimatet ist als der Rest der Menschheit, deren Vertreter er durch seine bloße Ausstrahlung sprachlos werden lässt. Frank Borsch versucht dieses Problem zu thematisieren, indem er Rhodan quasi stellvertretend durch die Augen der „Palenque“-Besatzung beobachtet. Sie verkörpern den „Normalterraner“, der Rhodan mit einer Mischung aus (Ehr-)Furcht und betonter Kumpelhaftigkeit begegnet. Das funktioniert gut in dem begrenzten Rahmen, der in der PR-Serie die Grenze zwischen überzeugender Charakterdarstellung und hölzern-lächerlicher Gefühlsduselei markiert, denn Borsch bleibt klug innerhalb der Bildränder. (Die „Luftgitarren-Episode“ hätte er sich und uns freilich ersparen sollen.)
Natürlich kann die Rhodansche Dualität nie durchgehalten werden. Die ehernen Gesetze des auf Bewegung und Unterhaltung getrimmten Trivialromans (ein Begriff, der übrigens zunächst keinerlei negative Wertung beinhaltet) fordern ihren Tribut. Wieso ausgerechnet Perry Rhodan in das Geschehen verwickelt ist, darüber denke man lieber nicht nach. Was hat dieser Mann auf einer unwichtigen Mission in einem unwichtigen Sternensektor verloren? Für solchen diplomatischen Kleinkram dürfte Rhodan seine Leute haben. Aber wider alle Logik muss er immer wieder an einen Ort gebracht werden, wo es gefährlich und turbulent zugeht. Als weisen Ratgeber im Hintergrund mögen die Fans ihren Perry nicht sehen; er muss auch – bildhaft gesprochen – die Fäuste schwingen.
Warum hat man nicht einen seiner (Kampf-)Gefährten mit auf die Ochent-Mission geschickt? Fast durchweg agieren nur Rhodan oder Atlan an der Front. Es gibt durchaus andere, farbenfrohe, von der Leserschaft geliebte Figuren, von denen man viel zu wenig hört. Die Besatzung der „Palenque“ bietet da kein Ersatz. Allzu austauschbar wirken die Charaktere. Die Kommandantin soll eine starke Nebenfigur darstellen. Borsch fällt dazu nur ein, ihr cholerische Züge und ein exaltiertes Verhalten aufzuprägen. Immerhin übertreibt er es nicht wie so viele seiner PR-Teamkollegen und degeneriert sie zur peinlichen, eindimensionalen Karikatur einer Figur.
Ähnlich ergeht es dem Tenoy der „Nethack Achton“. Schon wieder einer dieser absolutistischen Fundamentalisten, die sich im Besitz der „einzigen Wahrheit“ wähnen, ihre Schäflein für die „gute Sache“ unterdrücken und Abweichler unbarmherzig jagen lassen! Allerdings arbeitet Borsch auch hier mit Licht und Schatten. Tenoy ist kein tumber Bösewicht, sondern ein Mensch, der unter seinem Amt leidet, sein Tun hinterfragt und neuem Gedankengut gegenüber aufgeschlossen ist.
Selbstverständlich spielen die Gegner des Tenoy ebenfalls ihre bekannten Rollen. Jung und idealistisch sind sie, neugierig und nicht gewillt, sich länger dem System frag- und klaglos zu beugen. (Seltsam, dass Rhodan stets pünktlich dort auftaucht, wo’s gerade kritisch wird …) Dazu kommen eine zarte Liebesgeschichte plus viel persönliche Tragik, denn Helden und Heldinnen müssen schließlich leiden.
Solina Tormas schließlich fällt die Aufgabe zu, die in der PR-Chronik seit langer Zeit aus dem Blickfeld geratenen Akonen wieder in die Handlung zu führen. Als Historikerin und Spezialistin für lemurische Geschichte steht sie zwischen Akonen und Terranern – eine gut gewählte Figur, um die Differenzen und Ähnlichkeiten zwischen den Völkern (die ja beide von den Lemurern abstammen) plastisch zu machen. Man bemerkt hier die Fortschritte, die PR in mehr als vier Jahrzehnten gelungen sind: Die einst eindimensionalen, arroganten und hinterlistigen Akonen gliedern sich in Gruppen und Individuen mit eigenen, durchaus nicht chronisch unredlichen Zielen, ohne gleichzeitig jene Züge zu verlieren, die sie „akonisch“ wirken lassen.
Frank Borsch (geb. 1966 in Pforzheim) studierte bis 1996 Englisch und Geschichte in Freiburg. Um sich zu finanzieren, nahm er eine lange Reihe von Jobs an, arbeitete aber auch an einem Umwelthandbuch für Osteuropa mit und war Webmeister seiner Universität. 1996 saß er unter den Teilnehmern eines Science-Fiction-Seminars, das die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel ausrichtete. Hier wurde er „entdeckt“: Wolfgang Jeschke, der langjährige Chefredakteur von Heynes SF-Reihe, heuerte ihn als Übersetzer an; ausgedehnte Auslandsaufenthalte und ein Intermezzo als Deutschlehrer im irischen Belfast hatten ihn mit der englischen Sprache vertraut werden lassen.
Zusätzlich übersetzte Borsch Comics für |Marvel Deutschland|. Gleichzeitig begann er zu schreiben, verfasste Romane und Kurzgeschichten, aber auch Artikel vor allem zum Thema Internet. 1998 stieg er mit „Der Preis der Freiheit“, seinem Beitrag zur „Atlan“-Miniserie „Traversan“ ins PR-Universum ein. Ab 2001 gehörte er als Redakteur dem PR-Team in Rastatt an. Seit 2004 ist er Stammautor der „Perry Rhodan“-Heftserie.
Frank Borsch lebt und arbeitet in Freiburg.
Der „Lemuria“-Zyklus …
erscheint im |Heyne|-Verlag:
1. Frank Borsch: Die Sternenarche
2. Hans Kneifel: Der Schläfer der Zeiten
3. Andreas Brandhorst: Exodus der Generationen
4. Leo Lukas: Der erste Unsterbliche
5. Thomas Ziegler: Die letzten Tage Lemurias
6. Hubert Haensel: Die längste Nacht
David Morrell – Totem
Potter’s Field ist eine kleine Gemeinde im US-Staat Wyoming. Farmer stellen hier die Mehrheit der Bürgerschaft. Das Leben ist hart und schlicht, die Verbrechensrate niedrig. Das gefällt vor allem dem Polizeichef Nathan Slaughter. Nachdem er, der Star der Detroiter Mordkommission, versehentlich zwei minderjährige Diebe niederschoss, ist sein Nervenkostüm angegriffen. In der Provinz möchte er wieder zu sich finden.
Leider hat er sich keinen idealen Ort für den Neuanfang ausgesucht. Potter’s Field war vor sechs Jahren Zentrum einer bizarren Tragödie. Der Sektenguru Quiller hatte sich mit 200 Hippie-Gläubigen in der ‚unverdorbenen‘ Wildnis ein neues Utopia schaffen wollen. Im strengen Winter von Wyoming hatte der Traum im Desaster geendet; zu Dutzenden waren die Unglücklichen erfroren. Der Journalist Gordon Dunlap hatte damals einen bemerkenswerten Bericht über diese Ereignisse verfasst. Das Grauen hatte ihn niemals losgelassen. Er ist zum Säufer geworden, der wie Slaughter in Potter’s Field sein Leben wieder in den Griff zu bekommen versucht. David Morrell – Totem weiterlesen
August Derleth (Hg.) – Rendezvous mit dem Würgeengel, Horrorgeschichten
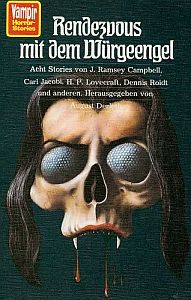
Michael Benson – Jenseits des Blauen Planeten
Seit mehr als vierzig Jahren erforscht der Mensch das Weltall. Die relativ nahe am Heimatplaneten gelegenen Ziele nahm er noch persönlich unter die Lupe. Gleichzeitig drangen jedoch bereits unbemannte Raumsonden immer weiter vor. Bis zum heutigen Tag verdanken wir diesen technischen Dienern das Bild eines Sonnensystems, das beinahe bei jeder neuen Mission teilweise oder ganz auf den Kopf gestellt wird.
Satelliten und Sonden umkreisen fremde Planeten, Monde, Asteroiden, landen auf ihnen, nehmen Proben, machen Fotos. In vielen Jahren hat sich ein Archiv von Informationen und Bildern angesammelt, das wohl niemals vollständig ausgewertet werden kann – und die Flut steigt ständig höher. Michael Benson hat es unternommen, diese Archive zu durchforsten. Nicht weniger als eine Foto-Reise durch das Sonnensystem schwebte ihm vor. Solche Bildbände gab es schon oft, aber wohl niemals zuvor ging ein Autor so unbeeindruckt vom Wust scheinbar lebenswichtiger Fakten an seine Aufgabe heran. Michael Benson – Jenseits des Blauen Planeten weiterlesen
Ben Elton – Tödlicher Ruhm
Auf BPK-TV, einem erfolgarmen Sender, dümpelte „Hausarrest“, ein Menschenzoo à la „Big Brother“, bisher ohne besondere Zuschauerresonanz dahin. Am 27. Tag ist einer der Insassen durchgedreht und hat eine Mitgefangene erstochen. Leider (und merkwürdigerweise) haben die sonst allgegenwärtigen Kameras zwar die Bluttat, aber nicht das Gesicht des Täters festgehalten.
Der Verdacht liegt nahe, dass es einem der anderen Teilnehmer gehört. Chief Inspector Coleridge von der Mordkommission sieht sich bei seinen Ermittlungen indes vor ein für ihn ganz neues Problem gestellt: Nachdem die Quoten durch die Schreckenstat plötzlich in die Höhe schnellten, wollen die Macher „Hausarrest“ ganz und gar nicht absetzen. Die Show wird weitergehen. Coleridge muss seine Verdächtigen ‚von außerhalb‘ überprüfen. Ben Elton – Tödlicher Ruhm weiterlesen
Erhard Schütz/Eckhard Gruber – Mythos Reichsautobahn
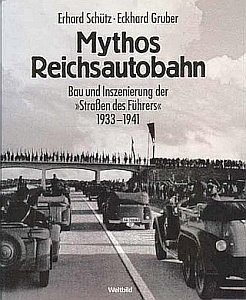
Erhard Schütz/Eckhard Gruber – Mythos Reichsautobahn weiterlesen
Matthew Reilly – Der Tempel
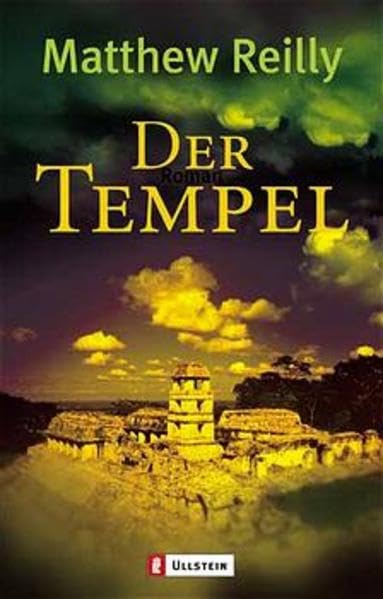
Matthew Reilly – Der Tempel weiterlesen
Meyer, Kai – Rattenzauber, Der
Seltsame Kunde erreicht im verregneten Spätsommer des Jahres 1284 den Hof des Herzogs Heinrich von Braunschweig. In der abgelegenen Grenzregion seines Territoriums, wo die von dichtem Wald bedeckten Höhen des Teutoburger Waldes besonders schroff und abweisend sind, liegt am Flusse Weser die alte Stadt Hameln. Hier soll vor drei Monaten ein seltsamer Mann oder Hexer erschienen sein, der mit dem Klang seiner Flöte die Kinder der braven Bürger betört und 130 von ihnen mit sich genommen habe; sie sind seither spurlos verschwunden.
Solche Vorfälle mag der Herzog nicht dulden. Hameln ist ein wichtiger Bestandteil seiner ehrgeizigen Wirtschaftspolitik. Seit Jahren pumpt Heinrich viel Geld in die Stadt, die am Hellweg liegt, dem alten Fernhandelsweg, der die Gewerbestädte an Maas und Rhein mit den Ostseestädten verbindet. Er schickt seinen Ritter Robert von Thalstein nach Hameln, um vor Ort den seltsamen Gerüchten auf den Grund zu gehen.
Auf den Ritter ist seine Wahl gefallen, weil dieser in Hameln geboren wurde. Doch schon vor zwanzig Jahren hat Robert nach dem tragischen, von ihm verschuldeten Tod seiner Familie die Weserstadt verlassen und kehrt nur ungern dorthin zurück. Zudem gestalten sich seine Nachforschungen schwierig: Aufgrund komplizierter Bündnisverträge muss sich der Herzog von Braunschweig die Macht in Hameln mit dem Bischof Volkwin von Minden teilen. Nur mühsam halten die beiden konkurrierenden Fürsten Frieden.
Robert wird als Parteigänger des Braunschweigers sogleich in die örtlichen Querelen verwickelt. Über Hameln lastet eine eigenartige Atmosphäre von Angst und Misstrauen. Die Bürger geben Robert gegenüber Unkenntnis vor, schweigen oder drohen gar offen mit Gewalt. Ausgerechnet Gunthar von Wetterau, früher selbst Ritter und nun Probst des Bischofs, gewährt Roland seine Hilfe, doch dieser sieht sich vor – die Zeichen mehren sich, dass in Hameln etwas Unheimliches vorgeht. Was weiß die junge Julia, Nonne im örtlichen Klarissenkloster und angeblich vor drei Monaten eines der 130 verschwundenen Kinder? Haben die ketzerischen Wodans-Jünger, die auf einem alten Friedhof jenseits der Weser hausen, ihre Hände im Spiel? Wer ist der alte Eremit, der zu Füßen des von tiefen Höhlen durchzogenen Kopfelberges genau 130 bestürzend menschenähnliche Alraunenstöcke zieht? Immer tiefer dringt Roland in die Mysterien von Hameln vor, lässt sich von Warnungen und Mordanschlägen nicht schrecken und stößt schließlich auf die Spur eines bizarren Komplotts fanatisierter Gläubiger, die Gottes Hilfe nicht erbitten, sondern herbeizwingen wollen …
Ein Mystery-Thriller aus deutschen Landen – kaum zu glauben, dass es so etwas gibt. Noch bemerkenswerter: ein Thriller, der in Form und Inhalt jederzeit überzeugen kann. Es gibt ihn also, den phantastischen Roman aus Deutschland. Man wird leicht müde, ihn zu suchen, denn er ist – wie es sich für eine echte Nadel gehört – in einem Heuhaufen bzw. unter einem Fuder Mist begraben, der jene literarische Vorhölle markiert, die den nur zu typischen Tausend-John-Sinclair-Hefte-gelesen-und-das-kann-ich-auch-Autoren vorbehalten ist.
Dabei ist Deutschland mit seiner vielhundertjährigen Geschichte und seinem reichen Sagen- und Legendenschatz für das phantastische Genre ein Claim, dessen Reichtum mit dem schottischen Hochland oder dem amerikanischen Neu-England (King’s Country) allemal konkurrieren kann! Man muss nur über das richtige Werkzeug verfügen – und natürlich wissen, wie man es einsetzt!
Kai Meyer besitzt das eine und versteht das andere. Das Ergebnis ist – es kann gar nicht oft genug wiederholt werden – ein überdurchschnittlicher Unterhaltungsroman. Schon Ort und Zeit der Handlung überzeugen. Die Sage vom Rattenfänger, der den Bürgern Hamelns, die ihn um seinen Lohn geprellt haben, die Kinder entführt, ist selbst heute noch allgemein bekannt. (In Hameln hat man aus der Not übrigens eine Tugend bzw. eine Touristenattraktion gemacht und führt an jedem Wochenende zwischen Mai und September im Herzen der Altstadt die Ereignisse von einst als Schauspiel auf; inzwischen gibt es sogar eine Musical-Version namens „Rats“!) Meyer verknüpft sie mit wenigen, aber klug gewählten geschichtlichen Realitäten. Nichts ist so furchtbar zu lesen wie jene „historischen“ Romane, deren Handlung unter der Last angelesener und papageiengleich weitergegebener Fakten in die Knie geht.
Noch ein Pluspunkt: Meyer verzichtet darauf, seine Figuren „mittelalterlich“ denken, handeln und sprechen zu lassen. Das ist für nicht nur für diejenigen Leser, die mit dem Thema vertraut sind, eine uneingeschränkte Erleichterung, denn es geht – wenn man nicht gerade Umberto Eco heißt – garantiert schief. Im Umfeld des „Rattenzaubers“ ist es zudem gar nicht erforderlich. Meyers „stilisiertes“ Mittelalter funktioniert für seine Schauergeschichte genau so, wie es sollte.
Diese Geschichte ist natürlich nicht wirklich neu. Aber wer würde und könnte dies heutzutage noch verlangen? Außerdem wartet Meyer mit einer Lösung des Rattenfänger-Rätsels auf, die man so nicht erwartet hätte. Sie ist nicht unbedingt originell und wirkt auch nicht durchgängig überzeugend, aber sie baut wirkungsvoll auf der Prämisse auf, dass der Mensch keine Teufel braucht, um sich die Hölle auf Erden zu bereiten.
Stilistisch hält Meyer das Heft fest in der Hand. Hier und da rutscht der Erzählfluss ins Pseudoatemlos-Hastige ab, aber meistens hält der Autor den Handlungsfaden straff und erzählt einfach eine Geschichte, die unterhalten soll – eine Forderung, die so einfach zu erfüllen scheint, an der die deutschen SF-, Fantasy- und vor allem Horror-Schriftsteller aber regelmäßig scheitern. Da kann man für einen Erzähler, der sein Handwerk versteht, nur um so dankbarer sein.
Giles Blunt – Blutiges Eis
In Algonquin Bay, einer Kleinstadt in der kanadischen Provinz Ontario, staunt man über einen ungewöhnlich milden Januar. Für einen US-amerikanischen Urlauber war dies fatal; man findet seine von hungrigen, vorzeitig aus dem Winterschlaf erwachten Bären zerfetzte Leiche. Detective John Cardinal und seine Kollegin Lise Delorme stellen allerdings fest, dass der Pechvogel schon tot war, als ihn sein Schicksal ereilte; tatsächlich ist er ermordet worden.
Die Polizisten verdächtigen einen Trapper, dem sie Verbindungen zur örtlichen Unterwelt nachsagen. Längst hat die Mafia ihre Tentakel bis Kanada ausgestreckt. Allerdings gibt es eine weitere Spur: Der inzwischen identifizierte Tote erweist sich als ehemaliges Mitglied der CIA, das vor vielen Jahren unrühmlich mit dem „Canadian Security Intelligence Service“ (CSIS) zusammenarbeitete. Dieser gedenkt keineswegs, sich von zwei Außenstehenden in die Karten schauen zu lassen, und bemüht sich nach Kräften Cardinal und Delorme in die Irre zu führen. Zudem scheint es um die Vertuschung eines Skandals aus den frühen 1970er Jahren zu gehen, als diverse kanadische Separatistengruppen systematisch aber nicht immer gesetzkonform infiltriert und provoziert wurden. Giles Blunt – Blutiges Eis weiterlesen
Lumley, Brian – Sie lauern in der Tiefe (Titus Crow 1)
Für Titus Crow, den berühmten Okkultisten und Fachmann für das Übernatürliche, lassen sich die Zeichen nicht anders deuten: Die „Großen Alten“ schicken sich an zurückzukehren, um die Menschen zu überfallen, zu unterjochen und auszurotten! Mächtige Wesen aus den Tiefen des Weltalls sind sie, die vor Jahrmillionen die Erde bevölkerten, dem Chaos und der Zerstörung frönten und nach einem apokalyptischen Kampf von ihren Gegnern, den „Älteren Göttern“ aus dem Sternbild Orion, bezwungen und an verschiedenen öden Stätten gefangen gesetzt wurden. Dort lauern sie, die praktisch unsterblich sind, auf ihre Chance zu entkommen.
Nach Äonen scheinen die Siegel, welche sie bannen, ihre Wirkung zu verlieren. An zahlreichen Orten rühren sich die „Alten“ und ihre dämonischen Diener wieder. Im Fundamentgestein der britischen Insel breitet sich die Brut des Shudde-M’ell aus. Seine Diener, die wurmgestaltigen Chtonier oder „Wühler“, graben sich zu jenen Menschen durch, die ihnen auf die Spur gekommen sind, und schalten sie aus. Niemand darf wissen, dass Shudde-M’ell die Befreiung seines Herrn, des schrecklichen Cthulhu, vorbereitet, denn noch sind die „Alten“ für den offenen Krieg nicht bereit.
Auch Titus Crow und sein Freund und Mitstreiter Henri Laurent de Marigny werden unbarmherzig gejagt. Schon scheinen sie verloren, da nimmt sich die geheime Wilmarth-Stiftung ihrer an. Hier arbeiten Wissenschaftler schon lange an wirksamen Waffen gegen die „Alten“. Man fühlt sich einem Schlagabtausch inzwischen durchaus gewachsen. Crow und de Marigny lassen sich „rekrutieren“ und reihen sich ein in die Schar der Kämpfer für das Gute. Freilich stellt sich heraus, dass man den Feind allzu selbstbewusst unterschätzt hat. Shudde M’ell und seine Chtonier haben noch mehr als ein Ass im nicht vorhandenen Ärmel …
Wohl steht es um die Unsterblichkeit dessen, dem es gelingt, einen Mythos zu schaffen. Ausgerechnet Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), einem gehemmten, für das „richtige“ Leben untauglichen Mann, ist es gelungen. Sein |Cthulhu|-Kosmos gehört zu den ganz großen Schöpfungen der (phantastischen) Literatur.
Was sich schon an der Vielzahl der Nachahmer, Fortsetzer und Neuinterpretierer ermessen lässt. Ob nun Pastichés im typischen Lovecraft-Stil oder das Spiel mit Namen und Geschöpfen seiner Kreation: Cthulhu & Co. leben fort auf ewig. Ihre „neuen“ Herren treibt oft großer Ehrgeiz. Wo Lovecraft sich mit wenigen Novellen und Kurzgeschichten begnügte, schreiben sie dicke Romane oder wie Brian Lumley ganze Serien. Sechs Bände umfasst die Titus-Crow-Reihe. Sie erzählt vom großen Krieg der Menschen gegen die bösen „Alten“ aus dem Untergrund. Mit „Sie lauern in der Tiefe“ beginnt das Spiel jedoch recht mittelmäßig.
Seltsam konfus windet sich die Handlung. Es gibt keinen „richtigen“ Beginn, das Ende ist offen. Das letzte Drittel wird in Form von Briefen erzählt, die in großen Zeitsprüngen von diversen Feldzügen berichten. Zu einem Ganzen fügt sich das alles nicht. Eine „typische“ Cthulhu-Story aus Lovecrafts Feder wirkt zwar ebenfalls wie der hastig niedergekritzelte und daher fragmentarische Bericht eines Unglückswurms, den die Krakenfrösche holen, bevor er diesen anständig beenden oder gar überarbeiten kann. Dies ist jedoch ein Roman. Der „briefliche“ Einstieg geht als Stilelement durch. Für den ruckartigen Abschluss gibt es keine Entschuldigung. „Sie lauern in der Tiefe“ wirkt wie ein Buch, das zu schreiben sein Verfasser irgendwann die Lust verlor. Allzu deutlich wird, dass dies der erste Teil einer Serie ist. Die „Titus Crow“-Reihe muss eigentlich als Gesamtwerk gelesen werden. Dann mag tatsächlich der Eindruck eines monumentalen Epos über den Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Menschen und Monstern entstehen.
Was andererseits unwahrscheinlich ist. „Sie lauern in der Tiefe“ zeigt den frühen Brian Lumley als fleißig recherchierenden, aber lahm erzählenden Autoren. Viel zu sehr lehnt er sich an seinem Vorbild Lovecraft an. Halt, die Krux ist ja, dass es eben nicht Lovecraft ist, von dem sich Lumley inspirieren lässt, sondern dessen Eckermann August Derleth (1909-1971), der nicht nur den literarischen Nachlass des Meisters betreute und herausgab, sondern mit vielen eigenen Geschichten den Cthulhu-Kosmos ergänzte und erweiterte.
Derleth spielt längst nicht in Lovecrafts Liga. Diesem war sehr wohl bewusst, dass ein großer Teil der Faszination an der Cthulhu-Saga aus dessen Unvollständigkeit resultierte. Bruchstücke gab Lovecraft preis, die sich zudem nur bedingt zu einem Gesamtbild fügten. Die Fantasie des Lesers musste die Lücken füllen – für Derleth offenbar ein unerträglicher Zustand. Nachträglich begann er, die Fragmente zu sortieren und zu ergänzen. Um Cthulhu und die anderen Unwesen, die Lovecraft oft nur erwähnte, schuf er einen regelrechten „Götterhimmel“. Er rief immer neue „Große Alte“ ins Leben, konstruierte ihnen Abstammungslinien und „Stammbäume“, „rekonstruierte“ ihrer Geschichte. Aus „Göttern“ wurden simple Außerirdische, die sich bisweilen auf die Plasmasäume traten, so zahlreich ließ Derleth sie umher spuken. Auf der Strecke blieb jenes diffuse und nachhaltige Grauen, welches das ursprüngliche Cthulhu-Mysterium ausstrahlte. Nun treibt es Brian Lumley ein gutes (bzw. schlechtes) Stück weiter. Noch mehr „Alte“ lässt er auftreten, stellt ihnen „Tiefe“ und „Niedere“ an die Seite – das Grauen organisiert sich wie die Mafia und Don Cthulhu ist der Pate.
Misslungen ist der Versuch, den eigentümlichen, gern parodierten, aber eben doch unnachahmlichen Tonfall Lovecrafts zu imitieren. Der „Einsiedler von Providence“ bekam nie seine Adjektivitis in den Griff. Also faselt auch Lumley von „blasphemischem Licht“, „beunruhigenden Winkeln“ oder „wahnsinnigen Windstößen“. Weiterhin wird Grauen nie stimmungsvoll inszeniert, sondern immer nur behauptet. Wovor Crow & Co. sich eigentlich fürchten, wird selten präzisiert. Geht Lumley ins Detail, wirkt das Böse nicht besonders aufregend. Lästig ist auch der (ebenfalls Lovecraft entliehene) Drang allzu vieler menschlicher Nebendarsteller, im Angesicht des Feindes vor Schreck den Verstand zu verlieren. Solche und viele andere Lovecraft-Manierismen äfft Lumley nach, statt eigene und zeitgemäße Wege einzuschlagen.
Ganz im Lovecraftschen Sinn stehen Geschehen und Stimmung im Vordergrund von Lumleys Geschichte. Die Protagonisten bleiben flach und austauschbar. Crow und de Marigny nehmen vor unserem inneren Auge nie wirklich Gestalt an. Der Verfasser prägt ihnen einige äußere Merkmale und Charaktereigenschaften auf. Individuen werden sie dadurch nicht; sollen sie auch nicht, denn ihre eigentliche Aufgabe ist es, auf Entdeckungsreise durch das Reich der „Großen Alten“ zu gehen. Wo diese in Erscheinung treten, erscheint unser Duo, um zu kommentieren und zu erläutern. Crow übernimmt dabei die Rolle des allwissenden Sherlock Holmes, während de Marigny als Watson in Vertretung des Lesers Fragen zu Handlung und Hintergrund stellt. Da Crow ebenfalls wie Holmes ein schrecklicher Geheimniskrämer ist, beschränkt er sich gern auf viel sagende Andeutungen, denen die enthüllten Geheimnisse kaum jemals gerecht werden.
Um die beiden Monsterjäger bewegt sich ein Reigen gesichtsloser Nebendarsteller. Profil benötigen sie erst recht nicht, denn meist fallen sie sehr schnell einem schrecklichen Schicksal zum Opfer und werden von Cthulhus Schergen geschnappt. Eine gewisse Ausnahme bildet Wingate Peasley, der in die Wilmerth-Stiftung einführt. Auch er bleibt freilich eine Figurenhülse, deren Handeln der Leser ohne innere Teilnahme beobachtet.
Die „Alten“ halten sich klug im Hintergrund. Schlimm genug, dass Lumley sie von unbegreiflich fremdartigen Geschöpfen aus Zeit & Raum zu Protoplasma-ETs degradiert, die mit Wasser-Blattschuss & radioaktiver Strahlung erlegt werden können. Helle sind sie sowieso nicht. Kommen sie zu Wort, verbreiten sie nur kryptischen Unsinn und leere Drohungen. Was wollen sie eigentlich mit der Erde, die sie so begehren? Man sollte meinen, sie würden sich umgehend deren Staub von den Tentakeln schütteln, um endlich zurück ins All, ihre eigentliche Heimat, zu fliehen. Lovecraft ließ die Motive der „Alten“ offen. Lumley will auch hier „erklären“ und versetzt dem Cthulhu-Mythos einen weiteren Tiefschlag.
Dem Nachwuchstalent Brian Lumley (geb. 1937 in England) stand ein großer Mentor zur Seite: August Derleth (1909-1971), der Nachlassverwalter von H. P. Lovecraft (1890-1937) und Gründer des legendären Verlags |Arkham House| in Wisconsin/USA, veröffentlichte seine ersten Storys, die ab 1967 – Lumley war Militärpolizist und in Deutschland stationiert – entstanden. Nach Derleth’ Tod blieb Lumley dem Cthulhu-Mythos verhaftet und schrieb zwischen 1974 und 1979 fünf Bände der Titus-Crow-Saga. (Ein abschließender Band kam 1989 hinzu). Ebenfalls „lovecraftschen“ Horror bot Lumley mit der „Primal Lands“-Trilogie um Tarra Khasch sowie mit der „Dreamland“-Saga.
Sein Durchbruch als Schriftsteller gelang Lumley – der 1980 nach 22 Dienstjahren die Armee verlassen hatte – nach gewissen Anlaufschwierigkeiten mit der „Necroscope“-Reihe (ab 1986) um den „Totenhorcher“ Harry Keogh, die der Verfasser inzwischen mit dem 14. Band beendet hat und die auch in Deutschland mit großem Erfolg veröffentlicht wird.
Brian Lumley lebt und arbeitet heute in Devon, England. Er lässt seine Website http://www.brianlumley.com sorgfältig pflegen und regelmäßig mit Neuigkeiten bestücken.
Die Titus-Crow-Reihe:
1. The Burrowers Beneath (1974; dt. „Sie lauern in der Tiefe“)
2. The Transition of Titus Crow (1975; dt. „Die Herrscher der Tiefe“)
3. The Clock of Dreams (1978)
4. Spawn of the Winds (1979)
5. In the Moons of Borea (1979)
6. Elysia: The Coming of Cthulhu (1989)
Pelecanos, George P. – große Umlegen, Das
Washington D. C. 1946: Ein Jahr ist vergangen, seit Peter Karras heimkehrte. Seine Welt – das war und ist das „Griechische Viertel“ der Hauptstadt der USA. Unter den Arbeitern, kleinen Händlern, Krämern und Kneipenbesitzern ist er zu Hause; sein Vater Dimitri betreibt einen Obst- und Gemüsestand. Karras ist bekannt und geachtet, im Pazifikkrieg hat er sich als Angehöriger des Marine Corps hervorgetan. Nun ist er verheiratet, hat Freunde, die er schon seit Kindertagen kennt – ein geordnetes Leben auf den ersten Blick, doch Risse tun sich auf, deren Wurzeln tief in die Vergangenheit reichen. Karras ist unruhig. Er stellt höhere Ansprüche an das Leben als sein Vater und er möchte es weiter bringen als dieser, aus dem die Jahre harter, nie wirklich einträglicher Arbeit einen verbitterten Trinker gemacht haben. Mit der „alten Heimat“ Griechenland und den Idealen seiner Eltern weiß Karras wenig anzufangen. Er gehört zur ersten Generation der Immigrantensöhne, die versuchen, sich anzupassen und tatsächlich heimisch zu werden in den USA.
Karras versucht sich als Handlanger eines örtlichen Gangsterbosses und Kredithais. Burke verleiht Kredite zu Wucherzinsen und erpresst „Schutzgelder“ von den Ladenbesitzern in „seinem“ Viertel. Joe Recevo, Karras‘ bester Freund, hat ihn Burke empfohlen. Doch Karras bringt es nicht fertig, säumige Schuldner mit brutaler Härte an ihre Zahlungsverpflichtungen zu erinnern. Burke beschließt ihn fallen zu lassen. Doch zuvor will er Karras eine Lektion erteilen und ihn von seinen Schergen verprügeln lassen. Recevo wird zum Judas, als er den arglosen Freund in eine sorgfältig vorbereitete Falle führt, denn er kennt die ungeschriebenen Gesetze der Unterwelt: Bekommt Burke nicht seinen Willen, ist Karras ein toter Mann. Aber die Sache gerät außer Kontrolle, als der sadistische Reed, ein weiteres Mitglied der Gang, endlich die Chance sieht, sich an Karras, der seiner Meinung nach den nötigen Respekt ihm gegenüber vermissen lässt, zu rächen. Vorsätzlich zertrümmert er Karras‘ Knie und macht ihn zum Krüppel.
Drei Jahre später: Karras hat seine Träume von einer besseren Zukunft begraben. Er ist als Koch bei seinem Freund Stefanos in dessen Kneipe „Nick´s“ untergekommen. Doch die Vergangenheit holt ihn auch in der Küche schließlich ein. Burke will seinen Einflussbereich ausdehnen. Er hat ein Auge auf „Nick´s“ geworfen und fordert ein hohes monatliches Schutzgeld. Stefanos weigert sich zu zahlen. Burke schickt seine Schläger, doch Stefanos gelingt es mit Karras‘ Hilfe, die Gangster auszuschalten. Karras weiß nur zu gut, dass Burke bald zurückschlagen wird …
Eine kaltherzige Welt und ihre auf Gedeih und Verderb miteinander verbundenen Bewohner; ein um sich selbst kreisender Mikrokosmos, der scheinbar neben der „realen“ Welt existiert, bevölkert von nur scheinbar starken Männern und schwachen Frauen, die wie von unsichtbaren Fäden gezogen auf ihr Verhängnis zusteuern; Menschen in der Krise, Menschen auf der Schattenseite des Lebens, die versuchen, sich ihr Stück vom Kuchen zu holen, und die doch am Ende mit leeren Händen dastehen – wenn sie denn noch stehen können! Keine Frage: Wir befinden uns in der Welt der „Schwarzen Serie“, in der sich die Hoffnung auf ein besseres Leben oder gar Glück stets als grausam enttäuschte Illusion erweist.
Noch bekannter als die Romane der „Schwarzen Serie“ ist ihr Pendant auf der Kinoleinwand geworden: der „Film Noir“ ist ein seltenes Beispielen dafür, dass Hollywood manchmal originell sein kann. Das Genre entstand in der Umbruchphase nach dem für die USA zwar gewonnenen, an der „Heimatfront“ aber mit tief greifenden gesellschaftlichen Verwerfungen einhergehenden II. Weltkrieg und brachte einige der größten Filmklassiker überhaupt hervor.
Die Zeit des „Film Noir“ (ver-)endete in der bleiernen Eisenhower-Ära der 1950er Jahre. Die Romane der Schwarzen Serie überlebten, wenn auch nur in einer kleinen Nische am Rande der Krimiszene. George P. Pelecanos gelingt nun das Kunststück, das Genre neu zu beleben und auf den aktuellen Stand zu bringen. Den gleichen Dienst konnte er einer anderen Gattung erweisen: der „Privat-Eye-Novel“ und jenen Geschichten, in denen sich ein notorisch erfolgloser, aber aufrechter Privatdetektiv (inzwischen ruhig auch weiblichen Geschlechts) einsam und trotzig daran macht, einen hoffnungslosen Fall zu klären. Pelecanos gewinnt auch diesem Klischee neue Seiten ab, indem er aus seinem „Helden“ den vielleicht ersten authentischen „proletarischen“ Detektiv macht.
„Das große Umlegen“ ist der erste Teil einer Trilogie, die sich mit der „kriminellen Geschichte“ Washingtons kurz vor und vor allem nach dem II. Weltkrieg beschäftigt. Die Hauptstadt der USA bringt man gemeinhin nicht mit dem „gewöhnlichen“ Verbrechen in Verbindung. Thriller-Autoren lassen hier gern Bösewichte in feinen Nadelstreifenanzügen in Pentagon und Weißem Haus welterschütternde Verschwörungen ausbrüten. Darüber gerät leicht in Vergessenheit, dass Washington jenseits seiner politischen Arenen eine moderne Großstadt mit den üblichen Alltagsproblemen ist. Konflikte zwischen ethnischen Gruppen und die Machenschaften des organisierten Verbrechens sind dafür nur zwei Beispiele, die indes eng miteinander verzahnt sind.
Die USA galten lange als „gelobtes Land“ für Auswanderer aus Europa, die den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zwängen ihrer alten Heimat entfliehen wollten. Jenseits des Großen Teiches mussten sie indes rasch erkennen, dass sie auch hier nicht mit offenen Armen empfangen wurden. Zum Kulturschock kam die Sprachbarriere. So ist es kaum verwunderlich, dass die Emigranten unter sich blieben. Bald gab es in den großen Städten Nordamerikas regelrechte „italienische“, „russische“ oder „deutsche“ Viertel. Ihre Bewohner blieben mit ihrer Sprache, ihren Sitten und Gebräuchen unter sich, wo sie sich heimisch fühlten. Auf der anderen Seite isolierten sie sich auf diese Weise vom übrigen Amerika, in dem sie als schlecht verdienende Kleinstunternehmer und Hilfsarbeiter eine Nische nur am Rande der Gesellschaft fanden. Einen Weg aus diesem Mikrokosmos, der gleichzeitig ein Teufelskreis war, gab es nur für jene, die dem „Ghetto“ dank einer guten Ausbildung und eines Quäntchens Glück den Rücken wenden konnten.
Eine überschaubare Welt, abgeschottet und außerhalb der „normalen“ amerikanischen Gesellschaft stehend, bevölkert von Menschen, die Vertretern von Gesetz und Ordnung mit Misstrauen begegneten – das ist eine Welt, die als Opfer für das organisierte Verbrechen prädestiniert ist. Auf der einen Seite scheinbare Volksnähe demonstrierend und den Einwanderern auf „unbürokratischem“ Wege Kleinkredite gewährend, auf der anderen „Schutzgelder“ erpressend, halten die Banden Einzug auch in das griechische Viertel Washingtons, in dem George P. Pelecanos die Familie Karras angesiedelt hat. Die Gangster leben gut und müssen sich nicht sieben Tage in der Woche für einen Hungerlohn krumm legen. Da liegt es für viele Jugendliche des Viertels nahe, auf dem Weg zum Wohlstand eine Abkürzung zu versuchen. Für den, der bereit ist, die Drecksarbeit für die Bosse zu erledigen, gibt es immer etwas zu tun. Pete Karras, gerade zurückgekehrt aus dem Krieg, wo er jenseits seines bisher beschränkten Horizontes eine ganz neue Welt kennen gelernt hat, wird für einen besonders perfiden Job angeheuert: Er soll von den eigenen Landsleuten rückständige Wucherzinsen eintreiben. Aber er, der anständige Proletarier, kann nicht heraus aus seiner im Grunde ehrlichen Haut. Der Preis, den dafür bezahlt, ist hoch, aber er hat seine Lektion gelernt – auch wenn er dies letztlich nicht überleben wird.
George Peter Pelecanos kennt die Stadt Washington und ihre Geschichte; die hellen wie die dunklen Seiten. Als Sohn griechischer Einwanderer 1957 geboren, ist er als echtes Kind der Arbeiterklasse aufgewachsen. Die gesamte Familie schuftete in der Billiggastronomie, und ab seinem zehnten Lebensjahr war auch George dabei. Bis zu seinem 32. Lebensjahr verdiente er sein Geld als Bauarbeiter, Barmann, Schuhverkäufer und in anderen Jobs, konnte aber nebenbei immerhin studieren.
1989 verwirklichte er sich seinen lang gehegten Traum und schrieb einen Roman, der zum ersten Teil einer Trilogie um den Privatdetektiv Nick Stefanos wurde. „A Firing Offense“ stellte gleichzeitig den Auftakt zu Pelecanos‘ ehrgeizigem Projekt dar, die Geschichte Washingtons im 20. Jahrhundert „von unten“ zu be-schreiben. Acht Romane umfasst es; alle sind zumindest locker miteinander verwoben, und gemeinsam bilden sie so etwas wie ein Sittenbild der Stadt und ihrer Bewohner. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen nach der Bedeutung von Herkunft und Freundschaft bzw. Solidarität. Wie weit kann oder muss sie gehen? Darf sie die Grenze zwischen „Gut“ und „Böse“ ignorieren? Für Pelecanos ist die Entscheidung klar, aber er verschleiert nie, dass der „richtige“ Weg dem, der ihn geht, erst recht ins Verderben führen kann.
Obwohl Pete Karras das Finale von „Das große Umlegen“ nicht überlebt, setzte Pelecanos die Trilogie fort. In [„King Suckerman“, 671 der in der Woche der Zweihundertjahrsfeiern 1976 spielt, tritt Karras‘ Sohn Dimitri an die Stelle des Vaters. „The Sweet Forever“, der abschließende Band, berichtet davon, wie er und sein Freund Marcus Clay im Jahre 1986 in einen Drogenkrieg verwickelt werden. Beide Romane spinnen nicht einfach die Vorgeschichte routiniert weiter, sondern gehen inhaltlich wie formal völlig eigene Wege – auch das ein Beleg dafür, dass der moderne Kriminalroman mit George P. Pelecanos eine ebenso kritische wie talentierte Stimme gefunden hat.
2001 begann Pelecanos mit einer neuen Reihe um den (schwarzen) Privatdetektiv Derek Strange und seinen Partner Terry Quinn. Sie spielt im Washington der Gegenwart und wirft kritische Blicke auf den Drogenkrieg im Schatten des Weißen Hauses. Außerdem beschäftigt sich der Verfasser gewohnt intensiv mit dem immer noch aktuellen Problem der Rassendiskriminierung. Hier gehen ihm, der sonst mit einer glasharten, klaren Prosa und mitreißenden Plots glänzt, indes manchmal die Pferde durch – Pelecanos hebt den Zeigefinger und predigt statt zu erzählen. Das ist freilich der einzige Vorwurf, den man ihm manchmal machen muss.
Hierzulande bleibt Pelecanos ein Geheimtipp. Das „verdankt“ er in erster Linie einer unglücklichen Veröffentlichungsgeschichte. Der Verlag, der seine Werke nach Deutschland brachte, ließ beim „Aufbau“ des noch fremden Autors die notwendige Kontinuität vermissen und stellte seine Thrillerreihe zudem bald ein. Mit der Strange/Quinn-Reihe wird nun ein neuer Anlauf genommen. Die älteren Titel bleiben allerdings weiter ohne Übersetzung.
Homepage von George Pelecanos: http://www.georgepelecanos.com.
White, Gillian – Peststein, Der
Scheinbar seit Anbeginn der Zeit stellt er das natürlich Zentrum des kleinen englischen Dörfleins Meadcombe dar: der Peststein, ein gewaltiger Megalith, fest und unverrückbar in der Erde verankert. Von den Touristen wird er bestaunt, von den Bürgern, die in seinem Schatten leben, eher gefürchtet. Schon immer galt der Peststein als Quelle übernatürlicher Kräfte. In vorchristlicher Zeit wurde er als Heiligtum verehrt, und selbst als die Missionare die alten Naturgeister vertrieben hatten, schlichen des Nachts die Menschen zum Stein, der angeblich die Macht hat, geheime Wünsche zu verwirklichen. Dass noch jede Person, die es versucht hat, ihren Weg bitter bereuen musste, ist hoch im rationalen 20. Jahrhundert in Vergessenheit geraten. Geblieben ist ein dumpfes Unbehagen – und manchmal der Wunsch, in auswegloser Lage den Peststein zu beschwören und darauf zu pfeifen, ob sich eine Gottheit oder der Teufel in seinem Inneren verborgen hält.
Tiefe Verzweiflung eint drei ansonsten sehr unterschiedliche Frauen, die in einer düsteren Oktobernacht die Macht des Steins versuchen. Marian Law hat gerade ihren geliebten Gatten bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren. Stattdessen blieb ihr die ungeliebte Schwiegermutter, die in den letzten Monaten zunehmend senil geworden ist und Marian das Leben zur Hölle macht. Die 14-jährige Melanie Tandy wünscht sich sehnlich, die Schule, ihre verhasste Familie und Meadcombe überhaupt verlassen zu können. Die verwöhnte Oberschicht-Lady Sonia Hanaford sieht sich vor einem Leben in Schande und Armut, weil die Galerie ihres nichtsnutzigen Ehemanns vor dem Bankrott steht.
Der Peststein hört, der Peststein hilft – stumm aber effektiv und auf seltsam krummen Pfaden. Als die drei Frauen am nächsten Morgen erwachen, ist Marians Schwiegermutter in der Nacht plötzlich verstorben, Melanie spurlos verschwunden, und Sonia hat einen Weg gefunden, dem reichen Schwiegervater ein Darlehen abzupressen. Erleichterung stellt sich ein, aber sie schwindet rasch, als sich herausstellt, dass jeder in Erfüllung gegangene Herzenswunsch eine Kette verhängnisvoller Reaktionen in Gang setzt, die sich unaufhaltsam zu einer finalen Katastrophe wahrlich apokalyptischen Ausmaßes aufschaukeln …
Nichts ist schlimmer als das Grauen, das der Mensch selbst heraufbeschwört. Sollte es tatsächlich Gespenster oder Dämonen in einer Twilight Zone irgendwo da draußen geben, müssten sie sich eigentlich neidvoll mit einer Zuschauerrolle begnügen, denn sie wären wohl kaum in der Lage, ihren Opfern so erfinderisch das Leben sauer zu machen wie dies unseren drei weiblichen Hauptpersonen im „Peststein“ ohne jenseitige Unterstützung gelingt.
Auch mit der Äußerung von Herzenswünschen sollte man vorsichtig sein: Sie könnten in Erfüllung gehen, ohne dass darüber Probleme und Sorgen verschwänden. Auch in unserem Fall wird deutlich, dass die eigentlichen Ursachen des Unglücks, über das die drei scheinbar braven Bürgerinnen Meadcombes klagen, wesentlich tiefer in der eigenen Vergangenheit wurzeln und buchstäblich hausgemacht sind. Folgerichtig bricht erst dann die Hölle auf, als sich das alltägliche Elend als Puffer auflöst: Dem reinen, unverschnittenen Grauen aus der eigenen Psyche sind die Frauen nicht gewachsen.
Der allmähliche Verfall wird von Gillian White meisterhaft geschildert. Geradezu genial muss man dabei den Einsatz des Peststeins nennen: Er ist einfach nur da, findet hin und wieder Erwähnung, greift nie aktiv in die Handlung ein, indem ihm etwa des Nachts finstere Dämonen als dienstbare Geister des Bösen entschlüpfen. Trotzdem legt sich sein Schatten über die gesamte Handlung, und der Leser vergisst ihn nie. Das ist auch gut so, denn das bemerkenswerte Finale stellt klar, dass der Peststein sehr wohl übernatürliche Kräfte besitzt. Jetzt erklären sich auch die Einschübe, in denen ein namenlos bleibender Gutachter die Geschichte des uralten Felsens aufrollt – er hat schon oft Unheil über die Bürger von Meadcombe gebracht, aber dabei stets jene Geduld an den Tag gelegt, die man einem Stein gern zubilligt. An der Schwelle zum 3. Jahrtausend sind seine Untaten wieder einmal in Vergessenheit geraten; das ist seine Chance, und er nutzt sie.
Dem Leser bleibt überlassen, ob er sich auf diese Auflösung der vertrackten Geschichte einlässt. Es stimmt schon, Marian, Melanie und Sonia brauchen den Peststein gar nicht, um sich ins Unglück zu stürzen. Der Plot würde auch ohne ihn funktionieren. Aber Gillian White hat sich nun einmal entschlossen, einen Psycho-Thriller mit phantastischen Elementen zu schreiben, und dabei leistet sie hervorragende Arbeit. Wenn es etwas wirklich zu kritisieren gilt, so ist es die inhaltliche Nähe zu ihren anderen Romanen. Hier sei besonders an „Veil of Darkness“ (1999, dt. [„Das Hotel bei den Klippen“, 876 Goldmann TB Nr. 44540) erinnert, der über weite Strecken wie ein literarisches Remake des „Peststeins“ anmutet, nur dass der Spuk dieses Mal außen vor bleibt. Menschen in der Krise zu schildern, die eine verlockende Abkürzung auf dem Weg aus dem Unglück entdecken, der sich als Highway in die Hölle entpuppt: Das ist offenbar Whites Passion oder Spezialität, die allerdings zu einer Masche zu gerinnen droht.
Gillian Whites Biografie weist gewisse Berührungspunkte zum Schicksal der jungen Melanie Tandy auf, die sich hier ebenso (un-)heimlich wie wirkungsvoll für erlittene oder eingebildete Schmähungen rächt. Zwar stand die Autorin nicht mit dem Teufel im Bunde, aber schon die beeindruckende Zahl der Schulen, die sie aufgrund fortwährender Verstöße gegen Regeln und Vorschriften verlassen musste, lässt deutlich werden, dass hier ein Freigeist im Kampf gegen das Establishment heranwuchs. Sobald es gesetzlich möglich war, machte sich White nach London auf, das damals ganz im Zeichen der „Swinging Sixties“ stand. Drei turbulente Jahre später heuerte sie bei einer Zeitung in Essex an und wurde (scheinbar) bürgerlich. Sie heiratete, setzte vier Kinder in die Welt und erwarb eine kleine Farm in Cornwall. Als die alte Schule ihres Heimatortes geschlossen wurde, rief White kurzerhand in ihrem Heim eine neue ins Leben. Das Projekt überlebte wider Erwarten bis auf den heutigen Tag. Quasi nebenbei begann Gillian White in den 80er Jahren zu schreiben. Mehr als ein Dutzend Romane hat die fleißige Autorin bisher verfasst, die in England Bestsellerstatus erreichten und von denen die BBC bisher vier verfilmt hat.
White, Gillian – Hotel bei den Klippen, Das
Drei junge Frauen haben genug von ihrem alten Leben – Kirsty von ihrem brutalen Ehemann, der ihr und ihren Kindern die Hölle auf Erden bereitet, Avril von ihrer tyrannischen Familie und Bernadette von ihrem Ex-Freund Dominic, der sie eiskalt abserviert hat. Sie ziehen – oder fliehen – für eine Saison nach Cornwall ins „Burleston“, ein einsames Hotel an der Meeresküste, um dort einen Neuanfang zu versuchen. Die drei Frauen schließen (scheinbar) Freundschaft, aber ansonsten ist der Alltag ernüchternd. Colonel Parker, der Hotelbesitzer, und Mrs. Stokes, seine Wirtschafterin, führen ein hartes Regiment, und die Arbeit ist hart und langweilig.
Eines Tages findet Kirsty in der Bibliothek ein altes Buch, das sich als wahres Zauberwerk erweist. „Magdalena“, geschrieben 1913 von einer Ellen Kirkwood, ist die (fiktive?) Biografie einer Frau in Bedrängnis, die ihr Leben entschlossen in die Hand nimmt, ihr Schicksal meistert und sich nicht scheut, dabei wenn nötig über Leichen zu gehen. Die drei Freundinnen berührt das Buch sehr. Darüber hinaus erkennen sie sein Bestseller-Potenzial. Nicht gerade mit besonderen Geistesgaben gesegnet beschließen sie, „Magdalena“, das offensichtlich nur als Privatdruck in kaum erwähnenswerter Auflagenhöhe erschienen ist, als ihr Werk auszugeben und zu veröffentlichen, um auf diese Weise ein wenig Geld aus ihrem Fund zu schlagen. Damit setzen sie eine verhängnisvolle Folge unvorhergesehener Ereignisse in Gang. Das Manuskript gerät in die Hände der egozentrischen und ehrgeizigen Lektorin Candice Love, die schon lange ein Buchprojekt sucht, das ihrer dahindümpelnden Karriere den ersehnten Schub verschaffen kann. Love will „Magdalena“ groß herausbringen – und zwar weltweit!
Das literarische Meisterwerk einer bisher völlig unbekannten Autorin schlägt ein wie eine Bombe – und stellt seine „Schöpferinnen“ vor gewaltige Probleme: Wie sollen sie, die ihre Autorenschaft nur spielen, vor der Presse und vor der Literaturkritik bestehen, wie die vom Verlag geforderten Änderungen und Korrekturen ausführen? Bernadette, die von ihren Freundinnen als „Strohfrau“ vorgeschickt wird, ist ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie hält die zunehmend ungeduldige und misstrauisch werdende Candice Love ungeschickt hin, verstrickt sich in Widersprüche und verliebt sich zudem noch in den charismatischen Leiter des Verlags, der indes in der jungen Frau nur eine Starautorin sieht, die zuvorkommend behandelt werden sollte.
Kirsty treiben andere Sorgen um. Der Ruhm käme ihr nicht zupass, muss sie doch fürchten, die unerwünschte Aufmerksamkeit ihres Noch-Gatten Trevor zu erregen. Dieser ist tatsächlich eifrig damit beschäftigt, Kirstys Spur zu verfolgen, und träumt bereits davon, ihr eine „Lektion“ zu erteilen, die sie mindestens ins Krankenhaus bringen dürfte. So hält sich Kirsty im Hintergrund und schrubbt weiter Toiletten im „Burleston“, während Avril und Bernadette es sich in der Prominentensuite gut ergehen lassen. Will man sie etwa ausbooten? Kirsty wird argwöhnisch, fühlt sich hingehalten, während das ersehnte große Geld auf sich warten lässt.
Avril entwickelt psychotische Züge. Sie hat sich auf eine Affäre mit dem windigen Edward Board, dem Golflehrer des „Burleston“ eingelassen, der die Gefühle der unerfahrenen Frau ausnutzt und auf sein Stück vom Kuchen hofft. Die verhassten Eltern suchen sie im „Burleston“ auf, um die Kontrolle über ihre Tochter zurückzugewinnen. Dank der stetigen Präsenz in der Presse lässt auch Avrils krimineller Bruder Graham nicht lange auf sich warten. Gerade aus dem Gefängnis entlassen, hat er bei einem missglückten Raubüberfall eine alte Frau umgebracht. Nun befindet er sich auf der Flucht und braucht Geld. Vor der großen Präsentation von „Magdalena“ ist dies nicht die Publicity, die verlagsseitig gewünscht ist. Schlimmer noch: Trevor ist kaum in Cornwall eingetroffen, da taucht Boards Leiche mit eingeschlagenem Schädel auf dem Hotelgelände auf. Die Polizei glaubt nicht an einen Zufall und nimmt Avril in die Zange, nachdem Trevor gefasst wurde und prompt seine Schwester als Alibi angegeben hat …
An dieser Stelle soll es genug sein mit der Inhaltsangabe. Wer aber glaubt, der Rezensent hätte bereits viel zu viel verraten, sei eines Besseren belehrt: Die oben geschilderten Ereignissen stellen höchstens so etwas wie eine Ouvertüre zu dem dar, was sich auf dem Weg zum großen Finale (plus einem unerwarteten Schlussgag) noch ereignen wird! Denn was nach einem Blick auf den Klappentext zunächst einen pseudo-unheimlichen, gefühlsduselig-schwülstigen „Frau in Gefahr“-Thriller à la Mary Higgins Clark befürchten lässt, entpuppt sich als zunehmend vertrackter Psycho-Grusler, der geschickt die Klaviatur menschlicher (Ur-)Ängste zu bedienen weiß und nach einem trügerisch hausbackenen Start in der zweiten Hälfte ständig an Tempo (und Gemeinheit) zulegt. Natürlich wird mit der Konstellation treuloser/prügelnder/gefühlloser etc. Mann (= „das Monster“) gegen schwache, aber entschlossene Frau/en das literarische Rad nicht gerade neu erfunden, doch verlässlich in Schwung gebracht und gehalten. Besonders im zweiten Teil schlägt die Handlung immer neue Haken. Die Ereignisse überschlagen sich, ohne dass die Logik darunter leidet. Stattdessen bewahrheit sich die alte (Binsen-)Weisheit, dass ein Geist schwer wieder eingefangen werden kann, ist er erst einmal seiner Flasche entwischt. Die Schlag/Gegenschlag-Dramaturgie von „Das Hotel bei den Klippen“ beschwört das Bild einer Reihe hintereinander aufgestellter Dominosteine herauf; kippt der erste, kommen auch alle übrigen unerbittlich zu Fall.
Die Charakterisierung der Protagonisten (von „Helden“ kann man hier wahrlich nicht sprechen!) ist hart, aber gerecht. Drei vom Leben betrogene Frauen haschen nach ihrem Zipfel der Wurst und versuchen es dabei mit einer Abkürzung. Das geht fürchterlich schief, wobei die Autorin erfreulicherweise nie ins Moralisieren gerät; im Gegenteil: Für Kirsty, Bernadette und Avril lässt sich schwer echte Sympathie entwickeln. Aber auch die (selbst-)gerechte Strafe bleibt aus; für das, was es anrichtet, kommt das Trio zwar gerupft, aber mit verhältnismäßig heiler Haut (besonders Kirsty dürfte dem zustimmen) davon.
Die deutsche Ausgabe von „Das Hotel bei den Klippen“ gibt zu keinen Klagen Anlass. Was sich der Verlag allerdings bei der Wahl des Titels gedacht hat, bleibt wieder einmal rätselhaft. Das „Burleston“ steht zwar einsam auf seiner Klippe, ist aber höchstens ein düsteres, keinesfalls aber ein unheimliches Haus. Der Roman „Magdalena“ ist ein ganz normales Buch, in dessen Seiten nicht der Teufel nistet, und die böse Ellen Kirkwood spukt ebenfalls nicht als Geist umher, wie der (absichtlich?) missverständliche Klappentext andeutet. Das ist schade, denn wer sich dadurch abgeschreckt fühlt, wird eines echten Lesevergnügens beraubt. Der „Schleier der Dunkelheit“, von dem der Originaltitel zutreffender spricht, bedeckt die endlosen Übeltaten der weiblichen wie männlichen Protagonisten dieses Romans, dem es gelingt, in Sachen absichtlicher wie beiläufiger Bosheit ganz neue Dimensionen zu erschließen!