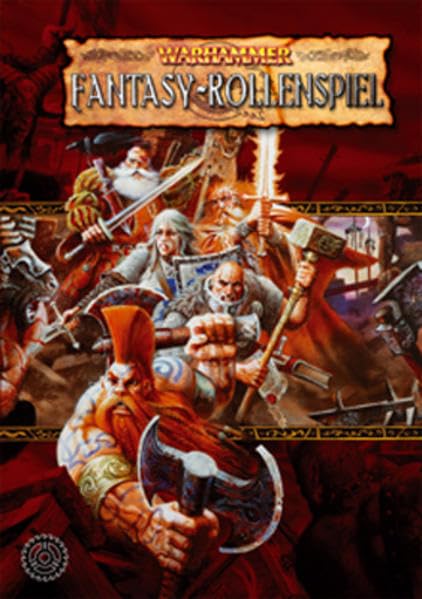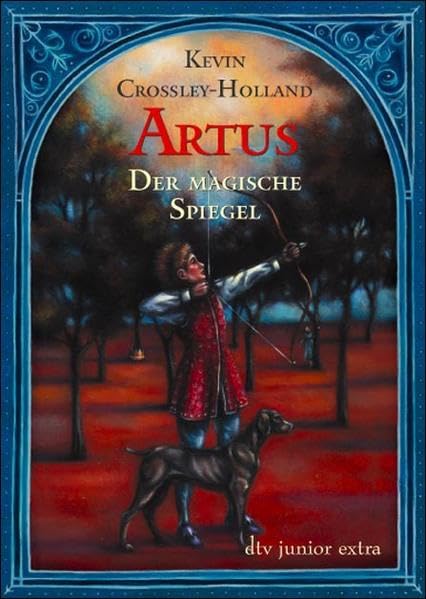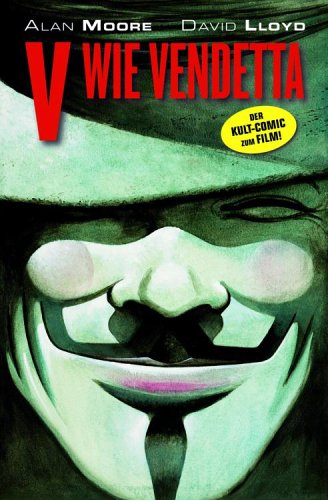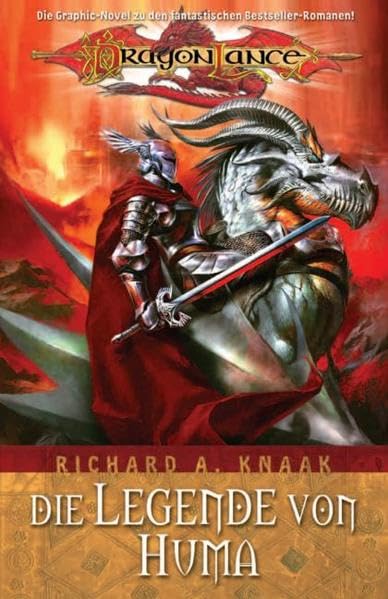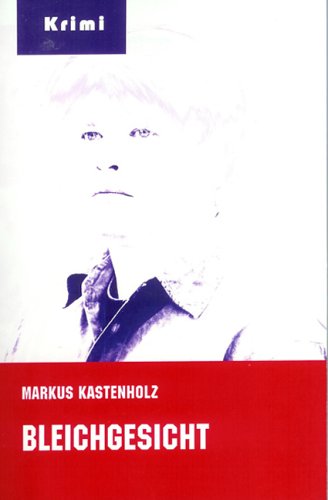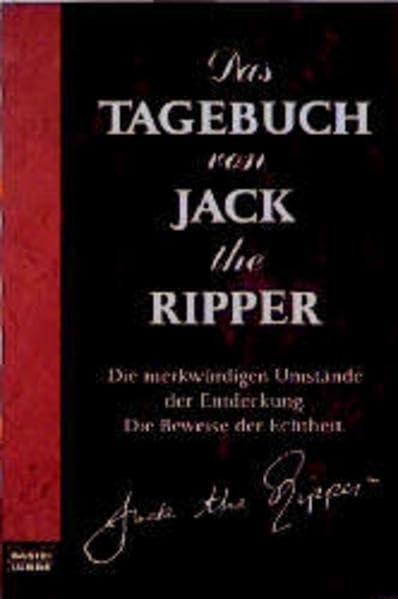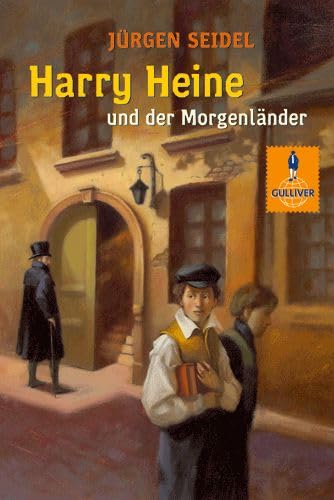_Die „Warhammer“-Welt_
Das „Warhammer Fantasy-Rollenspiel“ spielt in der so genannten „Alten Welt“, die geographisch grob an das irdische Europa erinnert. Das Hauptland dieses Settings ist das „Imperium“, welches aus zehn Kurfürstentümern besteht. Weitere Länder, die in diesem Grundregelwerk kurz beschrieben werden, sind Bretonia, Estalia, Tilea und Kislev. Allerdings wird davon ausgegangen, dass man zu Beginn einen Charakter aus dem Imperium spielt (obwohl es durchaus möglich ist, einen Ausländer zu spielen).
Das Imperium wird ständig von den Horden des Chaos bedroht, welche aus Tiermenschen, Kultisten des Chaos, Orks, Goblins und anderem Schrecken bestehen. Diese von den Chaosgöttern Geschaffenen oder Pervertierten wollen nichts anderes als die Menschheit (respektive Zwergen, Elfen, Halblinge) zu vernichten. Natürlich gibt es außerdem noch „normale“ Schurken, doch könnten das auch durchaus die Spieler sein.
Von der Entwicklung her ist das Imperium als eine Mischung aus Mittelalter und früher Neuzeit zu beschreiben. Zwar gibt es schon Schusswaffen, doch sind diese selten und vor allem teuer. Die politische Ordnung, in der die Kurfürsten den Imperator wählen, ist in etwa mit der im Deutschland der Frühen Neuzeit zu vergleichen.
An spielbaren Rassen bevölkern, neben den Menschen, Zwerge, Elfen und Halblinge die „Alte Welt“. Natürlich gibt es im „Warhammer Fantasy-Rollenspiel auch Magier, doch ist die Magie in diesem System ein zweischneidiges Schwert, denn sie ist nicht nur gefährlich (auch für den Anwender), sondern treibt die Zaubernden leider allzu oft in die Arme der Chaosgötter.
_Charaktererschaffung und System_
Zuerst steht bei der Charaktererschaffung die Auswahl der Rassen an, also Mensch, Halbling, Zwerg oder Elf. Jede dieser Rassen hat bestimmte Rassenmerkmale. So haben etwa Elfen, Zwerge und Halblinge Nachtsicht, Menschen nicht. Um dem Charakter anschließend etwas Fleisch auf die Knochen zu bringen, werden nun die Eigenschaftswerte bestimmt. Diese setzen sich immer aus einer Standardzahl und zwei Würfelwürfen mit einem zehnseitigen Würfel (W10) zusammen, da wären also etwa 10+2W10 / 20+2W10 / 30+2W10. Wie hoch die Standardzahl ist, hängt von der Rasse ab, so dass sich Halblinge etwa bei Kampfgeschick mit 10+2W10 begnügen müssen, während Zwerge mit 30+2W10 starten.
Insgesamt gibt es zehn Eigenschaften: Kampfgeschick (KG), Ballistische Fertigkeit (BF), Stärke (ST), Widerstand (WI), Gewandtheit (GE), Intelligenz (IN), Willenskraft (WK) und Charisma (CH).
Um dem neuen „Warhammer“-Helden dann ein Gesicht zu geben, wird auf die Tabelle der Anfangskarrieren gewürfelt. Auch hier hängen die möglichen Karrieren von der Rasse ab, so dass etwa die Klasse des „Trollslayers“ nur Zwergen vorbehalten ist. Die Karriere bestimmt dann, welche Fertigkeiten und Talente der neue Charakter erhält. Außerdem wird so auch bestimmt, welche Folgekarieren in Zukunft möglich sind. So kann man etwa als Zauberlehrling beginnen und dann später zu einem Fahrenden Magier aufsteigen. Von diesem kann man dann zum Meistermagier werden, und so weiter.
Die Proben werden mit 2W10, also einem Prozent-Wurf abgelegt. Dieser geht dann entweder direkt auf eine Eigenschaft oder eine passende Fertigkeit. Da aber wiederum die Fertigkeiten alle einer Eigenschaft zugeteilt sind, werden eigentlich alle Proben auf die Eigenschaften abgelegt. Der Unterschied zwischen den Proben auf Eigenschaften und denen auf Fertigkeiten besteht darin, dass man, falls man eine Fertigkeit noch nicht erworben hat, auf den halben Eigenschaftswert würfeln muss.
_Mein Eindruck_
„Warhammer“ ist das abgefahrenste Fantasy-Rollenspiel, das mir bisher untergekommen ist. Die Stimmung ist düster, wahnsinnig und gewalttätig. Hübsche Feen, die durch einen von Rosenduft geschwängerten Wald schweben, passen definitiv nicht zum „Warhammer Fantasy-Rollenspiel“. Wer sich die Charakterklassen wie Trollslayer, Riesenslayer, Dämonenslayer, Grabräuber oder Räuberhauptmann anschaut, kann sich sicher denken, was ich meine. Man kann den klassischen Helden spielen, man muss aber nicht.
Genauso ist auch das Kampfsystem: schnell, blutig und vor allem tödlich. Besonders gut kommt der Flair bei den Zeichnungen des toll aufgemachten Grundregelwerkes rüber, denn strahlende Ritter in blitzender Rüstung wird man hier eher nicht finden. Das „Warhammer“-Äquivalent dazu ist ein schmutziger, abgehalfterter Kämpe mit wahnsinnigem Blick. Wo wir gerade beim Wahnsinn sind: Jeder Charakter sammelt bei schweren Verletzungen oder schlimmen Erlebnissen so genannte Wahnsinnspunkte. Hat er hier eine bestimmte Grenze überschritten, kann es sein, dass er sich eine Geisteskrankheit zuzieht.
Auch die Magie ist nicht so wie in anderen Rollenspielen. Sie ist zwar durchaus mächtig, aber auch für den Anwender extrem gefährlich. Die magisch begabten Heldentypen fangen zu Beginn mit einem Magiewert von eins an, das heißt sie Würfeln beim Zaubern mit 1W10. Falls die Mehrzahl der Würfel eine Eins zeigt, ist der Zauber nicht nur misslungen, sondern der Charakter zieht sich zudem noch einen Wahnsinnspunkt zu. So ist es nicht verwunderlich, dass bei einer zehnprozentigen Chance pro Zauber, einen Wahnsinnspunkt zu erhalten, viele Magier relativ früh dem Chaos verfallen. Allerdings wird es mit zunehmender Stufe auch nicht besser, denn dann kann die Magier zusätzlich noch Tzeentchs Fluch treffen: Jedes Mal, wenn der Magier bei einem Zauberwurf einen Pasch würfelt, kommt es zu Chaosmanifestationen. Je mehr Würfel an dem Pasch beteiligt sind, desto schlimmer fallen diese aus. Da ist es doch nur ein schwacher Trost, dass ein Magier so oft wie er nur möchte zaubern kann.
So ansprechend ich das „Warhammer Fantasy Rollenspiel“ auch finde, Schwächen hat es trotzdem. Fangen wir bei der Fertigkeiten an: Dass eine Fertigkeit einer Eigenschaft zugeordnet ist, ist unglücklich. Dies ist gut sichtbar, wenn man sich die Fertigkeit „Klettern“ anschaut: Hier wird ein Wurf auf Stärke abgelegt. Wäre hier die Gewandtheit nicht die sinnvollere Alternative gewesen? Worauf ich hinauswill ist, dass solche Einteilungen immer ein fauler Kompromiss sind, ob jetzt bei diesem Rollenspiel oder bei so vielen anderen.
Richtig schlecht finde ich die Vorschrift, dass man nur in eine Folgekarriere wechseln kann, wenn man sich die vorgegebene Ausrüstung beschafft hat. Die Regel scheint zwar durchaus logisch zu sein, wird allerdings von den vorgegebenen Ausrüstungslisten ad absurdum geführt. So muss ich mir, wenn ich einen Spion spielen möchte, vorher vier Brieftauben kaufen (nicht drei, nicht fünf, nein vier an der Zahl!), sonst ist es mir nach den Regeln nicht gestattet, diese Karriere zu beginnen. Dies fördert eine Stereotypenbildung, zumal es echt blöd ist, wenn dann während des Spiels Sätze kommen wie: „Vorsicht, der hat vier Brieftauben, das ist sicher ein Spion!“. Sorry, diese Voraussetzungen sind einfach lächerlich!
Allerdings möchte ich betonen, dass diese Regelschwächen von jedem durchschnittlich begabten Spielleiter mit Hausregeln einfach behoben werden können und daher nicht wirklich schlimm sind.
_Fazit_
Alles in allem ist das „Warhammer Fantasy-Rollenspiel“ durchaus sehr gelungen und eine willkommene Alternative zu den klassischen Fantasy-Rollenspielen wie „DSA“ oder „Midgard“. „Warhammer“ hat einfach ein cooles Flair und ist richtig abgefahren. Zudem sind die Regeln einfach und verständlich und daher sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler geeignet. Als Tipp: Schaut euch einfach mal die Bilder im Regelwerk an, ob euch der Stil gefällt. Daraus lässt sich gut auf die Gesamtstimmung des „Warhammer Fantasy-Rollenspiels“ schließen.
http://www.feder-und-schwert.com