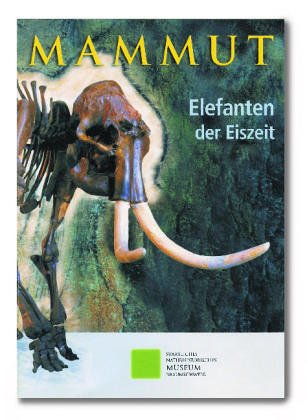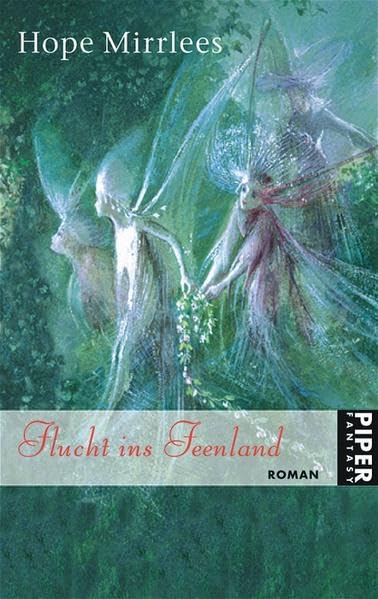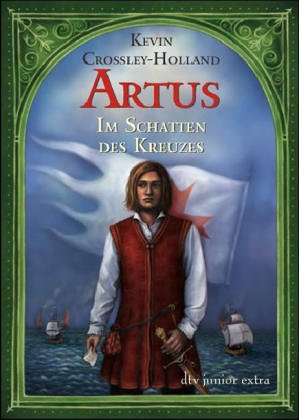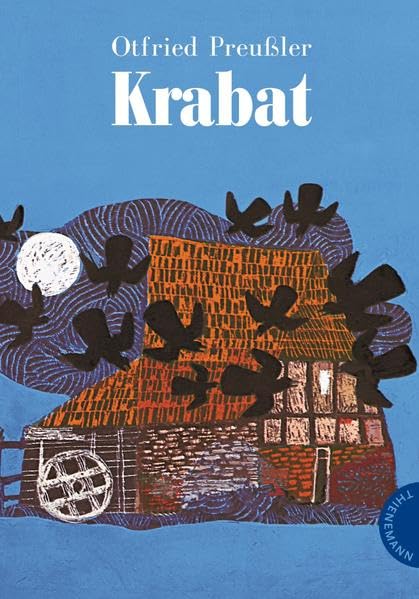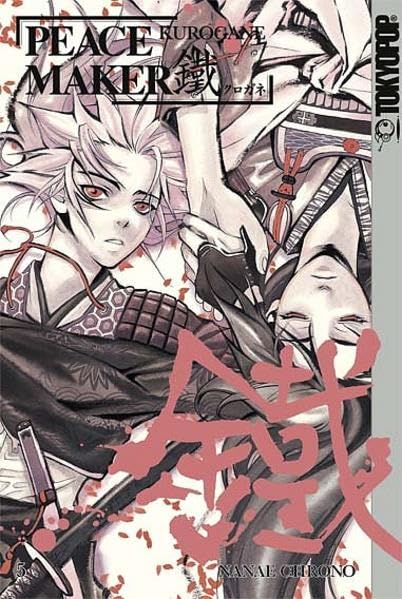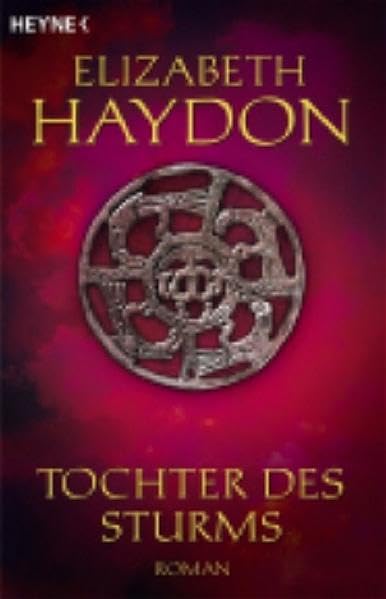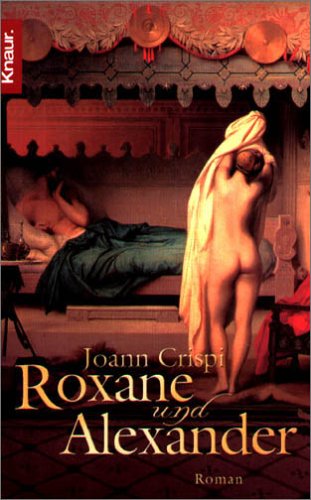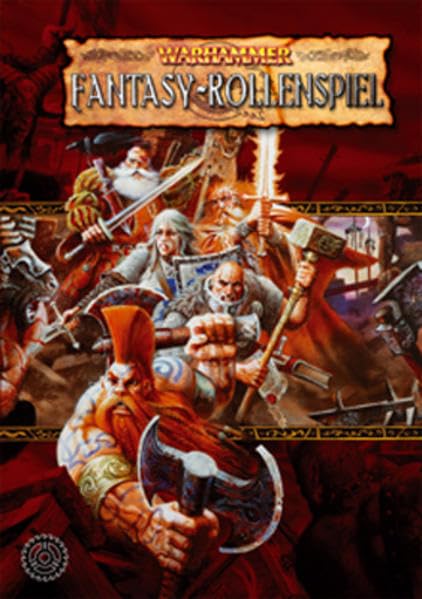Ernest de Lorca ist wie ausgewechselt; er glaubt erfahren zu haben, dass seine Frau Lucille, mit der er jahrelang glücklich verheiratet war, ihn aus unerfindlichen Gründen umbringen möchte. Um ihr zuvorzukommen, schleicht er sich eines Nachts an sie heran und bedroht sie mit einer Waffe. Lucille hingegen streitet entsetzt alles ab und bekommt auf den ersten Schock Hilfe von ihrer Tochter Damona. Wenige Sekunden später bekommt Ernest zu spüren, dass seine Vermutung richtig war …
Kurze Zeit später wird auch der Cousin von Polizeichef Powell tot aufgefunden; er kam bei einem seltsamen Verkehrsunfall ums Leben, in den anscheinend seine Frau involviert war. Einen Tag vorher konnte er Powell noch darüber informieren, dass seine Frau der mysteriösen Damona-Sekte beigetreten ist und sich seitdem völlig verändert habe.
Sir Powell, gleichermaßen Vorgesetzter von John Sinclair, setzt zwei seiner besten Leute auf den Fall an. Neben Sinclair stellt auch dessen Kollegin Jane Collins erste Ermittlungen an und bekommt kurze Zeit später den Auftrag, die erste Spur näher zu ergründen und sich bei der Sekte einzuschleusen. Als ihr dies zu ihrer eigenen Überraschung sehr schnell gelingt, stellt sie jedoch fest, dass sie der telekinetischen Kraft Damonas nicht gewachsen ist. Hypnotisiert von ihrer Aura lässt sie sich von der Führerin des neuen Kults komplett vereinnahmen, muss aber zum endgültigen Einstieg erst noch eine Reifeprüfung ablegen. Und in der geht es darum, sich einer ganz bestimmten Person zu entledigen: John Sinclair!
_Meine Meinung_
„Damona, Dienerin des Satans“ ist ganz klar eine der stärksten bisher gehörten Sinclair-Folgen, selbst wenn die Hintergründe nicht wirklich neu sind und Jason Dark auch wieder reichlich mit Klischees gearbeitet hat. Namen wie Lucille und Damona sprechen schließlich für sich. Doch ehrlich gesagt, ist mir dies im hier besprochenen Beispiel eigentlich nur recht, denn von den beiden erwähnten Personen wird tatsächlich das echte Böse verkörpert, kompromisslos und infernalisch, und da passen diese Namen wie die Faust aufs Auge.
Doch ich möchte hier nicht über Namen, sondern vielmehr über eine erneut superb aufgebaute Story sprechen, in der die bekannten Sprecher mal wieder eine phänomenale Leistung abgeben. Diesmal sehr stark: Franziska Pigulla (besser bekannt als Synchronstimme von „Akte X“-Agentin Dana Scully) in der Rolle der Jane Collins, die vor allem nach der dämonischen Beschwörung durch Damona de Lorca auftrumpfen kann. Ihre Wandlung hin zum Sektenkult kauft man ihr sofort ab, und überhaupt scheint ihr die Rolle des kurzzeitigen Gegners sehr gut zu liegen.
Jane Collins‘ Entwicklung sagt auch sehr viel über die stetige Wandlung des Plots aus. Bereits am Anfang vermutet man im besessenen Ernest de Lorca den wahren Schurken, doch man hat sich offensichtlich getäuscht und von den widrigen Umständen verwirren lassen. Später dann ist die Rolle der Agentin Collins ungewiss. Ist sie tatsächlich der Sekte verfallen oder spielt sie nur? Außerdem stellt sich während der gesamten Erzählung die Frage, welchen Part Damonas Schwester Teresa nun einnimmt. Bei ihrer Rückkehr erwischt sie ihre verbliebene Familie beim Begraben ihres Vaters und wird anschließend gezwungen, der Frauenpower-Sekte ebenfalls beizutreten. Dies tut sie nicht mit Überzeugung, aber sie steigt ein und wird schließlich zu einer entscheidenden Figur für das Finale.
Während im Vordergrund die Geschichte um Damona und ihre Widersacher steht, erfährt der Hörer gleichzeitig einiges über die Hintergründe und Ideale der Sekte. Bloß für die Macht des weiblichen Geschlechts einzutreten, scheint bei den Handlungsabläufen ein bisschen wenig zu sein, um die bösartige Motivation der de-Lorca-Familie zu rechtfertigen. Es muss mehr dahinterstecken, aber was? Dies alles gilt es im Laufe der knappen Stunde, die „Damona, Dienerin des Satans“ andauert, zu ergründen.
Die vierte Hörspiel-Episode ist gleichzeitig auch das vierte Heftabenteuer um den Geisterjäger und erschien im Original bereits im Jahre 1978. Staub angesetzt hat die Handlung seitdem nicht, wobei man schon sagen muss, dass die erzählte CD-Fassung merklich von den vielen tollen Soundeffekten profitiert, die die Spannung immer wieder ordentlich vorantreiben, dabei aber nicht von der Geschichte ablenken. Und so gibt es schließlich auch in „Damona, Dienerin des Satans“ allerbeste Unterhaltung auf typisch hohem Sinclair-Niveau, und dies einmal mehr mit exzellenten Sprechern. Fans werden das Teil wahrscheinlich schon besitzen, alle anderen sollten die vierte Folge dringend antesten!
Mehr Infos zu dieser Episode gibt’s [hier.]http://www.sinclairhoerspiele.de/hoerspiele.php?hsp=4
_|Geisterjäger John Sinclair| auf |Buchwurm.info|:_
[„Der Anfang“ 1818 (Die Nacht des Hexers: SE01)
[„Der Pfähler“ 2019 (SE02)
[„John Sinclair – Die Comedy“ 3564
[„Im Nachtclub der Vampire“ 2078 (Folge 1)
[„Die Totenkopf-Insel“ 2048 (Folge 2)
[„Achterbahn ins Jenseits“ 2155 (Folge 3)
[„Damona, Dienerin des Satans“ 2460 (Folge 4)
[„Der Mörder mit dem Januskopf“ 2471 (Folge 5)
[„Schach mit dem Dämon“ 2534 (Folge 6)
[„Die Eisvampire“ 2108 (Folge 33)
[„Mr. Mondos Monster“ 2154 (Folge 34, Teil 1)
[„Königin der Wölfe“ 2953 (Folge 35, Teil 2)
[„Der Todesnebel“ 2858 (Folge 36)
[„Dr. Tods Horror-Insel“ 4000 (Folge 37)
[„Im Land des Vampirs“ 4021 (Folge 38)
[„Schreie in der Horror-Gruft“ 4435 (Folge 39)
[„Mein Todesurteil“ 4455 (Folge 40)
[„Die Schöne aus dem Totenreich“ 4516 (Folge 41)
[„Blutiger Halloween“ 4478 (Folge 42)
[„Ich flog in die Todeswolke“ 5008 (Folge 43)
[„Das Elixier des Teufels“ 5092 (Folge 44)
[„Die Teufelsuhr“ 5187 (Folge 45)
[„Myxins Entführung“ 5234 (Folge 46)
[„Die Rückkehr des schwarzen Tods“ 3473 (Buch)