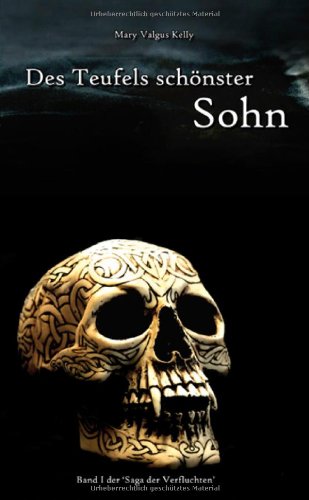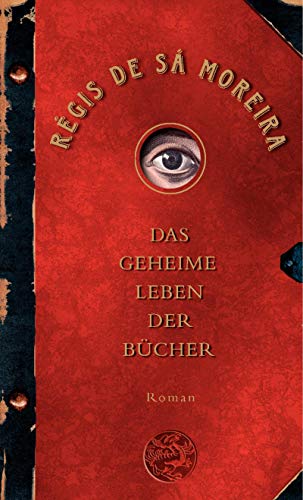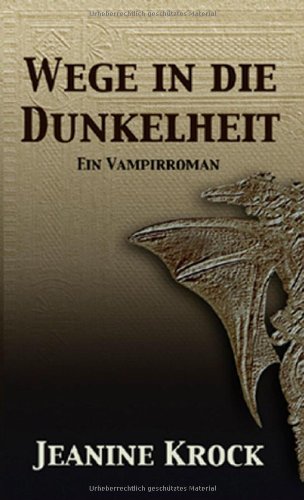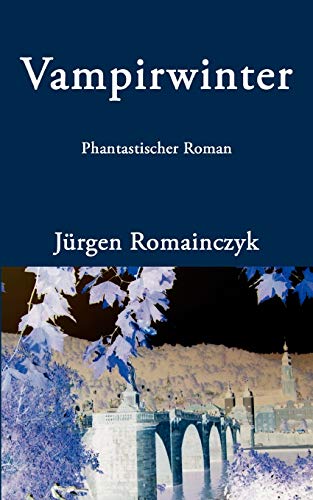Ares ist ein Vampir, vergnügungssüchtig und leichtlebig. Und doch packt ihn wohl der Schwermut, als er spontan beschließt, dass er einen Gefährten braucht. Kurzentschlossen verbeißt er sich in den schönen Domenico und macht ihn ebenfalls zum Untoten. Doch die beiden sind schlicht zu unterschiedlich und können weder miteinander, noch ohneeinander leben. Während Ares sich nämlich die Frauen haufenweise ins Bett holt (und sie erst vernascht und dann „vernascht“), sitzt Domenico in Bäumen und sinnt über das Leben nach. Schließlich stößt auch noch Flora zu den ungewöhnlichen Gefährten und das Gleichgewicht kippt endgültig.
Klingt bekannt? Durchaus, denn für Mary Valgus Kellys Roman „Des Teufels schönster Sohn“ (der erste Teil einer Trilogie) haben Anne Rices Vampire Pate gestanden. Wollte man bissig sein, könnte man gar behaupten, bei Kellys Roman handele es sich um ein [„Interview mit einem Vampir“ 68 für Arme. Und da sich Anne Rices Romandebüt nicht verbessern lässt, muss Kelly mit ihrem Projekt schlicht scheitern.
„Des Teufels schönster Sohn“ ist ein Buch, das so viele Fehler und Ungereimtheiten aufweist, dass man gar nicht weiß, wo anfangen. Schon die Handlung kurz anzureißen, stellt sich problematisch dar, denn eigentlich passiert in dem 144-Seiten starken Buch nicht wirklich etwas: Ares beißt Domenico, Domenico sieht gut aus (das wird dem Leser wiederholt in blumigen Worten versichert) und macht eine Leidensmiene. Dann wendet sich Ares Flora zu, kann ihr aber nicht treu sein. Es gibt eine Art Vampirsabbat mit Hexen und Werwölfen. Zwischendurch philosophiert Domenico auch mal mit einem Geist oder schäkert mit einer mysteriösen Vampirin namens Michelle. Domenico verlässt Ares und die Handlung springt nach Transsilvanien auf eine mittelalterliche Burg (!), wo sich die eingeladenen Vampire ihren Mitternachtssnack aufs Zimmer bringen lassen. Zum Glück ist der Roman dann auch schon zu Ende.
Kellys größtes Problem (mal abgesehen von der nicht existenten Handlung) sind ihre Charaktere. „Des Teufels schönster Sohn“ schafft es, ein Roman völlig ohne Motive zu sein, was dazu führt, dass die Charaktere schemenhaft bleiben. Warum zum Beispiel braucht Ares plötzlich einen Gefährten? Sehnt er sich nach menschlicher Nähe? Oder ist ihm doch nur fad? Genauso unklar bleibt Ares’ Charakter: Zu Anfang ist er der Gegenpol zu Domenico – schillernd und auf der Suche nach dem Thrill. Er lebt in die Nacht hinein und sucht nach Vergnügungen. Doch gegen Ende brütet er plötzlich vor sich hin, ohne dass dem Leser klar wäre, wieso. Gespaltene Persönlichkeit? Oder doch nur die Wankelmütigkeit der Autorin? Dieses Problem der charakterlichen Unentschlossenheit haben alle von Kellys Figuren. Dem Leser ist es dadurch unmöglich, die Charaktere irgendwie zu fassen zu bekommen oder sich gar mit ihnen zu identifizieren.
Worin besteht überhaupt das Gefährtentum, von dem in dem Roman immer wieder die Rede ist? Kelly will uns scheinbar weismachen, dass es da ein erotisches Prickeln zwischen den beiden Vampiren gibt. Nur versickert dieses Prickeln zwischen den Zeilen, da Ares und Domenico weder wirklich miteinander leben noch sprechen. Die beiden haben im Roman eigentlich kaum Berührungspunkte. Darüber hinaus schleppt Ares unzählige Frauen ab und es ist nicht so recht zu erkennen, wie dieses Balzgebahren mit einer zarten Seele in Verbindung zu bringen wäre.
Doch ach! Vielleicht hat Ares doch ein Herz? Unverhofft taucht nämlich Flora auf, Ares’ Immer-mal-wieder-Geliebte seit 14 Jahren (wobei dem Leser auch diese Geschichte vorenthalten wird – woher die beiden sich kennen, wird nie klar). Nie wollte sie ein Vampir werden und mittlerweile hat sie Mann und Kinder. Und auch als er sie nun wieder ausfindig macht, haben sie zwar einen Quickie auf der Terasse, untot werden will sie aber nicht. Bis sie ein paar Seiten später vor Ares’ Tür steht mit der Bitte um Vampirisierung. Wo die Gründe für diesen Sinneswandel liegen, scheint Kelly nicht ergründen zu wollen. Auch wird keine Tinte auf die Frage verwendet, was nun aus ihren Kindern wird und ob sie diese nicht vielleicht wenigstens ein ganz kleines bisschen vermisst. Nein, zwischen all den unausgegorenen Charakteren in „Des Teufels schönster Sohn“ ist Flora der unausgefeilteste. Sie bereichtert die Handlung nicht und gibt ihr auch keinen (anderen) Sinn. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sie später sang- und klanglos wieder aus dem Roman verschwindet.
Vierzig Seiten vor Schluss wechselt das Setting vom ursprünglichen Handlungsort (wo das ist, wird ebenfalls nie geklärt) ausgerechnet nach Transsilvanien, wo eine gewisse Clarissa eine Art Wellnesshotel für Vampire auf einer mittelalterlichen Burg eingerichtet hat. Als Untoter sitzt man also rum, sieht gut aus und lässt sich das Essen aufs Zimmer bringen. Wenn man besonders standesgemäß sein will, reist man in einer Kutsche an (wohlgemerkt, der Roman spielt in der Gegenwart) und betitelt sich gegenseitig als Baron. Dass Vampire unter Umständen ein wenig abgehoben sind, ist ja nicht neu. Aber so snobistisch? Das ist dann doch etwas übertrieben …
Mein Eindruck
Man muss Kelly zugute halten, dass ihre Prosa sich hier leicht verbessert und sie es eher schafft, bei ihrem Plot zu bleiben. Doch die Handlung selbst lässt gerade dem weiblichen Leser die Haare zu Berge stehen. Ares, von allen guten Geistern (d. h. Domenico und Flora) verlassen, hat sich drei Vampirbräute angeschafft, die nun alle seine Wünsche erfüllen. Mit einem anderen Vampir diskutiert Ares daraufhin die Erziehung solcher „Mädchen“, als spräche er über Hundezucht. Zu allem Überfluss haben die „Mädchen“ gegen diese degradierende Haltung überhaupt nichts einzuwenden: „Ohne ihn wären wir verloren“, sagen sie. „Er kümmert sich um uns und liest uns unsere Wünsche von den Augen ab. Er schenkt uns Kleider, Schmuck, sorgt für das Essen … er tut einfach alles für uns! Im Gegenzug dafür dürfen wir ihn lieben und unterhalten ihn ein bisschen.“ Der Höhepunkt ist jedoch Bredas Aussage, dass doch in jeder Frau eine Hure stecke. Diese Aussagen zu kommentieren, ist wohl überflüssig.
Unterm Strich
Um es kurz zu machen: „Des Teufels schönster Sohn“ hat weder eine fesselnde Handlung noch überzeugende Charaktere. Dafür strotzt das Buch vor schiefen Wendungen wie „Domenico rang mit den Armen, nach Atem und nach Worten“ oder „der Einzige, der sprach, war der Rauch seiner Zigarette, der wütend versuchte gegen den Regen anzukämpfen“. Der Roman ist eine einzige Masse wabernder Unstimmigkeiten, erzeugt durch das angestrengte „wollen, doch nicht können“ der Autorin. Eine wirklich mühsame, jedoch überhaupt nicht unterhaltende Lektüre.
Taschenbuch: 144 Seiten
ISBN-13: 978-3937536651
http://www.ubooks.de/