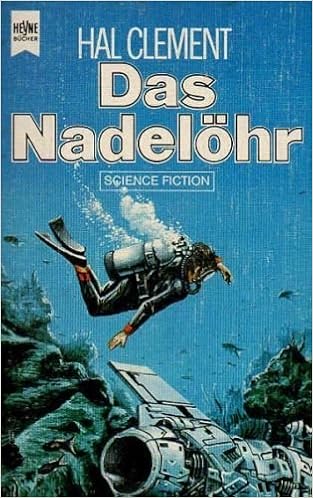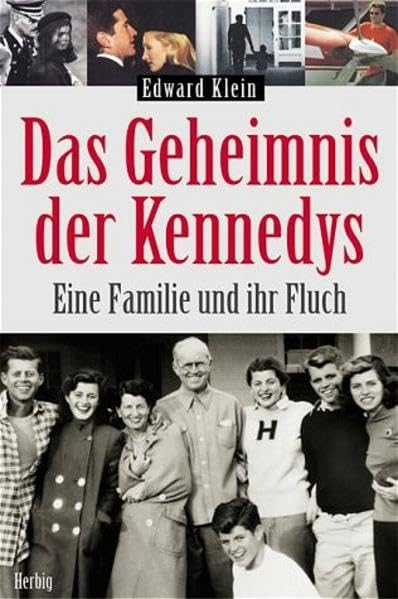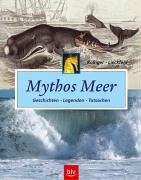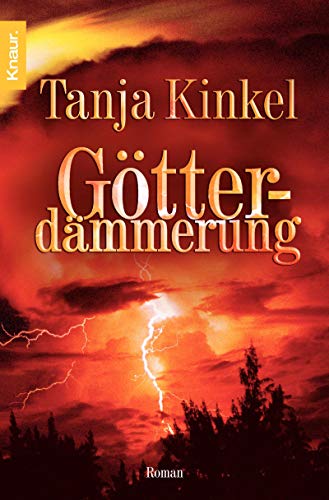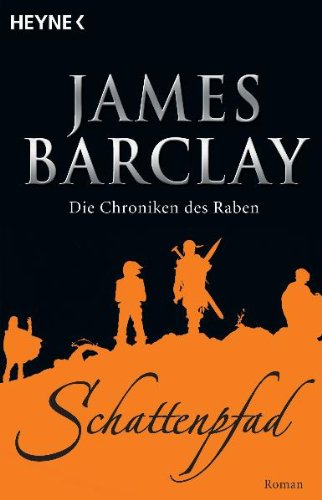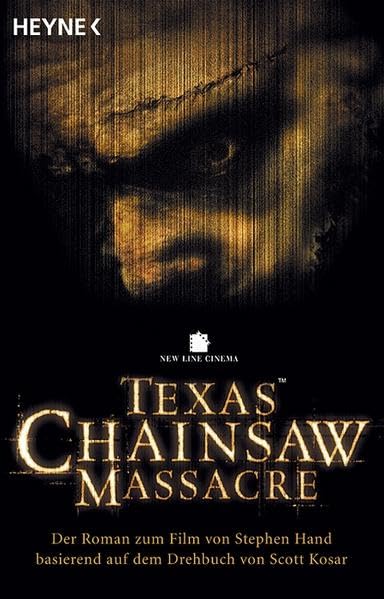1948 bekam der halbwüchsige Robert Kinnaird überraschenden Besuch. Der „Jäger“, ein außerirdischer Polizist, verfolgte einen Verbrecher aus seinem Volk. Beide mussten sie auf der Erde und nahe der kleinen Tahiti-Insel Ell notlanden. Der Jäger, ein vier Pfund leichter, giftgrüner, hochintelligenter Gallert-Klumpen, schlüpfte in Roberts Körper. Er wurde ein Freund und schützte seinen Wirt vor Krankheiten und Verletzungen. Gemeinsam verfolgte das ungleiche Duo den Verbrecher, der nach langer Jagd gestellt und ausgeschaltet werden konnte. Dafür zahlte der Jäger einen hohen Preis: Weil sein Raumschiff durch die Notlandung irreparabel beschädigt wurde, blieb er ein Gestrandeter. Hal Clement – Das Nadelöhr weiterlesen
Fried, Hel / Lancaster, Peter / Ninge, Joel E. / Först, Lukas / M., Manuel / Uffer, Matthias – Fleisch … und andere Appetitverderber
Leute, Kurzgeschichten sind einfach etwas Feines! Wenn sie von einem guten Autor ersponnen und verbrochen wurden, schaffen sie es in aller Kürze, den Leser zu fesseln und ihn in eine Parallelwelt zu entführen, in die man mal so zwischendurch entfliehen kann. In der Pause auf der Arbeit, beim Thronen auf der Schüssel oder zwischen den einzelnen Sexetappen. Solche Bücher zehre ich, sofern sie entsprechend gut geschrieben wurden, gern unter Volldampf in mich hinein, so dass es auch kein Wunder war, dass ich „Fleisch … und andere Appetitverderber“, eine Shortstory-Compilation des |Eldur|-Verlags, in null Komma nix verdaut hatte.
Siebzehn Geschichten von zehn verschiedenen Autoren, voller Leichenflederei, Sex, Gewalt, Tod, Blut und viel Gedärm; hier wird einem die fette Schlachtplatte |in personae| serviert. Herausragend im eigentlichen Sinne ist bei dieser Sammlung keine Story so recht, da sie alle auf einem ähnlich hohen Niveau kompetent verfasst wurden. Lediglich im Spannungsaufbau und letztendlich im Ekelfaktor stechen einige bestialisch hervor. So zum Beispiel „Der Messi“ von Salem Stoke, der von einem etwas unreinlichen Sammler allen Schrotts erzählt, der in seiner Wohnung aber auch Gütertrennung betreibt. Auch wenn ich dies im Falle von eigentlich zusammengehörigen Gliedmaßen reichlich merkwürdig finde.
Ein weiteres Highlight absoluten Ekels stellt „Das Bad“ dar, in dem der Protagonist für 30.000 Euro in einer Wanne umherschwimmen muss. Genauer gesagt, handelt es sich bei dieser Wanne jedoch um eine Kläranlage, was die Sache schon etwas erschwert und es dem Leser auch wirklich schwierig macht, seine Magensäfte bei sich zu behalten. ‚Widerlich und pervers‘ ist die treffende Umschreibung, doch ’spaßig und köstlich‘ passt in meinen Augen ebenso gut dazu.
Ein Sahnehäubchen des Sex-Gore stellt besonders die Titelgeschichte dar, in der man in der nahen Zukunft menschliches Fleisch für die oralen Bedürfnisse kaufen kann. Ein leicht verschrobenes Pärchen stellt aber noch bizarrere Dinge mit den Klumpen an. Als ob fressen nicht schon reichen würde …
Ich will und muss, denke ich, nicht jede Geschichte im Einzelnen auflisten, da sie sich in ihren Stilistiken sehr homogen zusammenfügen und sich im Schreib- und Lesefluss nicht großartig brechen. Mal werden Psychogramme kranker Seelen gezeichnet („Amputation“, „Ein Schmerz lang glücklich“, „Aeternitas“) und mal gehen die Storys deutlich ins Phantastische („Heinrichs Abendmahl“, „The Love Craft“). All diesen Geschichten ist aber definitiv der extreme Gorefaktor gemein, der manch einem Warmduscher die Kinnlade entgleisen lassen sollte.
Ich für meinen Teil hatte einhundertneunzig Seiten, die sich lesen wie ein paar geile Comics und runtergehen wie reines Olivenöl, puren Spaß.
Das ist nun einmal der Vorteil bei Kurzgeschichten: Die Autoren müssen sich nicht erst großartig Gedanken über einen komplexen Storyaufbau und ausführliche Charakterzeichnungen machen. Compuffter an und uff die Mutti! Genau so liest sich das Material auch.
Also wünsche ich viel Spaß und einen ordentlich fetten Happen verdorbenen Fleisches. Lasst es euch gut munden …
Hal Clement – Die Nadelsuche
Durch die halbe Galaxis ist der außerirdische Jäger seinem kriminellen Artgenossen gefolgt. Als er ihn endlich stellt, wird er ausgetrickst. Beide Raumschiffe müssen auf einem kleinen blauen Planeten notlanden, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht. Die Fremden überleben unbeschadet, denn sie sind Meister der Anpassung: vier Pfund intelligente, gallegrüne Gallerte. Doch so sieht man sie selten, denn die Angehörigen dieser seltsamen Spezies sind Symbionten. Sie suchen sich Wirtskörper, denen sie die Gastfreundschaft mit der Abwehr fast sämtlicher Krankheitserreger und einer fast unheimlichen Zunahme der Heilungskraft danken. Außerdem teilen sie ihr auf vielen Welten erworbenes Wissen mit dem Wirt, denn dies ist ihr oberstes Gebot: „Tue nichts, was deinem Gastgeber Schaden zufügen könnte!“ Hal Clement – Die Nadelsuche weiterlesen
Klein, Edward – Geheimnis der Kennedys, Das
„Dieses Buch ist eine Kriminalgeschichte. Es untersucht eines der großen Mysterien unserer Zeit – den Kennedy-Fluch. Es beschäftigt sich mit den Mustern, die dem Fluch zugrunde liegen und ihn bestimmen, und untersucht die zahlreichen Einflüsse – historische, psychologische und genetische -, die den Charakter der Kennedys geformt und zu ihrem selbstzerstörerischen Verhalten geführt haben.“ (S. 37)
Ob Verfasser Klein diesem hehren Ziel genügen kann, dazu äußert sich Ihr Rezensent weiter unten. An dieser Stelle sei vermerkt, dass er es in vier Buchteilen am Beispiel von insgesamt sieben Kennedys versucht. Um die Leser sogleich an den Kanthaken zu nehmen, beginnt Klein das Pferd am Schwanz aufzuzäumen und erzählt die dramatische, noch recht frische Geschichte vom tragischen Ende des John Fitzgerald Kennedy jr., der im Sommer 1999 samt Glamourgattin Carolyn mit seinem Kleinflugzeug ins Meer stürzte.
Eigentlich ist es nur die halbe Geschichte, denn Klein greift sie im Finale seines Buches, wenn das Risiko der Leserflucht gering geworden ist, noch einmal auf. Diese Zweiteilung soll gewährleisten, dass sich sein Publikum pflichttreu durch jene Kapitel arbeitet, in denen von weniger bekannten Kennedys die Rede ist. Klug nachgedacht, denn die Tatsache, dass Patrick Kennedy (1823-1858) der angebliche Auslöser des Familienfluches ist, lässt ihn nicht zwangsläufig interessanter wirken.
Wobei besagter „Fluch“ nach Ansicht Kleins eine Mischung aus Minderwertigkeitsgefühlen – entstanden durch die Erfahrungen einer an Entbehrungen und Zurückweisungen reichen, aber ansonsten bitterarmen irischen Auswandererfamilie -, Narzissmus und emotionaler Kälte ist, die in dem Slogan „Siegen um jeden Preis“ kulminierte. Dies ist nach Klein die Quelle des Musters, das noch heute so vielen Kennedys Kopf & Kragen kostet.
Auch die Ära des Politik-Hallodris John Francis „Honey Fitz“ Fitzgerald (1863-1950) dient Klein vor allem als Beleg dafür, dass die Kennedys, wie sie die Medien und die Öffentlichkeit zu schätzen wissen, sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits verflucht sind. Weiter geht es mit Joseph Patrick Kennedy (1888-1969), dem krankhaft ehrgeizigen, eiskalten Patriarchen, Alkoholschmuggler und Politgangster, den man – in Tateinheit mit seiner frömmelnden Gattin Rose (1890-1995) – objektiv wohl als eigentlichen Familienfluch bezeichnen müsste. Weniger bekannt ist die Geschichte von Kathleen „Kick“ Kennedy (1920-1948), die es bis zur englischen Marquise schaffte und einem Flugzeugabsturz zum Opfer fiel.
Auf vertrautem Terrain bewegt sich Klein im Kapitel „John F. Kennedy“. Im Blickpunkt seiner „Kriminalgeschichte“ stehen weniger die politische Leistung des US-Präsidenten (1917-1963), sondern sein ausschweifendes Sexleben, seine vertuschten Gesundheitsprobleme sowie sein historisches Ende. Am Beispiel des William Kennedy Smith (geb. 1960) zelebriert der Verfasser beispielhaft seine „Götterdämmerung“ des Kennedy-Clans, bevor er noch einmal zu J.-F. K. jr. zurückkehrt. Für jene, die noch immer nicht begriffen haben, folgt ein Epilog: „Der Fall des Hauses Kennedy“.
Was ist nun davon zu halten? Die Kennedys führen ein aktives Leben unter den Augen einer allzeit interessierten Öffentlichkeit. Außerdem vermehren sie sich wie die Karnickel. Ob es da wohl einen Zusammenhang mit den zahlreichen Schicksalsschlägen gibt, welche diese Familie in anderthalb Jahrhunderten trafen? Oder anders gefragt: Wenn man die Opfer ebenso kopfstarker, aber eben nicht berühmter Familien addiert, wäre das Ergebnis nicht ähnlich erschreckend? Natürlich fehlt hier der Kennedy-Glamour; die Normalsterblichen des 19. und 20. Jahrhundert starben unbemerkt und nur von den Ihren betrauert. Gibt ein Kennedy den Löffel ab, steht dagegen die Presse Spalier – so ist das schon seit vielen Jahrzehnten.
Nicht nur die Kennedys selbst, sondern viele von denen, welche sie aus unerfindlichen Gründen bewundern und auch an ihren privaten Geschicken Anteil nehmen, scheinen der Auffassung zu sein, dass nur böse Mächte aus dem Jenseits die göttergleichen Titanen dieses Clans fällen können. Ein „Fluch“ muss her, der die Story gleich wesentlich interessanter macht. Notfalls konstruiert man ihn halt selbst: „Keine zehn Jahre nach der Emigration aus Irland stirbt Patrick Kennedy … am 22. November [1858] an der Schwindsucht. Die Todesursache ist im neunzehnten Jahrhundert nicht ungewöhnlich, das Datum aber scheint manchen bedeutsam: Auf den Tag genau 105 Jahre vor dem Attentat auf John F. Kennedy.“ – S. 39. Klar, dass mit „manchen“ vor allem Edward Klein gemeint ist …
Womit wir die Urheber dieser Mär schon identifiziert haben: Die Kennedys sind und waren Medienmenschen. Über sie lassen sich Schlagzeilen füllen, hohe Auflagen und Zuschauerzahlen erzielen. Gleichzeitig scheinen menschliche Unzulänglichkeiten wie Wahlbetrug, Ehebruch oder Alkoholismus viel dramatischer zu sein, wenn sie jene zelebrieren, die doch angeblich unsere Vorbilder sein sollen. Bloß: Wer hat sie eigentlich dazu ernannt?
Auch Edward Klein scheint nicht fassen zu können, wieso sich die Kennedys so benehmen, wie sie sich benehmen. Vielleicht hat er allzu lange die Gnade genossen, bei Jacqueline Kennedy Onassis selig auf der Sofakante sitzen und den Erzählungen einer alternden, einsamen Frau lauschen zu dürfen. Die nötige Distanz zum Objekt seiner „historischen Forschungen“ lässt er jedenfalls jederzeit vermissen. Das mag wundern angesichts der „Skandale“, die er in diesem Buch gleich in Serie präsentiert. Der Blick ins Literaturverzeichnis belegt indes, dass Klein quasi ausschließlich auf längst publiziertes Material zurückgegriffen hat: Seine Zeter-Chronik ist zusammengeschrieben aus dem, was andere zu Tage brachten. Auf seinem angeblichen Schatz in Jahrzehnten angehäuften Insiderwissens bleibt Klein jedenfalls weiterhin eifersüchtig hocken. Ausgesprochen selten zitiert er aus eigenen Quellen (dies zudem – auf Wunsch des jeweiligen Informanten – stets anonym …)
Das rächt sich, wenn das Wissen aus erster und zweiter Hand zu versiegen beginnt. Für Klein ist spätestens das 19. Jahrhundert eine Informationswüste. Leider rührten sich die ersten Kennedys im Irland der 1850er Jahre. Aus dem Nachwort geht auch hervor, dass Klein vor Ort gewesen ist. Was hat er dort gemacht? In den Archiven hat er sich wohl nicht lange aufgehalten. Stattdessen zieht er einige allgemeine Geschichtsbücher zu Rate. Ein Bericht über den Emigrantenhafen Liverpool wird von Klein kurzerhand als historische Kulisse umgearbeitet, in die er „seine“ Kennedys setzt und sie wie in einem (schlechten) Historienroman reden und denken lässt. Dass keinerlei gesicherten Belege dies stützen, stört ihn überhaupt nicht.
Halbwissen, Insiderklatsch, für den eigenen Gebrauch aus dem historischen Zusammenhang gepickte Fakten bilden das Fundament, auf dem Klein sein faktenwackliges Kennedy-Monument errichtet. Viel Zeit – z. B. für echte Recherchen – darf er sich ohnehin nicht lassen, denn der Buchmarkt drängt ihn schon wieder (s. u.) zur nächsten Skandalchronik. Für den Leser muss deshalb das Fazit lauten, Zeit & Geld zu sparen. „Das Geheimnis der Kennedys“ ist als historisches Sachbuch indiskutabel und als Gossentrash einfach nicht unterhaltsam genug.
Aber Amerika ist halt ein seltsames Land … Edward Klein gilt dort keineswegs als Klatschmaulwurf, sondern genießt den Ruf eines seriösen Autors und Herausgebers. Tatsächlich liest sich sein journalistischer Lebenslauf eindrucksvoll. U. a. war Klein von 1977 bis 1988 Chefherausgeber des ganz und gar nicht unbekannten „New York Times Magazine“. In dieser Zeit gewann es den ersten Pulitzer-Preis in seiner Geschichte. 1989 ging Klein zu „Vanity Fair“. Hier wurde er bekannt für seine Artikel über Jacqueline Kennedy Onassis und Onassis-Enkelin Athina Onassis Roussel. Darüber hinaus schrieb Klein für viele andere Zeitschriften und Zeitungen, wobei er sich auf Interviews mit Persönlichkeiten der politischen Zeitgeschichte spezialisierte.
Der Buchautor Klein nutzt sein fein gesponnenes Netz prominenter Kontakte als Verfasser biografieähnlicher Sachbücher, die sich meist diverser Tragödien und Skandale als Aufhänger bedienen. Jackie Kennedy Onassis wurde als ertragreiche Gossip-Mine gleich mehrfach ausgebeutet, so in „Just Jackie: Her Private Years“, „All Too Human: The Love Story of Jack and Jackie Kennedy“ (dt. „Jack & Jackie. Das Kennedy-Traumpaar im Zentrum der Macht“) und – Peinlichkeit und Geschäftssinn kennen keine Grenzen – „Farewell Jackie. A Portrait of Her Final Days“. Nachdem Jackie nunmehr auf Wolke Sieben Hof hält, hat Klein in „The Kennedy Curse“ die letzten Notizbucheinträge verbraten und sich anschließend neuen saftigen Wiesen zugewandt. 2005 verfasste er nach bekanntem Muster „The Truth About Hillary“, dessen Vorverkauf durch die vorab verkündete „Topinfo“ angekurbelt wurde, Ex-Präsident Bill Clinton habe seine Tochter Chelsea durch Vergewaltigung der Gattin gezeugt …
Philip K. Dick – Irrgarten des Todes

Doch kaum auf dem fremden Planeten angekommen, stellen die vermeintlichen Siedler fest, dass sie hier festsitzen, keiner ein rückflugtaugliches Raumfahrzeug mitgebracht hat.
Elsaesser, Thomas – Metropolis. Der Filmklassiker von Fritz Lang
Wie kann es eigentlich angehen, dass ein Film als Klassiker gilt, den kaum jemand wirklich gesehen hat …? Ein Dreivierteljahrhundert nach seiner Entstehung ist es gar nicht so einfach, „Metropolis“ neu oder wieder zu entdecken. Manchmal wird er von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern im Dunkel der Nacht gezeigt, aber eigentlich müsste man ihn natürlich auf der großen Leinwand so sehen, wie ihn Fritz Lang einst konzipiert hat.
Bei dieser Gelegenheit zeigt sich, dass „Metropolis“ auch im 21. Jahrhundert die Gemüter zu erregen vermag. Viel bewundert ob seiner monumentalen Bildsprache, die noch heute staunen macht, aber vielleicht noch mehr kritisiert und geschmäht wegen der naiven Geschichte, die da mit stupendem Aufwand erzählt wird, ist es an der Zeit für eine aktuelle und vor allem sachliche Bestandsaufnahme: Was ist „Metropolis“ wirklich bzw. was haben sich seine Schöpfer vor 78 Jahren dabei gedacht, ein bei objektiver Betrachtung wahnwitziges Projekt zu verwirklichen?
Der Film- und Fernsehhistoriker Thomas Elsaesser, der an der Universität Amsterdam lehrt, hat sich diesen Fragen im Auftrag des renommierten „British Film Institute“ angenommen. Auf gerade 135 Seiten ist das keine einfache Aufgabe, denn über „Metropolis“ haben sich schon viele und manchmal sogar kluge Köpfe ausführlich dieselben zerbrochen. Im Gewirr dieser wild bewegten Rezeptionsgeschichte den roten Faden zu finden, ist eine respektable Leistung. Elsaesser ist es gelungen – und noch besser: Er schafft es, das schwierige Thema mit spielerischer Leichtigkeit in den Griff zu bekommen und seinem Publikum nahe zu bringen.
Dabei geht Elsaesser beileibe nicht den einfachen Weg, der in der Filmbuch-Welt leider in der Regel so aussieht: Man erzähle ausführlich die Story nach, ergänze dies durch die Nachbetung einiger Fakten aus der Pressemappe und peppe das Ganze mit (meistens reichlich apokryphen) Anekdoten auf, die im Falle von „Metropolis“ ungeprüft seit über siebzig Jahren nachgeplappert werden. Dazu kommen viele, viele Bilder – fertig! Elsaesser geht dagegen inhaltlich in die Tiefe, und er setzt mit einer ungewöhnlichen These an: „Metropolis“ ist in seiner Deutung kein geplantes Monument der frühen Filmgeschichte, keine ehrgeizige Prophezeiung einer möglichen Zukunft, auch kein (missglücktes) politisches Manifest, sondern ein kühl kalkulierter Blockbuster à la „Star Wars – Episode 1“. Die Belege dafür sind bestechend: In den 20er Jahren befand sich die deutsche Filmindustrie, die einst führend in der Welt war, in einer tiefen Krise. Hollywood hatte die Zelluloid-Krone an sich gerissen. „Metropolis“ sollte als Kraftakt beweisen, dass Deutschland nicht nur mithalten, sondern die Konkurrenz jederzeit in die Schranken verweisen konnte. Dies war der Grund, wieso die UFA Fritz Lang praktisch unbegrenzte Mittel gewährte und ihn zwei Jahre (!) ungestört an „Metropolis“ arbeiten ließ.
Auf der anderen Seite erklärt diese Zielrichtung auch die oft beklagte formale wie inhaltliche Indifferenz des Films. Ungehemmt und offenen Auges wilderten Regisseur Fritz Lang, Drehbuchautorin Thea von Harbou oder Ausstatter Ernst Ketelhut in den Höhen der hehren Kunst wie in den Niederungen des alltäglichen Kitsches. Elsaesser ist es gelungen, den Ursprung vieler „Metropolis“-Bilder, die sich längst in Pop-Ikonen verwandelt haben – der weibliche Roboter, der Turm zu Babel, das Rotwang-Labor usw. -, zu rekonstruieren. Die Betroffenheit über die scheinbare Banalität der meist recht seichten Quellen, aus denen sich „Metropolis“ speist, weicht der Bewunderung, wenn man sich erst einmal vor Augen geführt hat, dass „Metropolis“ in erster Linie ein Spektakel und „nur“ ein Film ist und nie als etwas Anderes, gar „Großartiges“ geplant war.
Unter diesem Aspekt relativiert sich auch die Mär vom künstlerischen und geschäftlichen Scheitern des ehrgeizigen Projektes. Fritz Lang und besonders Thea von Harbou, die stets als die „Hauptschuldigen“ gescholten werden für das schlechte Abschneiden an den Kinokassen, hatten einfach Pech: „Metropolis“ entstand für einen Konzern am Rande des Konkurses, in einer Zeit der Inflation und der politischen wie wirtschaftlichen Unruhen – und kam auf den Markt, als sich der Tonfilm massiv ankündigte.
Was dagegen von der Kritik niemals richtig gewürdigt wurde, ist der enorme Erfolg des Films auf anderem Gebiet: Einen Kultfilm erkennt man daran, dass er moderne Mythen entstehen lässt. „Metropolis“ ist in dieser Hinsicht ein einziges Füllhorn; ein Ideen- und Bildersteinbruch, aus dem sich die Nachgeborenen gern und großzügig bedienten. Elsaesser kann nur wenige, aber beeindruckende Beispiele präsentieren – bereits die Nennung von Filmen wie „Frankenstein“ über „Blade Runner“ bis zur „Batman“-Serie (der „richtige“ der Teile 1, 2 und 5, nicht der Schumachersche Clown im Cape), „Das Fünfte Element“ oder „Sin City“ gibt ihm uneingeschränkt Recht.
Wenn man Elsaesser bereitwillig schon bis zu diesem Punkt gefolgt ist, akzeptiert man auch sein zunächst irritierendes Plädoyer für Giorgio Moroders bonbonbunte, massiv umgeschnittene und mit der Popmusik der 80er unterlegte „Metropolis“-Fassung von 1983. Das Protestgeheul der etablierten Filmkritik ließ damals die Kinowände weltweit erzittern, doch Elsaesser nimmt Moroder in Schutz und weist nach, dass „Metropolis“ bereits seit seiner Uraufführung immer wieder geschnitten und neu montiert wurde – womöglich gibt es gar keine authentische Urfassung! Die eigentliche Kraft dieses Films, so Elsaesser, liegt in der erstaunlichen Tatsache, dass noch jede Version ihr Publikum gefunden hat: In einem Film, der stets Stückwerk war, nimmt der Zuschauer nur jene Elemente wahr, die seine Phantasie beflügeln.
Doch ist Thomas Elsaesser denn nun im Besitz der einzigen Wahrheit? Er stellt seine Thesen zur Diskussion, aber das heißt keineswegs, dass seine überzeugenden Thesen in zehn Jahren noch gültig sein werden. Elsaessers „Metropolis“-Buch fesselt auch als Exkurs über die Filmkritik im Wandel der Zeit. Jede Generation, jede Kultur hat den Film so interpretiert, wie er in ihr Weltbild passte. „Metropolis“ wurde als kommunistische Agitation wie als faschistische Propaganda, als Warnung vor den Nazis wie als früher Gruß an Hitler & Co, als Utopie wie als Dystopie interpretiert oder besser: instrumentalisiert. Heute ist es möglich offen anzusprechen, dass „Metropolis“ in erster Linie Unterhaltung war und ist, ohne dafür von der verkopften Cineastenschar früherer Jahre gesteinigt zu werden. (Nicht, dass es sie nicht mehr gäbe oder sie es nicht gern täte – sie ist nur einfach nicht mehr in der Überzahl und musste heraus aus ihrem Elfenbeinturm …) Unter dieser Prämisse ist übrigens ausgerechnet der arme H. G. Wells das beste Beispiel für solche Kurzsichtigkeit: Der hoch und mit Recht gerühmte Autor unsterblicher Klassiker wie [„Die Zeitmaschine“ 1414 oder „Der Krieg der Welten“ listete penibel die „Fehler“ und Anachronismen auf, die ihm in „Metropolis“ als Geschichte aus der Zukunft aufgefallen waren, ohne jemals zu begreifen, dass diese überhaupt nicht beabsichtigt war bzw. eine Story im Film völlig anderen Gesetzen zu gehorchen hat als ein Roman.
„Metropolis“ gehört eindeutig zu den Highlights der Reihe „Filmbibliothek“ des |Europa|-Verlags: brandaktuell, fern jedes pseudo-philosophischen Schwurbels kundig und lesbar geschrieben, vorzüglich übersetzt und erfreulich preisgünstig – ein erstaunlicher, neugierig machender (Rück)Blick auf einen halb vergessenen, doch stets präsenten, oft missverstandenen Klassiker der Filmgeschichte.
Eugenides, Jeffrey – Air Mail
Spätestens seit Jeffrey Eugenides 2003 für seinen erstklassigen Roman [„Middlesex“ 916 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, ist er einer der großen Stars der zeitgenössischen amerikanischen Literatur. Ein großartiges Erzähltalent, das fesselnd seine Geschichten spinnt und Figuren aus dem Hut zaubert, die erfrischend normal und alltäglich sind.
In Romanform hat Eugenides sein Können bereits zweimal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zum einen mit seinem Romandebüt „Die Selbstmord-Schwestern“, der Geschichte des Selbstmords der fünf Schwestern der amerikanischen Vorstadtfamilie Lisbon, zum anderen durch die Familiengeschichte des Hermaphroditen Cal/Callie in „Middlesex“. Beide Romane drehen sich um ähnliche Dinge. Normalitäten und Absurditäten in den weißen Vorstädten der amerikanischen Mittelschicht und gleichzeitig um die Zeit des Erwachsenwerdens, die schwierige Phase der Pubertät, des Erwachens der Sexualität, mit all den Irritationen und Kuriositäten, die dazugehören. Beide Romane sind Familiengeschichten der etwas anderen Art.
„Air Mail“ ist nun ein Werk, das sich von den beiden bekannten Veröffentlichungen des Autor einerseits fundamental unterscheidet, andererseits aber durchaus das Bild vervollständigt. „Air Mail“ vereint drei Erzählungen, deren zeitlicher Ursprung genau zwischen den beiden genannten Romanen liegt, zwei stammen aus dem Jahr 1997, die dritte wurde 1999 verfasst.
Nun ist das immer so eine Sache, von einem überaus erfolgreichen und vielgelobten Autor zu einem späteren Zeitpunkt frühere Werk auszugraben und zu veröffentlichen. Im Fall von Jonathan Franzen fand ich mit [„Die 27ste Stadt“ 1207 das Ergebnis eher weniger befriedigend. Oft werden die frühen Werke der heute so großartigen Autoren den Erwartungen nicht ganz gerecht. Doch bei „Air Mail“ ist diese Gefahr schon aufgrund des gänzlich anderen Erzählformats geringer. Als „Kurzstrecken-Erzähler“ ist Eugenides schließlich dem deutschen Leser bislang noch weitestgehend unbekannt.
_Air Mail (1997)_
Die erste Erzählung dreht sich um Mitchell, der gerade auf einer kleinen Insel im Golf von Siam auf einer Strohmatte in einer kleinen Hütte gegen die Ruhr ankämpft. Inspiriert durch die fernöstliche Mentalität, durch den Glauben an die Kraft des Geistes, versucht Mitchell die Ruhr durch eisernes Fasten kleinzukriegen. Fernab von zu Hause, in der Abgeschiedenheit seiner Hütte, bringt Mitchell all seine Gedanken über sich und den Lauf der Welt zu Papier – auf Luftpostpapier, in Form von Briefen, die er seinen Eltern schicken will, in der Hoffnung, dass sie ihn besser verstehen. Während Mitchell seinen Durchfall „wegfastet“, stapeln sich Briefe, die Mitchell nie abschicken wird.
„Air Mail“ ist eine recht sonderbare, aber gleichsam faszinierende Erzählung. Ein exotischer Schauplatz, an dem der Protagonist Mitchell nach einem Inhalt für sein Leben sucht. Der Kontakt zu den Eltern beschränkt sich auf ein Minimum. Sie sind enttäuscht von ihm, dass er die eigentlich geplante Europareise zu einer ausgedehnten Asienreise erweitert hat, mittlerweile seit einem halben Jahr fort ist und ihnen keinerlei Hoffnung auf eine baldige Rückkehr macht. Karriere, Studium und Familie stehen hinten an, solange Mitchell ohnehin nicht weiß, was er einmal machen will.
Fernab der Zivilisation beginnt Mitchell sich selbst zu erforschen, nach einem Sinn zu suchen. Die Ruhr sieht er da fast als eine Art Weg zur Erkenntnis. Er beginnt, sich von der Welt abzukapseln, während er gleichzeitig in dem Glauben ist, er würde sich ihr öffnen, sie endlich verstehen. Innere Erkenntnis und äußere Kommunikation stellen dabei gegenläufige Entwicklungen dar. Verfasste Briefe werden nicht mehr abgeschickt, sein Kumpel Larry versteht nicht recht, warum Mitchell nicht endlich Medikamente nimmt, statt weiter zu fasten, und als Mitchell nach vielen Tagen der Abgeschiedenheit in die Gemeinschaft am Strand zurückkehrt, hat er sich längst meilenweit von ihr entfernt.
Besonders das Ende der Geschichte ist merkwürdig und man steht als Leser etwas ratlos da. Doch irgendwie bleibt auch der Eindruck zurück, dass das Ende gar nicht so sehr das Entscheidende ist. Kern der Erzählung ist vielmehr der Gegensatz zwischen Innen- und Außenleben des Protagonisten.
_Die Bratenspritze (1999)_
„Die Bratenspritze“ ist eine Erzählung, die eine gänzlich andere Richtung einschlägt. Weniger nachdenklich stimmend, weniger sonderbar und weniger verkopft als „Air Mail“. Tomasina ist vierzig, hat alles erreicht, was man sich wünschen kann und einen Job als Produzentin der CBS Evening News, auf den andere nur neidisch sein können. Tomasina ist Single, hatte viele Liebschaften mit nicht wenigen Pannen und daraus resultierend immerhin auch schon eine Handvoll Abtreibungen. Doch mit vierzig beginnt allmählich die biologische Uhr zu ticken, auch für Tomasina. Sie will ein Kind, aber möglichst ohne Mann. Samenspende heißt das Zauberwort, und so lädt sie zu einer Art Befruchtungsparty, inklusive Samenspende, am Tag ihres mittels Basalthermometer ermittelten Eisprungs.
Rein erzählerisch spielt „Die Bratenspritze“ schon in der Liga, in der etwas später auch „Middlesex“ spielt. Bildhafte Vergleiche, die den Leser schmunzeln lassen, und lebhaft gezeichnete Figuren. „Die Bratenspritze“ ist letztendlich eine satirische Momentaufnahme à la „Sex and the City“. Eine Party zwecks Befruchtung der Gastgeberin, das ist für sich schon schräg genug, aber Eugenides lässt diese Party durchaus ernsthaft organisiert erscheinen – so wie man sich eine Party in der feinen New Yorker Gesellschaft der Besserverdienenden halt vorstellt, mit passendem Nippes und feinstem Champagner.
Der eigentliche Protagonist stolpert erst im Verlauf der Erzählung in die Geschichte, ganz unvermittelt und unerwartet platzt er mit einem |“An diesem Punkt sollte ich mich vielleicht vorstellen. Ich heiße Wally Mars.“| in das Geschehen. Wally ist die heimliche Hauptfigur. Ein abgelegter Liebhaber von Tomasina, dem die Rolle des unauffälligen Beobachters zufällt. Mit einem feinen Blick für das Absurde der Situation erzählt Wally die Geschichte, in der er selbst später noch eine maßgebliche Rolle spielen wird.
Eugenides zeigt sich hier von seiner unterhaltsamsten und ironischsten Seite. Während die anderen beiden Erzählungen vielfältigere und weniger leicht zu entschlüsselnde Emotionen transportieren, ist „Die Bratenspritze“ recht einfach gestrickte Unterhaltung, mit einem Blick für die teilweise absurden Züge der modernen Gesellschaft.
_Timesharing (1997)_
In der dritten Erzählung geht es mitten hinein in den tristen amerikanischen Alltag. Eine Vater-Sohn-Geschichte, die in Florida angesiedelt ist. Der Ich-Erzähler besucht seine Eltern, die in Florida gerade ein heruntergekommenes Motel in eine Goldgrube umzuwandeln versuchen. Timesharing heißt das Zauberwort. Die Zimmer werden mit Kochnischen ausgestattet und sollen möglichst längerfristig an zahlungskräftige Gäste vermietet werden.
„Timesharing“ ist einfach eine Momentaufnahme. Anfang und Ende bleiben ein wenig diffus. Eine Pointe, auf die alles hinausläuft, oder einen Höhepunkt gibt es in dem Sinne nicht. Es ist lediglich eine Zustandsbeschreibung des Lebens der Protagonisten und ihres Verhältnisses zueinander. Der Zustand des alten Motels geht dabei mehr oder weniger konform mit dem Zustand des Vaters, der mit brüchiger Gesundheit und stetig schwindender Kraft versucht, sein Lebenswerk zu vollenden. Der Sohn wirkt dabei nicht weniger müde, als es die Eltern sind. Unmotiviert verbringt er seine Zeit als Beobachter auf der Baustelle der Eltern, zieht abends durch die Kneipen und sieht sich nicht einmal dazu in der Lage, ein neues Paar Schuhe zu kaufen.
„Timesharing“ lässt den Leser mit einem merkwürdigen Gefühl zurück. Die Geschichte wirkt irgendwie melancholisch und traurig und die Figuren in all ihrer Müdigkeit und Zerbrechlichkeit erschreckend menschlich. Dadurch, dass die Geschichte keinen klar definierten Handlungsrahmen aufweist, bleibt sie einerseits etwas distanziert und befremdlich, trifft einen andererseits aber auch ins Mark, weil sie authentisch und lebensecht wirkt.
Ergänzt werden die drei Erzählungen durch ein Nachwort des ARD-Literaturkritikers Dennis Scheck. Es wirkt teilweise etwas hochtrabend, wie Scheck sich von Fremdwort zu Fremdwort hangelt, unterstreicht inhaltlich aber die Bedeutung, die Eugenides in der modernen Literatur hat. Möglich auch, dass das Nachwort noch ein wenig als Füllwerk dienen soll, um das Büchlein auf immerhin knappe 120 Seiten zu bringen. In meinen Augen wäre es nicht unbedingt nötig gewesen.
Die drei Erzählungen in „Air Mail“ sind Lektüre für knapp etwas mehr als eine Stunde, dennoch fordern sie eine gewisse darüber hinausgehende Aufmerksamkeit. Ein wenig bedauerlich ist es schon, einen Eugenides so schnell aus der Hand legen zu müssen, und so bleibt ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit zurück. Aber die deutet weniger auf einen qualitativen Mangel hin, sondern mehr darauf, dass man als Leser einfach schon verwöhnt ist, wenn man vorher „Middlesex“ gelesen hat. Eugenides bleibt auch nach der Veröffentlichung von „Air Mail“ ein großartiges Erzähltalent, das man im Auge behalten sollte.
H. G. Wells – Die Zeitmaschine

H. G. Wells – Die Zeitmaschine weiterlesen
Sträter, Torsten – Postkarten aus der Dunkelheit (Jacks Gutenachtgeschichten 2)
„Postkarten aus der Dunkelheit“ ist Teil zwei der Kurzgeschichtensammlung aus der Feder Torsten Sträters, dessen erster Teil [„Hämoglobin“ 1416 im Jahre 2004 sensationelle Kritiken einheimsen konnte. Nun, was soll ich sagen? Teil eins fand ich schon sehr gelungen, aber stellenweise zu wenig im Bereich der Phantastik angesiedelt. Als hätte mich Herr Sträter in meinem Klagen erhört, erhöht er sogleich den Phantastikfaktor und hämmert einem zwölf ultraextreme Prosamonster vor die Birne, die in ihrer schreiberischen Bildgewalt in Deutschland ihresgleichen suchen. Man nehme als Beispiel die Geschichte ‚Heiliger Krieg: Einer muss es ja machen‘, bei der der Vatikan sich mit Hilfe freiwilliger, heiliger Krieger zum großen Schlagabtausch mit dem Bösen aufmacht. So schlicht sich dieses Grundgerüst auch anhören mag, so deftig heftig explodieren die Worte im Leserkopf. Man kann fast nicht anders und verschluckt Geschichte für Geschichte, in meinem Fall in nur knapp drei Stunden.
Wieder einmal balanciert Sträter seine Storys gut aus, hängt seicht gifttriefende, beißend ironische Geschichten und pure Splatterorgien hintereinander und bekommt so eine exzellent ausgewogene Mischung aus Grusel und purem Horror hin, die von der ersten Seite an fesseln kann. Ob da jetzt Geisterbahnwärter ihre Aufgabe etwas zu genau nehmen oder Luzifer höchstpersönlich in den Berliner Bunkern von zwei ahnungslosen Polizisten erweckt wird, ein Geist in einer Achterbahn verzweifelt darauf wartet, dass sich jemand das Genick bricht, damit ihm seine Seele fortan Gesellschaft leisten kann oder der klassische Serienmörder in ‚Der Kasper will kein Snickers‘ seine Huldigung erfährt – Sträter erweist sich als wahrer Künstler auf der Klaviatur des Grauens. Dabei fliegen einem die Knochenfetzen und Gewebestreifen recht blutig aus den Seiten entgegen, wenn Herr Sträter mit seinem Schreibstil richtig ausholt. Teilweise geht das schon ziemlich weit über meine Definition von Ekelgrenze hinaus, und die liegt bei mir weiß Gott nicht gerade niedrig.
Wer mit dem extrem bildgewaltigen Stil von Torsten Sträter klarkommt und auch mit bärbeißigem und pechschwarzem Humor leben kann, der sollte „Postkarten aus der Dunkelheit“ auf jeden Fall klemmen. Im Vergleich zum Erstling „Hämoglobin“ ist Band zwei eine weitere, einhundertprozentige Steigerung und ich wage es jetzt einmal ganz forsch, Torsten Sträter als den neuen deutschen |king of horror| zu bezeichnen. Für alle Horrorfans ist definitives Zugreifen angesagt.
Luciano Mecacci – Der Fall Marilyn Monroe und andere Desaster der Psychoanalyse

Luciano Mecacci – Der Fall Marilyn Monroe und andere Desaster der Psychoanalyse weiterlesen
Hodgson, William Hope / Newman, Kim / Busson, Paul / Lovecraft, H. P. / Somtow, S. P. / Lueg, Lars P – Necrophobia 2
Bereits zum zweiten Mal spielt Andy Materns Jingle zu „Necrophobia“ auf und lädt den geneigten Hörer ein, sich die „besten Horrorgeschichten der Welt“ zu Gehör zu führen. 2003 enthielt die erste Ausgabe von [„Necrophobia“ 1103 Geschichten von Lovecraft und Laymon und auch 2005 hat Mastermind Lars Peter Lueg wieder eine illustre Mischung auf zwei CDs gebannt. Fünf Geschichten darf der Hörer genießen, deren Bandbreite so groß ist, dass für jeden etwas dabei sein dürfte: eine gruselige Seemannsgeschichte, ein fanatischer Sammler, ein lebendig Begrabener, ein wandelndes Monster und ein religiöser Serienmörder haben in „Necrophobia“ ihren großen Auftritt.
Den Anfang macht William Hope Hodgons „Die Stimme der Nacht“ („The Voice in the Night“, 1914) mit einem durchaus interessanten Setting. Zwei Seeleute machen in einer finstren und nebligen Nacht eine außergewöhnliche Begegnung. Durch den Nebel hören die beiden ein „Schiff Ahoi“ auf sie zutreiben und machen kurz darauf in der Dunkelheit der Nacht ein Boot aus. Der Insasse weigert sich standhaft, nähert ans Licht zu kommen, bittet aber um etwas Proviant für die Dame, die er auf der Insel zurückließ. Die beiden Seemänner haben Mitleid, lassen ihm frische Früchte zukommen und im Gegenzug erzählt der mysteriöse Fremde seine Geschichte. So konnte er sich nämlich mit seiner Frau gerade so von einem sinkenden Schiff retten. Doch die Insel, auf die sie sich retten konnten, scheint von einem seltsamen und abstoßenden Pilz überwuchert zu sein, der vor nichts Halt macht. Die beiden harren zwar zwangsweise auf der Insel aus, doch sind sie dort gefangen und dem Pilz hoffnungslos ausgeliefert …
Hodgons Erzählung mäandert etwas dahin und bietet kaum unerwartete Überraschungen. Sie lebt vielmehr von dem beunruhigenden Gefühl, in völliger Freiheit eingesperrt zu sein und keine Hoffnung auf Rettung zu haben. Das junge Ehepaar kann nirgendwohin ausweichen, ihr Feind verfolgt sie überallhin. Und auch wenn sie es nicht wissen, als sie die Insel betreten, so sind sie doch bereits zum Tode verurteilt, als sie den Fuß auf den Strand setzen. Die Geschichte spielt mit der alten Frage, was sich alles da draußen in dieser Welt befindet; welche Schätze und Grauen noch nicht entdeckt sind. Und auch wenn wir heute meinen, uns die Welt untertan gemacht zu haben, so gibt es immer noch Flecken wie diese Insel, die böse Überraschungen bereithalten können.
Helmut Krauss bildet den Anfang als Sprecher auf dieser Höranthologie. Krauss (Synchronsprecher von Marlon Brando & Samuel L. Jackson) liest oft und viel für LPL und seine tiefe dräuende Stimme verfehlt nie ihre Wirkung. Hier überzeugt er vor allem als krächzender und lebensmüder Erzähler, dem man die Verzweilfung und Hoffnunslosigkeit anhört.
Weiter geht es mit dem totalen Gegenprogramm, Kim Newmans „Der Mann, der Clive Barker sammelte“ („The Man who collected Barker“, 1990), einer Erzählung, die zwischen böser Parodie und wohl temperiertem Schrecken hin und her pendelt. Die Ich-Erzählerin trifft auf einen Mann, dessen Lebensinhalt das Sammeln von Pulp-Autoren ist. Erstausgaben, signiert, mit persönlicher Widmung schmücken seine Privatbibliothek, die so eingerichtet ist, dass die Bücher möglichst nicht verblassen oder sonstwie Schaden nehmen. Der Sammler stellt sich schnell als fanatischer Spinner heraus (daher ja auch das Wort „fan“ von „fanatic“) und Kim Newman zielt und platziert genüsslich einen Seitenhieb nach dem anderen auf all die Berufsfans da draußen, diese Geeks, die so weit in ihrem Fandom aufgehen, dass sie darüberhinaus kein Leben haben. Newman schreibt damit das genaue Gegenprogramm zu Nick Hornbys Hymne an Fans und Sammler und Geeks moderner Popkultur, und dass er zunächst in seiner Beschreibung des Sammlers kaum überzeichnet, setzt der ganzen Sache die Krone auf. Doch als er die Ich-Erzählerin in den Schrein für Clive-Barker-Erstausgaben führt, wird es zusehends abstruser. Da gibt es Ausgaben in Menschenhaut gebunden, auf Papyrus gedruckt und mit Blut signiert. Eine Sonder-Sonderausgabe ist grauenhafter als die nächste und die Krönung seiner Sammlung ist die Ausgabe … doch das soll hier natürlich nicht verraten sein.
Newmans Erzählung ist eine wunderbar spritzige und dabei bitterböse Abrechnung mit fanatischen Fans aller Art. Die gesammelten Objekte sind ein Fetisch, ein Kunstwerk in sich und es wäre ein Sakrileg, würde der Sammler sie aus dem Regal nehmen und tatsächlich lesen. Ja, er habe sich Barkers [„Bücher des Blutes“ 538 mal aus der Bibliothek ausgeliehen und die Geschichten seien auch gut gewesen. Aber gehen wir lieber zu dieser Sonder-Sonderausgabe über … Das Objekt der Begierde kann vollkommen willkürlich gewählt sein, denn es scheint nicht, dass unser Sammler eine besondere Vorliebe für Pulp hat – offensichtlich liest er ja nicht mal. Doch wenn das Objekt erst einmal gewählt wurde, dann muss es besessen und beherrscht werden.
Marianne Groß (bekannt als Synchronstimme von Angelica Huston, Merryl Streep, Whoopie Goldberg) ist neu als Sprecherin bei LPL und nach ihrem Debüt auf „Necrophobia“ möchte man doch hoffen, dass sie den Hörbuchfans lange erhalten bleibt. Mit spitzer Zunge referiert sie die gesammelten Absurditäten der Barker-Sammlung und man hört ihr die Verachtung für derartiges Fanverhalten geradezu an. Ein wahres Fest!
Abgeschlossen wird CD1 mit einer kurzen Erzählung über ein altes Thema: „Rettungslos“ (1903) von Paul Busson beschreibt aus der Ich-Perspektive einen Mann, der lebendig begraben wurde. Neu ist an dieser Idee kaum etwas, doch schafft es Busson zumindest, das Grauen durch seinen Stil greifbar zu machen. Da dem Protagonisten nur noch sein Gehör zur Verfügung steht, schildert er hauptsächlich diese Eindrücke. Das Schließen des Sargdeckels, das Geräusch, als die Trauernden Erde auf den Sarg fallen gelassen wird – und erst dann, begraben unter ein Paar Metern Erde, kann er endlich zwei seiner Finger wieder bewegen. Doch natürlich zu spät.
Lutz Riedel, ebenfalls seit langem für LPL tätig, liest „Rettungslos“. Leider ist die Geschichte so schnell vorbei, dass man sich kaum eingehört hat. Doch Riedel (Stimme u. a. von Timothy Dalton; mit Marianne Groß liiert) schafft es, den eindringlichen Bewusstseinsstrom des Protagonisten ebenso eindringlich wiederzugeben. Ein beunruhigendes Finale für die erste CD der Anthologie.
Auf CD2 geht es mit dem Altmeister subtilen Horrors weiter, nämlich mit „Der Außenseiter“ („The Outsider“, 1926) von H.P. Lovecraft. Wer nicht ohnehin schon die Lovecraft-Hörbuchreihe von LPL im Regal stehen hat, der wird hier ordentlich angefüttert. Ein recht geheimnisvoller Ich-Erzähler – geheimnisvoll in dem Sinne, dass er sich nicht erinnern kann, wie wo und mit wem er eigentlich aufgewachsen ist -, versucht seiner Umgebung zu entrinnen. Er wohnt nämlich in einem unheimlichen Schloss, das so von Bäumen umstanden ist, dass er noch nie Sonne oder Mond gesehen hat. Also steigt er auf den höchsten Punkt des Schlosses, öffnet eine Falltür und … muss mit einer ziemlichen Überraschung fertig werden.
Der Erzählung merkt man schon nach den ersten Sätzen den Lovecraft’schen Stil an und nie verfehlt er seine Wirkung. Surreale Settings, lauernde Schatten, offene Fragen – all das verbindet Lovecraft mit einer Meisterschaft, die auch heute noch menschliche Urängste anspricht und zum Vorschein bringt. Man kann sich also eines unfreiwilligen Schauderns nicht erwehren, auch wenn man die Pointe der Geschichte schneller durchschaut als der Ich-Erzähler. Lovecrafts genialer Einfall, die Geschichte aus der Innenansicht des vermeintlichen Monsters zu erzählen, verwischt die sonst so klaren Grenzen einer Horrorgeschichte und trägt zum Gruselfaktor unbedingt bei.
David Nathan (Johnny Depp, „Spike“, Christian Bale,) als Sprecher ist ebenfalls seit einiger Zeit bei LPL dabei – zu Recht, versteht sind, denn seine Bandbreite weiß immer wieder zu überraschen. Mit viel Einfühlungsvermögen gibt er den Bericht des Außenseiters wieder und schafft Balance zwischen Mitgefühl und Abscheu.
Den Abschluss bildet die grausig-schwüle Slashergeschichte „Summertime“ („Fish are Jumping, and the Cotton is High“, 1996) von S. P. Somtow, die idyllisch genug beginnt: Vater und Sohn verbringen wie jedes Jahr den Sommer damit, durch das amerikanische Hinterland zu fahren und zu fischen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass an der ganzen Sache nichts idyllisch ist. Zum einen führen die beiden das Skelett ihrer toten Oma in einem Koffer mit, stauben sie regelmäßig ab und behängen sie mit Wunderbäumen (gegen den Gestank natürlich). Zum anderen handelt es sich bei „fischen“ um einen Euphemismus dafür, Huren zu entführen, sie brutal zu foltern und dann zu töten. Alles im Namen des Herrn, versteht sich. Denn der Serienmörder ist ein religiöser Fanatiker.
Somtow liefert eine durchdachte Geschichte, die zwar große Mengen Blut produziert (und damit die hartgesottenen Fans begeistern dürfte), aber nicht vergisst, den beiden Hauptcharakteren ausreichend psychologischen Hintergrund mitzugeben, um die Geschichte zu tragen. Wenn Somtow also in die völlig zerstörte Psyche des Protagonisten eintaucht, dann ist das abwechselnd absurd, komisch, schockierend und eklig. „Summertime“ bildet einen wunderbaren modernen Gegensatz zu so polierten Erzählungen wie Lovecrafts „Der Außenseiter“ und trägt „Necrophobia“ sowohl thematisch als auch stilistisch ins 21. Jahrhundert.
Torsten Michaelis (als Synchronstimme von Wesley Snipes offensichtlich total unterfordert) liest hier aus der Perspektive des Sohnes des Serienmörders und fängt dessen gestörte Wahrnehmung der Realität grandios ein. Mit kindlicher Naivität findet er es ganz selbstverständlich, die tote Oma im Auto mitzuführen und die knackigen Hinterteile der toten Huren zu essen (um die Leichen zu entsorgen und weil das Fleisch dort am leckersten ist).
Über einen Anspruch wie „die besten Horrorgeschichten der Welt“ wird man immer streiten können. Doch ohne Frage überzeugt die Auswahl der Geschichten, sind sie doch in Thema und Stil jeweils sehr unterschiedlich und bieten somit für jeden Geschmack etwas. Abgerundet wird die Anthologie von hochkarätigen Sprechern, die die 146 Minuten Spielzeit zu einem unheimlichen Vergnügen machen!
http://www.lpl.de
Lieckfeld, Claus-Peter/Rößiger, Monika – Mythos Meer. Geschichten – Legenden – Tatsachen
Was ist das Meer – und was bedeutet es dem Menschen? Diesen Fragen wird von den Autoren in vier Hauptkapiteln nachgegangen.
„Der blaue Planet“ (S. 8-54): Stolze 71 Prozent der Erdoberfläche bedeckt das Meer und verleiht ihr (neben der atmosphärischen Lichtbrechung) die berühmte blaue Färbung. Kein Wunder, dass Wasser diesen Planeten formt. Drei Ozeane prägen ihn und seine Bewohner, die seit Urzeiten am und vor allem vom Meer leben. Wir lernen die exotischen Nischen unserer feuchten Parallelwelt (Riff, Wellen, Küste, Watt, Eismeer) kennen und erfahren, wie der Mensch sich allmählich vorwagte (Schwimmen, Tauchen, Segeln).
„Die Kreaturen“ (S. 55-146): Das umfangreichste Kapitel beschäftigt sich erwartungsgemäß mit den faszinierenden, wohlschmeckenden und erschreckenden Wesen, die sich knapp über bis weit unter der Meeresoberfläche eingerichtet haben. Haie, Pinguine, Robben, Wale und Delfine gehören dazu, aber auch bizarre Tiefsee-Getüme oder eher halbseidene Wasserbewohner wie die Seeschlange oder der Riesentintenfisch. Unerwartet Interessantes gibt es auch über „Langweiler“ wie den Aal, das Seepferdchen oder die Muschel zu berichten.
„Die Schätze“ (S. 147-176): „Schatz“ ist ein mehrfach interpretierbarer Begriff. Klassisch geht es natürlich um Gold, Edelsteine und andere Kostbarkeiten, die an Punkt A geraubt und zusammengerafft und auf dem Weg nach Punkt B im Meer versanken. Wertvoll sind aber auch die natürlichen Ressourcen der Ozeane – die Fische, ohne welche die Ernährung der Menschheit ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Zu den ökologischen Schätzen des Meeres gehören die Korallen, welche dem Leben unter Wasser eine Basis bieten, die der zerstörungswütige Mensch vernichtet und eine tote, blaue Öde zurücklässt. Schließlich sind da die wissenschaftlichen Werte, die erfasst und ausgewertet buchstäblich Aufschluss über die Entstehung der Arten geben: Galapagos, die Inselgruppe im Pazifik, ist ein riesiges natürliches Versuchslabor.
„Mythen, Märchen und Legenden“ (S. 177-214): Was der Mensch nicht versteht oder fürchtet, das kleidet er (sie natürlich auch) gern in allgemein verständliche Bilder. Die Seeleute der Vergangenheit befuhren eine fremde, oft schrecklich feindselige Welt, die sie von Klabautern, Sirenen und Meerjungfern besiedelt sahen, die nur auf den Unglücklichen lauerten, der einen Fehler beging. So hielt man die Regeln ein und die Augen offen. Grundsätzlich hat sich an diesem Verhalten wenig geändert, wie die Autoren am Bespiel der berühmt-berüchtigten „Bermudadreiecks“ belegen. Atlantis findet selbstverständlich Erwähnung, die biblische Sintflut und andere antike Katastrophen, die als Mythen bis heute überlebten. Zwischendurch tauchen noch die Wikinger auf, die den Unbilden des Meeres mit erstaunlichen Methoden trotzten und so ihrerseits zur Legende wurden.
Mit einem ordentlicher Anhang (Literatur-, Stichwort- und Quellenverzeichnis, Autorenporträt und Bildnachweis), der „Mythos Meer“ als Buch „arbeitstauglich“ macht, klingt die Darstellung aus.
Kunterbuntes aus dem und über das Meer – dieser Titel würde „Mythos Meer“ sicher besser gerecht. Er klänge freilich leicht abwertend, was dieses Buch nicht verdient hätte. Eine grundsätzliche Sammlung aller Fakten war weder möglich noch beabsichtigt. Auch das Rad wurde nicht neu erfunden, wie der Blick ins Literaturverzeichnis beweist: Bereits bekanntes Sachbuchwissen wurde ausgewertet und neu arrangiert.
In Ausschnitten nähern sich die Autoren ihrem Thema. Über die Auswahl lässt sich sicherlich diskutieren – nur bedingt will sich beispielsweise erschließen, wieso das Unterkapitel „Seepferdchen“ volle sieben Seiten umfasst. (Aha, Verfasser Lieckfeld ist auch Mitautor eines Buches namens „Mythos Pferd“; ob das etwas damit zu tun hat …?) Und das Subkapitel „Terra – Meer- oder landgeboren“ gehört eindeutig in den ersten Buchteil.
Doch bei näherer Betrachtung finden wir die meisten Dinge, die wir mit dem Meer in Verbindung bringen, wenigstens angesprochen. Die einzelnen Kapitel lassen sich auch für sich sehr informativ lesen. Dabei wird der Leser vom angenehmen Plauderstil des Textes unterhalten, den man keineswegs mit inhaltsschwachem Geplapper verwechseln darf: Fakten werden klar dargestellt und harter Stoff ist es manchmal, der mit erfreulich klaren Worten allgemeinverständlich aufgerollt wird.
Ein Sonderlob verdienen die Abbildungen. Für „Mythos Meer“ wurde durchgängig schweres Kunstdruckpapier verwendet. Die zahlreichen, oft großformatigen, meist bunten und gut ausgewählten Fotos, Grafiken und Karten sind gestochen scharf. Sie dienen auch nicht dem Zweck, den Text „auf Länge“ zu bringen, sondern bilden ihrerseits zusätzliche „Informationsinseln“. Es sind aufregende, selten oder nie gesehene Aufnahmen darunter, die sichtlich jüngeren Datums sind.
Klaus-Peter Lieckfeld (geb. 1948) ist freier Journalist mit dem Themenschwerpunkt „Belebte Natur“, schreibt aber auch historische Romane. Monika Rößinger ist Biologin und ebenfalls Wissenschaftsjournalistin in Hamburg.
Torsten Sträter- Hämoglobin (Jacks Gutenachtgeschichten 1)
Irgendwie ist Torsten Sträter ein kleines Phänomen, seines Zeichens Autor der beiden Kurzgeschichtensammlungen „Hämoglobin“ und „Postkarten aus der Dunkelheit“. Er ist deshalb ein Phänomen, weil er es blind schafft, in kürzester Zeit Schreckensszenarien ungeahnten Ausmaßes zu erschaffen und diese entweder zum guten oder auch zum bitteren Ende hin mit beißender Ironie und jeder Menge pechschwarzen Humors aufzulösen. Sträter holt sich dabei viele Ideen aus zeitgenössischer wie auch klassischer Zelluloidware, zieht sich aber auch Grundgerüste seiner Storys aus dem banalen Alltag. So ist zum Beispiel seine Geschichte ‚Mr. Daniels und ich an der Tankstelle der lebenden Toten‘ eine beißende Parabel auf die heutige Konsumgesellschaft und das Problem des Menschen, als Funktionsobjekt seinen täglichen Gang antreten zu müssen. Auf der anderen Seite steht mit ‚Der Mitbewohner‘ eine klassische Werwolfstory oder mit ‚Der Geruch von Blau‘ eine Geschichte, die dem Vampir sein unsterbliches und grauenvolles Gesicht zurückgibt. Der Protagonist in ‚Jägerlatein‘ gewährt einen kurzen Einblick in seine kranke, dem Wahnsinn verfallenen Psyche.
Anders als in seinem zweiten Band, begibt sich Sträter mit „Hämoglobin“ noch nicht so stark auf die phantastische Seite, sondern verwurzelt seine Kurzgeschichten überwiegend im Hier und Jetzt. Dabei forciert Sträter Kindheitsängste, wie die Angst vor der Dunkelheit oder die Verlustangst, bis ins Endlose und zieht meist sehr unterschwellig, aber letztendlich unaufhaltsam die dramaturgische Schlinge um den Leserhals zu. Die Auflösungen der Storys sind eigentlich immer sehr ironisch und tiefschwarz, wobei sich jeder Zyniker bei Sträter auf der sicheren Seite fühlen dürfte.
Hinzu kommt Sträters in meinen Augen unverwechselbarer Schreibstil, zu dem selbst der Begriff „blumig“ als Umschreibung mehr als untertrieben scheint. Wenn Herr Sträter so richtig loslegt und seine lyrischen Ergüsse durch Splatterfelder und Knochengebirge jagt, könnte Zartbesaiteten schon mal die Magensäure retour aus dem Hals quellen. Liebhaber klassischer Gruselkost sollten also die Finger von Torsten Sträter lassen. „Hämoglobin“ beherbergt zehn hundertprozentige Horrorstorys mit dem Blutgehalt einer Schlachtbank. Dabei werden einem die Bilder durch den hammerharten Schreibstil fast manifest im Kopf geparkt. Mann, was würde ich gerne mal die Verfilmung einer Sträter-Geschichte in der Flimmerkiste sehen! Das geht ganz sicher ab wie Schmitts Katz‘. Allerdings benötigte man dann einen Regisseur, der die leichenfledderige Ironie eins-zu-eins auf sein Medium übertragen könnte. Und da fällt mir leider Gottes kein einziger ein.
Lange Rede, gar kein Sinn: „Hämoglobin“ ist Horror, Spaß, Witz, Ekel und Gore im Überfluss. Zehn fremde Welten, die sich kurz und knapp vor dem geistigen Auge erschließen und einem das Grauen in seiner derbsten Form vorführen. Wer sich auf den sehr eigenen Witz von Torsten Sträter einlassen kann, wird an seiner horriblen Kost sicherlich mehrfach satt werden.
Da sehe ich auch gerne mal über die orthographischen und grammatikalischen Schnitzer hinweg, die mehr als nur einmal auf den Seiten verewigt sind.
Taschenbuch: 184 Seiten
Richardson, Hazel – Dinosaurier und andere Tiere der Urzeit
3,5 Milliarden Jahre Leben auf dem Planeten Erde, zusammengefasst auf 223 Text- und Bildseiten: Das funktioniert nur mit Hilfe einer klaren, streng durchgehaltenen Strukturierung. „Dinosaurier“ beginnt mit einer Einführung, welche den absoluten Anfang des Lebens umreißt. Dieses ist primitiv, die Kenntnisse sind dürftig, so dass die frühen erdgeschichtlichen Epochen nur summarisch bzw. als Überblick vorgestellt werden.
Ab dem Mesozoikum beginnt es sich im Wasser, auf dem Land und schließlich in der Luft zu tummeln. Mit der Konzentration auf die Wirbeltiere, deren Körper ein Knochengerüst stützt und die Luft atmend sind, präsentiert „Dinosaurier“ im Hauptteil ca. 200 der für ihre Zeitalter wichtigsten Tierarten, die auf der Erde lebten. Das schließt Dinosaurier ebenso ein wie ihre „Nachfolger“, die Säugetiere und Vögel. (Amphibien und Fische, die ebenfalls Wirbeltiere sind, glänzen durch Abwesenheit.) Sie dominieren das Känozoikum, das bis in die geologische Gegenwart reicht.
Über jede Zeitperiode wird auf einer Doppelseite informiert. Klima, Geologie, Vegetation, Tierwelt insgesamt werden charakterisiert. Die „Steckbriefe“ der einzeln vorgestellten Tiere umfassen eine halbe bis zwei Seiten und fassen die Schlüsselinformationen zusammen. Eine fotorealistische, auf aktuellen Forschungsergebnissen fußende Rekonstruktion setzt die Kreaturen der Vorzeit lebensecht ins Bild. Pfeile weisen auf besondere körperliche Beschaffenheiten hin. Eingefügte Fotos echter Fossilien (Knochen, Schädel, Zähne etc.) werden ihnen zum Vergleich gegenübergestellt.
Stets gibt es eine Karte, auf der die wichtigsten Fundstellen von Fossilien des Tiers verzeichnet sind. Eine Schemazeichnung zeigt es im Größenvergleich mit dem Menschen. Größe, Gewicht und Nahrung werden in einer Fußleiste angegeben. Auch eine Kopfleiste gibt es; sie hält den wissenschaftlichen Namen der Tierordnung und der Familie sowie den Zeitraum fest, in dem das jeweilige Tier lebte. Kopf- und Fußleiste sind farbcodiert. Oben lässt sich die jeweilige Zeitperiode erkennen, in der das Tier existierte, unten sein Lebensraum (Land, Wasser oder Luft).
Darüber hinaus gibt es Extra-Doppelseiten, die Tiergattungen zeigen, welche einer besonderen Erwähnung wert sind. Der Text geht über die Standardinformationen hinaus, das Bild zeigt die einzelne Tierform in seiner zeitgenössischen Umgebung. Ein erster Anhang listet mehr als 300 weitere Dinosaurier (und nur Dinosaurier) auf, die im Hauptteil keine Berücksichtigung fanden. Anhang 2 ist ein Glossar, das die reichlich Verwendung findenden naturwissenschaftlichen Fachausdrücke „übersetzt“. Ein Register, mit sich das Buch erschließen lässt, fehlt selbstverständlich auch nicht.
Das Buch weist eine solide Fadenheftung auf, das Cover ist indes flexibel: Auch in Gestalt und Format gibt sich „Dinosaurier“ als „Bestimmungsbuch“, ideal für den interessierten Tierbeobachter, der damit den abgebildeten Wesen in der freien Natur nachpirscht, was sich hier freilich als frustrierendes Vorhaben herausstellen könnte …
Oh ja, sie haben sich schon sehr verwandelt, die „Tierbücher“, mit denen Ihr Rezensent groß geworden ist! Auch damals – die exakte erdgeschichtliche Epoche bleibt besser verschwiegen – galten Bücher über Dinosaurier schon als Renner. Ihre Wirkung mussten sie jedoch als vergleichsweise primitiv wirkende Zeichnungen entfalten, die nicht selten sogar schwarzweiß ausgeführt waren. Im Vergleich mit den modernen, fotorealistischen, digital bearbeiteten Rekonstruktionen wirken diese altehrwürdigen Abbildungen wie Höhlenzeichnungen. Dass sie ihre Wirkung dennoch nicht verfehlten, spricht für die Faszination des Dinosaurier-Themas.
So wird auch dieses sich arg trocken lesende Werk seine Leser finden. Wie ich aus eigener Beobachtung weiß, finden beispielsweise Kinder die enzyklopädische Auflistung möglichst vieler Donnerechsen fabelhaft. Sie schätzen die kurzen Texte, deren Informationen sie förmlich aufsaugen, und lieben die Bilder. Das geht uns anspruchsvoll gewordenen Erwachsenen genauso. In einer Zeit, da die Tricktechnik völlig überzeugende Urweltlandschaft samt Bewohnerschaft erstehen lassen kann, werden dem Zuschauer oder Leser grandiose Rekonstruktionen geboten. Besonders die „Sonder-Doppelseiten“, auf denen die Urzeittiere in ihre Umwelt integriert werden, sind von enormer Suggestionskraft. Ob diese „Fotos nach dem Leben“ eine Wirklichkeit vorgaukeln, die spätere Forschergenerationen ganz oder teilweise revidieren müssen, steht auf einem anderen Blatt und soll hier undiskutiert bleiben.
Wegen seiner fragmentarisch anmutenden Struktur kann „Dinosaurier“ an jeder beliebigen Stelle aufgeschlagen und gelesen werden. Andererseits ist es durchaus möglich, sich von der ersten zur letzten Seite durchzuarbeiten. Es gibt einen roten Faden, den Erdgeschichte und Evolution vorgeben. Die Konzentration aufs Wesentliche bedingt komprimierte Texte, die sich alles andere als spannend lesen. Informativ sind sie auf jeden Fall und sollen sie sein – diese Entscheidung gegen das heute so beliebte „Infotainment“, die oftmals mit einer freiwilligen Beschränkung auf das angebliche Typische, vor allem Spektakuläre einhergeht, kann nur begrüßt werden.
Noch ein Pluspunkt: Trotz der guten Ausstattung und der Vielzahl fast ausschließlich farbig wiedergegebener Abbildungen ist der Preis für „Dinosaurier“ erfreulich moderat. Da nimmt man in Kauf, dass einige Bilder nicht wirklich „kommen“, weil sie doch ein größeres Format benötigten. Manchmal muss man sich auf briefmarkengroße Motive konzentrieren, die davon ganz sicher nicht profitieren. Allzu intensiv vermittelt sich darüber hinaus oft der Eindruck drangvoller Enge. So viele Abbildungen werden gezeigt, dass der Raum für Text darunter leidet. Besonders die vom Hintergrund freigestellten Saurier- und Säugerrekonstruktionen bohren sich förmlich in die Textblöcke, die dann abenteuerlich flatternde Ränder aufweisen. Bedenkt man den ohnehin klein gewählten Schriftgrad, so müssen die Leseraugen ordentliche Leistungen erbringen …
Dennoch überwiegen die Vorteile, die „Dinosaurier“ zu einem kompakten, handlichen Buch machen, das aktuell und zeitgemäß sein Thema angeht und deshalb weiterempfohlen werden kann und gern wird.
Baldry, Cherith – venezianische Ring, Der
Die im englischen Lancaster geborene Schriftstellerin Cherith Baldry, die zuvor als Lehrerin arbeitete, stellt mit „Der venezianische Ring“ (Original: The Reliquary Ring) die Übersetzung eines ihrer ersten Werke als Berufsautorin vor.
In einer zeitlich nicht näher bestimmten Stadt der Zukunft, die mit ihren Kanälen und ihrer Herrschaftsstruktur an das alte Venedig des 18. Jahrhunderts erinnert, zeigt sie dem Leser eine düstere Gesellschaft, in der Standesdünkel und Rassismus den künstlich erzeugten Genicos das Leben schwer machen. Doch auch die Technologie, insbesondere Genetik, verteufelnde Kirche kann den Fortschritt nicht aufhalten. So halten sich viele Adelige Genicos als Haussklaven, auch wenn man peinlich darauf achtet, sich nicht von ihnen berühren zu lassen.
Im Spiel um die Macht in der Stadt bedient sich der gottlose Graf Dracone bedenkenlos aller Mittel, um sein Ziel zu erreichen. Der alte Herzog liegt im Sterben, und gegenüber dem verarmten Mitbewerber Graf Loredan hat er einen Trumpf im Ärmel:
Der exkommunizierte Doktor Heinrich soll für ihn aus einem Haar einen Klon Christos‘, Gottes Sohn auf Erden, erzeugen.
_Groschenoper in Venedig_
Die Geschichte wartet mit einer breiten Zahl von Charakteren auf, deren Gemeinsamkeit ihr durch den Grafen Dracone erfahrenes Leid ist. Viele Tabuthemen werden aufgegriffen; so liebt der Genico Gabriel seinen Herren Leonardo, was aber in den Augen der Kirche eine doppelte Sünde ist, die diesem bei der Herzogswahl zum Nachteil gereichen würde. Die schöne Genica Serafina wird wie eine Art kostbares Möbelstück von ihrer verstorbenen Herrin einfach weitervererbt, ihr wunderbares Gesangstalent wird mit niederen Näharbeiten vergeudet. Die Handlung wird von zahlreichen Mensch-Genico-Paaren vorangetrieben, die einen sind ihren Herren oft gar in Liebe zugeneigt, andere werden kontrastierend schlecht behandelt.
Von Anfang an als Schurke klar erkennbar ist der düstere Graf Dracone, der sich der Hinterlist und brutaler Gewalt gleichermaßen bedient und vielen Genicos mitsamt ihren Herren übel mitspielen wird. Damit hat sich seine Rolle aber auch erschöpft. Er ist zugleich die einzige, immerwährende Quelle des Übels in der Stadt, neben dem allgemeinen Rassismus der Menschen gegenüber den Genicos.
Betrachtet man die zahlreichen Liebesbeziehungen im Spiel um die Macht und die klare Charakterzeichnung, kommt man recht schnell zu der Erkenntnis, um welche Art Roman es sich hier handelt. In einer parabelhaften Weise wird das Leid der stets wunderhübschen oder hochbegabten Genicos der Grausamkeit der rassistischen menschlichen Gesellschaft gegenübergestellt. Dabei sind alle Charaktere von Anfang an als Sympathieträger oder Antagonisten erkennbar, eine Charakterentwicklung findet bei keiner Figur statt.
Nun soll das nicht heißen, der Roman wäre schlecht oder gar langweilig. Er ist leider schrecklich offensichtlich angelegt, die etwas altbackene Art der Charakterisierung ist offensichtlich ein Stilmittel zur Verdeutlichung der klaren Gegensätze. Damit könnte man gut leben, aber leider gibt es diese Stereotypen auch in jedem x-beliebigen Groschenheftchen. Allerdings versteht es Baldry meisterlich, zahllose Erzählstränge nebeneinander parallel zu erzählen und so für Abwechslung zu sorgen. Die Möglichkeiten, die das faszinierende Pseudo-Venedig Baldry bot, hat sie aber leider überhaupt nicht ausgekostet. Man hätte den Roman auch in eine beliebige andere Stadt verlegen können, denn außer zum Ersäufen und spurlosen Beseitigen von Leichen werden die Kanäle der Stadt nicht genutzt, sieht man von einer eher belanglosen Episode mit Meeres-Genicos ab.
Gegen Ende des Romans sorgt zusätzlich ein nahezu wortwörtlicher Deus ex Machina für Ordnung in der Stadt und den Sieg der Guten über die Bösen. Nicht gerade sehr einfallsreich, zumal am Ende des Romans ein ziemlich unbefriedigendes Gefühl bestehen bleibt, wenn sich alles urplötzlich in Wohlgefallen auflöst.
_Fazit:_
Das faszinierende Szenario einer an ein Parallelwelt-Venedig erinnernden Stadt wird leider kaum ausgereizt, die Charaktere sind Stereotypen in Reinkultur. Dass sie durchweg sympathisch und abwechslungsreich beschrieben sind, kann darüber kaum hinwegtäuschen, sie machen aber den Großteil des Charmes des Romans aus. Nur gelegentlich kommt mäßige Spannung auf, das sehr billig herbeigeführte Happy-End kann ebenfalls nicht überzeugen.
Wer sich damit zufrieden gibt, wird leidlich gut bedient. Schade, in meinen Augen hätte der zugrundeliegende Weltentwurf Möglichkeiten für weit mehr geboten als nur einen weiteren mäßigen Groschenroman, dem man ansonsten nur die vorzügliche Übersetzung von Irene Bonhorst zugute halten kann. Der Klappentext, der den Roman in die Tradition Dan Browns und John F. Cases stellt, ist zudem bewusst irreführend: Dieser Roman ist keinesfalls mit denen Dan Browns zu vergleichen, ein bisschen Kirche und Okkultismus qualifizieren nun wirklich nicht dazu. Qualitativ kann man ihn ebenfalls nicht in der Liga dieser Erfolgsautoren ansiedeln.
Kinkel, Tanja – Götterdämmerung
Ein guter amerikanischer Thriller aus deutschen Landen, Götterdämmerung soll genau so etwas sein. Pharmakonzerne, CIA, ein investigativer Journalist und eine schöne junge Frau, die es eigentlich gar nicht geben kann. Da grüßen die bekannten Thrillerautoren, aber Tanja Kinkel kann über weite Teile gut mit ihnen mithalten.
Dies ist die Geschichte von Neil LaHaye, einem Journalisten und Schriftsteller, der einmal mit investigativen Büchern unter anderem über die Krebsopfer von Atombombenversuchen berühmt wurde. Das letzte Buch war über Guantanamo, und das war gar nicht nett. Deswegen ist er jetzt verrufen, deswegen hat er seine Frau verloren – die leider die Stabschefin eines Senators ist. Dann kommt ihm ein neues Thema auf die Tastatur: AIDS. Und dort findet er die Spur eines genialen Wissenschaftlers, des Exilkubaners Victor Sanchez. Sein journalistischer Spürsinn springt an, er geht auf die Suche.
In Alaska sitzt am anderen Ende eines medizinischen Chats Beatrice Sanchez, die Tochter des Genies. Die beiden beginnen einen lebendigen Austausch von Wissen und flirten auch ein bisschen miteinander. Neil ist aber auch sonst nicht untätig, fährt nach Miami, wo Sanchez früher wohnte und interviewt einen alten Freund. Währenddessen entdeckt Beatrice auch eine ganze Menge über sich, denn ihre Herkunft und ihre Lichtallergie, die ihr immer wieder eingeredet wurde, sind nicht ganz so echt.
Bald begegnen sich die beiden auch, und irgendwann explodiert die ganze Geschichte in ein Finale, das dem Buch den Namen gab: Götterdämmerung.
Tanja Kinkel hat da eine Geschichte geschrieben, die vielleicht nicht an Dan Brown in Sachen Spannung heranreichen kann, aber auch in hohem Tempo gelesen werden möchte. Schicht auf Schicht wird eine Überraschung auf die andere gestapelt, manchmal mit feiner Klinge, manchmal mit der schweren Keule werden die Schichten zerstört und damit dem Leser aufgezeigt. Das ist alles sehr lesbar, nicht allzu oft humorvoll, aber insgesamt stimmig. Allein, die Glaubwürdigkeit ist doch in vielem beschädigt, zu weit hergeholt die eine oder andere Tatsache, vor allem zu abgedreht das Ende, denn diese Götterdämmerung nimmt nicht wie erhofft den Atem, sondern wirkt irgendwie künstlich angedockt. Nebenbei gibt es zwischendurch das eine oder andere Detail, das nicht so ganz aufgeklärt wird – was hat es zum Beispiel mit dem zweiten auffälligen Ford auf sich? Warum ist es dieses Auto?
Das vielleicht unbrauchbarste ist die völlige Offenheit, die am Ende bleibt – kein Zweifel, es ist völlig in Ordnung, ein offenes Ende zu schreiben, aber damit fällt Beatrice zumindest hinten runter; was ist mit dieser zweiten Hauptfigur, was kann ihr passiert sein? Über die letzten sechzig Seiten kommt sie nicht vor, da stimmt doch etwas im Handwerk nicht, oder?
Vielleicht ist das noch der kleine Unterschied zu den angelsächsischen Thrillerautoren, die bleiben da doch etwas stimmiger. Ein spannendes Buch, das sein Geld durchaus lohnt, denn 500 Seiten gute Spannung sind ja schon etwas, aber kein Buch, das man nie mehr vergisst.
_Holger Hennig_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de/ veröffentlicht.|
[Verlagsseite zum Buch]http://www.droemer-knaur.de/sixcms/detail.php?id=20578
Gaiman, Neil – American Gods
Neil Gaiman wandelt mit einer gewissen Vielseitigkeit durch die literarische Welt. Bekannt wurde Gaiman zunächst einmal als Autor der vielgepriesenen Comicreihe „Sandman“ (immerhin die meistausgezeichnete Comicreihe der Welt), bevor er sich als Romanautor einen Namen machte. Sein Roman „Niemalsland“ wurde als TV-Serie von der BBC verfilmt, das Buch „Ein gutes Omen“ schrieb er in Zusammenarbeit mit Terry Pratchett und seinem guten Freund Douglas Adams widmete er die Biographie [„Keine Panik!“. 1363 Über Gaimans literarische Vorlieben sagt dieser grobe Überblick schon so einiges aus. Ein wenig fantastisch, ein wenig skurril und auf seine ganz eigene Art immer liebenswürdig erzählt.
In dieser Tradition steht auch „American Gods“. Keine blütenreine Fantasy, sondern ein Mix mit vielerlei Einflüssen. Eine Prise Thriller, ein Schuss Fantastik, abgeschmeckt mit einer großen Portion Roadmovie. Das ist die Mischung, die Neil Gaiman mit „American Gods“ auffährt.
Erzählt wird die Geschichte von Shadow, dem nach drei Jahren Gefängnis die Haftentlassung bevorsteht. Das Leben in Freiheit hatte er sich allerdings ein wenig anders vorgestellt, denn am Tag vor der Entlassung verunglückt Ehefrau Laura mit seinem besten Freund Robbie auf etwas pikante Art tödlich. Shadow steht damit vor dem Nichts. Mit Robbies Dahinscheiden ist auch Shadows Job als Fitnesstrainer in dessen Fitnessstudio weg und mit Lauras Tod scheint ihn ganz allgemein das Glück verlassen zu haben.
Unter recht merkwürdigen Umständen trifft er in dieser Situation einen älteren Herrn namens Wednesday, der ihm recht aufdringlich einen Job als Chauffeur anbietet. Mangels Alternativen und nach anfänglichem Widerwillen nimmt Shadow das Angebot an und stürzt sich damit in eine Reihe ereignisreicher Monate. Wednesday entpuppt sich als der mythische Allvater Odin, der zusammen mit Shadow kreuz und quer durch die USA zieht, um hinter sich die dort versammelten Gottheiten für eine letzte Schlacht zu gewinnen. Gegner sind die modernen Götter des Fernsehens, des Internets und der Technologie. Ein Sturm zieht herauf, der alles zu verändern droht und mittendrin in dieser Götterdämmerung steht Shadow …
In epischem Format breitet Gaiman die Geschichte vor dem Leser aus. Gemächlich baut er die Handlung auf, führt Götter und Hauptfiguren ein und webt einen kontinuierlich aufwärts strebenden Spannungsbogen. „American Gods“ ist schon ein recht dicker Brocken geworden, was sowohl Vor- als auch Nachteile hat.
Besonders intensiv begleitet Gaiman seinen Protagonisten Shadow, angefangen von dessen letzten Stunden in Haft. Shadow ist eine durchweg sympathische Hauptfigur, die auf den ersten Blick manchmal ein wenig naiv wirken mag, sich aber bei näherer Betrachtung durch eine gewisse Bauernschläue auszeichnet. Shadow ist gerissener und cleverer, als man es ihm im ersten Moment zutraut, behält aber den ganzen Roman über ein recht hohes Maß an Bodenständigkeit, was in Anbetracht seiner Erlebnisse beileibe keine Selbstverständlichkeit ist.
So kurios die Dinge auch sein mögen, die Shadow passieren, er nimmt das alles relativ gelassen. Und Shadow hat so einiges mehr an merkwürdige Dingen zu ertragen. Immer wieder wird er von sonderbaren Träumen geplagt, deren Bedeutung sich erst im Laufe des Buches herauskristallisiert. Seine verschiedene Ehefrau Laura stattet ihm, etwas blass um die Nase zwar, aber scheinbar lebend, bzw. zumindest nicht so richtig tot, immer wieder Besuche ab. Seine Arbeit für den Allvater Odin mag da schon fast als natürlich erscheinen.
Zusammen mit Wednesday begibt sich Shadow auf eine Reise kreuz und quer durch die USA, auf der er seltsame Erfahrungen sammelt und den sonderbarsten Gottheiten begegnet. Das Auftreten der unterschiedlichsten Gottheiten ist dabei eine unverkennbare Stärke des Romans. Gaiman zeigt, wie diese Gottheiten, die aus allen Teilen der Welt stammen, in der realen Welt leben. Von der Menschheit nicht mehr beachtet und nicht mehr geehrt, fristen sie teilweise ein recht trostloses, geradezu menschliches Dasein in den USA. So haust beispielsweise der slawische Gott Tschernobog als pensionierter Schlachthofangestellter in Chicago, während die hübsche Bilquis, ehemals die Königin von Saba, sich ihren Unterhalt als Prostituierte verdient. Gaiman skizziert allerlei skurrile Portraits, so dass die Zeichnung der Figuren in jedem Fall ihren Reiz hat. Gaiman wandelt auf einem schmalen Grat zwischen Fantasy und bekannten Mythen und spinnt daraus eine ganz eigene, reizvolle Geschichte. Damit der Leser zwischen den vielen Figuren und Gottheiten nicht den Überblick verliert, gibt es obendrein am Ende ein Götter-Glossar.
Die Handlung selbst überzeugt dabei je nach Ausprägung unterschiedlich. Gaiman arbeitet sich durch einen recht komplexen Stoff, mit vielen Haupt- und Nebenfiguren, und manchmal erweckt der Roman ein wenig den Anschein, als würde er sich dabei verzetteln. Immer wieder schiebt er neue Handlungsstränge ein, setzt zu Zwischenspielen an und lässt seine Figuren auf unterschiedlichen Handlungsebenen agieren. Das hat zwar durchaus seinen Reiz, ist aber manchmal etwas viel des Guten, denn nicht immer wird dabei die Geschichte so konsequent weitergeführt, wie man es sich als Leser wünschen möchte.
So schleichen sich an manchen Stellen kleinere Längen ein, die Spannung sackt ein wenig ab und die Atmosphäre wirkt nicht mehr so dicht, wie sie noch an anderen Stellen erscheint. Auch die Auflösung überzeugt dabei nicht bis ins Detail. Ein wenig plötzlich kommt das Ende und in Teilen auch ein wenig aus dem Nichts. Dadurch bedingt, legt man das Buch am Ende zwar insgesamt zufrieden beiseite, aber dennoch auch mit einem leichten Stirnrunzeln. Die letzten Zweifel an der logischen Zusammenführung der Handlung kann das Ende leider nicht ausräumen, wenngleich es sich durchaus spannend liest.
Deutliche Stärken zeigt der Roman allerdings immer dann, wenn er sich auf Shadow als Hauptfigur konzentriert. Shadows Teil der Reise, den er alleine bestreitet, sein zeitweiliges Leben in der Abgeschiedenheit des eingeschneiten Ortes Lakeside, seine Zeit im Hause der Bestattungsunternehmer Ibis und Jacquel (ihrerseits ebenfalls in die Jahre gekommene Gottheiten) – das sind die Teile der Geschichte, die erzählerisch am meisten zu überzeugen vermögen.
Ansonsten ist „American Gods“ ein Roman, in den sich obendrein sehr viel hineininterpretieren lässt. Der Kontrast zwischen den Göttern der alten Welt und ihrer zunehmenden Bedeutungslosigkeit und den neuen Göttern der Menschheit hat einen gewissen Reiz. Fortschritt trifft auf alte Mythen, Tradition trifft auf Moderne und das alles in einem Land, das für sich genommen noch recht jung ist und welches das Bewusstsein für die eigenen Wurzeln oft vermissen lässt. In diesem Aspekt steckt schon ein gewisser Symbolcharakter, der sich sicherlich auch als Kritik verstehen lässt. Gaimans Roman bekommt durch solche Denkansätze mehr Tiefe, als man auf den ersten Blick vermuten mag.
Doch darüber hinaus weiß Gaiman obendrein zu unterhalten. Es ist die Mischung, die den Reiz ausmacht. Einerseits die mythenbehafteten Figuren, in einer Welt´, der es zunehmend an Mythen mangelt, andererseits aber auch eine sehr ausgeprägte Ader für das Skurrile und mitunter Komische. „American Gods“ ist eine durchaus vielschichtige Mischung, die man mit Vergnügen lesen mag. Gaimans Stil liest sich ganz locker runter, seine Art zu erzählen ist für sich genommen schon recht unterhaltsam, auch wenn die Übersetzung in manchen Punkten ein wenig steif wirken mag.
Kurzum, „American Gods“ ist sicherlich Neil Gaimans bislang komplexester Roman. Schön zu lesen, unterhaltsam und mit zunehmender Seitenzahl obendrein spannend, ist „American Gods“ ein Roman, der ganz eigenwillig auf einem schmalen Grat zwischen Fantasy, Mythologie, Roadmovie und Thriller wandelt. Gaiman fährt skurrile und liebenswerte Figuren auf, erzählt schräge und komische Geschichten und fasst das Ganze in einen größtenteils überzeugenden Rahmen. Dass die Handlung manchmal ruhig etwas straffer und logisch nachvollziehbarer verlaufen dürfte und die Geschichte nicht immer mit der letzten Konsequenz erzählt wird, sind zwar kleine Schönheitsfehler, aber mit denen lässt es sich durchaus leben.
http://www.neilgaiman.de/
Aldous Huxley – Brave New World
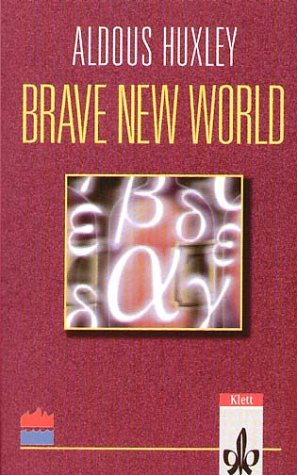
|Im Jahre 1932 schrieb Aldous Huxley seinen Roman „Brave New World“, eine Anti-Utopie, deren Gesellschaftssystem wesentlich darauf beruht, dass man in der Lage ist, Menschen künstlich zu reproduzieren und sie physisch und psychisch ihrer zukünftigen Funktion im Staat anzupassen. Angesichts des aktuellen Standes der Wissenschaft erscheint Huxleys Utopie in weiten Teilen greifbar. Die Gentechnik entwickelt sich mit großen Schritten vorwärts. Was 1932 noch utopisch war, ist in der Gegenwart bereits greifbar. Da verwundert es nicht, dass der Begriff „schöne neue Welt“ bereits zu einem geflügelten Wort geworden ist. Die Möglichkeiten, die sich durch die Gentechnik ergaben und zukünftig noch ergeben werden, stellen neue Anforderungen hinsichtlich der Grenze zwischen dem Möglichen und dem Nötigen (dem ethisch-moralisch Vertretbaren) an den Menschen.
Der Roman ist im Original leicht verständlich und für eine Lektüre „zwischendurch“ geeignet. Den Detailreichtum einer Science-Fiction darf der Leser nicht erwarten. Die technischen Verfahren der Eugenik z. B. wurden von Huxley nur skizziert. Ich persönlich schätze den Roman wegen seiner fortwährenden Aktualität und seines (moral-)philosophischen und ethischen Diskussionspotenzials.
Die deutsche Übersetzung kann ich nicht empfehlen, da man den Handlungsort verlegte und die Namen der Protagonisten verändert hat, was meiner Meinung nach einen unangemessener Eingriff in die Rechte des Autors darstellt.
Der Weg zur „Schönen neuen Welt“
Bereits in den Werken der 20er Jahre entwickelt Huxley Ideen, die in seinem 1932 erstmals veröffentlichtem Roman „Brave New World“ (dt. „Schöne neue Welt“) wieder auftreten und neu verknüpft werden.
In „Crome Yellow“ (1921) zum Beispiel findet man bereits die Idee zur Trennung von Eros und Fortpflanzung in der Vision eines Zukunftsstaates. Es taucht ebenfalls die Anlage einer streng hierarchisch aufgebauten Gesellschaftsordnung auf, in der die Elite mit Hilfe von Suggestion und Konditionierung ihre Gesellschaftsmitglieder lenkt. In seinen „Proper Studies“ (1926/27) zeichnet er bereits die Planungsskizze der Gesellschaft der „Brave New World“ als eine mit Hilfe der Eugenik konstruierte, pyramidenförmige Gesellschaft.
In „Point Counterpoint“ (1928) findet man das Thema der aus Büchern gewonnenen, vergeistigten und idealisierten Liebe, wie sie John Savage und zum Teil auch Bernhard Marx in der |brave new world| empfinden werden. Außerdem sieht man in diesem Roman deutlich die Weiterentwicklung der Vision aus „Crome Yellow“ in Gestalt einer vergnügungssüchtigen, in sexueller Promiskuität lebenden jungen Witwe, in der damit bereits wesentliche Charakterzüge der Frauen in der schönen neuen Welt vorgezeichnet sind.
Ein Jahr vor der Veröffentlichung des Romans „Brave New World“, wird der Essayband „Music at Night“ (1931) herausgegeben, in dem sich die thematischen Stränge noch einmal verdichten; zum Beispiel: systematische Eugenik und Verringerung der Weltbevölkerung, leisure-syndrom (Langeweile aufgrund von zu viel Freizeit) in industrialisierten Gesellschaften, Beschäftigung mit Kultur als Zeitverschwendung und fundamentale Bedrohung des industriell gewollten Massenkonsumverhaltens, Kastensystem und dementsprechende Bildung (bzw. Nichtbildung) sowie synthetische Drogen.
Huxley entwickelte also bereits Jahre vor „Brave New World“ Ideenstränge, die er immer wieder aufgriff und weiterentwickelte, bis sie schließlich in diesem Roman neu zusammengestellt wurden. Waren Huxleys Werke bis zu diesem Zeitpunkt immer Ideenromane oder Essays, schrieb er mit „Brave New World“ seine erste (negative) Utopie.
Inhalt
Als |novell of ideas| konzipiert, stellt Huxley dem Leser in „Brave New World“ eine Welt vor, in der wissenschaftliche Ideen, Methoden und Praktiken im Vordergrund der Gesellschaft stehen.
Der Plot ist im Jahre 632 nach Ford (dem „Erfinder“ der Fließbandproduktion) angesiedelt. Wie in George Orwells „1984“ und Samjatins „Wir“, mit denen Huxleys Werk sich immer wieder vergleichen lassen muss, so haben wir es auch in „Brave New World“ mit einem totalitären System zu tun, in dem zehn Controller (dt. Weltaufsichtsrat) über das zweifelhafte, angenormte Glück der Bewohner eines Weltstaates wachen.
Wesentlich für den Roman ist eine Gegenüberstellung von der auf Glück genormten Gesellschaft der schönen neuen Welt und ihrer Außenseiter.
Helmholtz Watson ist seiner Kaste geistig überlegen und versucht eigene Wege zu gehen. Sein Freund Bernhard Marx – wie er ein Alpha-Plus – ist Außenseiter aufgrund eines Fabrikationsfehlers, durch den er nicht dem Idealbild der Kaste entspricht.
Marx trifft während eines Urlaubs mit Lenina Crown, zu der er unerlaubte Liebesgefühle entwickelt hat, in einem Reservat auf John Savage, der dort bereits eine Außenseiterfunktion einnimmt und sich auch als Außenseiter mit der, von ihm nach einem Shakespeare-Zitat benannten, brave new world auseinandersetzen muss. Vor allem Watson und Savage bilden die Opposition und scheitern. Marx und Watson werden auf eine Insel verbannt. John Savage entzieht sich zunächst dem Experiment des controllers Mustapha Mond und begeht später Sebstmord.
Stabilität
Das zentrale Ziel der Gesellschaft formuliert der controller als Stabilität. Dabei handelt es sich sowohl um wirtschaftliche und soziale Stabilität des gesamten Systems als auch um individuelle Stabilität eines jeden Einzelnen. Erreicht wird diese mittels einer konsequenten und systematischen Eugenik, postnataler Konditionierung und Suggestion. Dazu zählen künstliche Zeugung, das Bokanowsky-Verfahren (Prinzip der Massenproduktion übertragen auf die Biologie), Neo-Pawlowsche Reflexnormung und Hypnopädie. Diese biologischen Verfahren ersetzen die physische Gewalt, die in den Antiutopien „1984“ und „Wir“ zum Erhalt der Macht aufgebracht werden muss. Hinzu kommen eine lebenslange Jugendlichkeit, Kastenwesen, begrenztes Wissen und eine promiskuitive Sexualität. Der Staat muss den Menschen mit allen erwähnten Mitteln zum Zweck der sozialen Stabilisierung ganz klar die Freiheit entziehen. Doch die Bewohner dieser Welt empfinden den Mangel an Freiheit nicht, da alles getan wird, um sie von der Retorte an mit und in ihrem Leben zufrieden zu stellen. Sie sind glücklich, weil das universelle Glück ihnen angenormt wurde und das Sklaventum annehmbar macht.
Weil keine Fordsche Massenproduktion existieren kann, wenn es keinen Massenkonsum gibt, ist die Gesellschaft im Grunde auf die Dynamik des Konsums ausgerichtet. Sie wird in die Konditionierung mit einbezogen: „The more stiches, the less riches. (…) Mending is antisocial.“ Als konsumorientierter, guter Bürger der brave new world wirft man beschädigte Sachen weg und kauft neue. Materielle Bedürfnisse werden ohne Aufschub befriedigt.
Liebe zur Natur fördert den Konsum nicht in ausreichendem Maße, deshalb wird den Menschen Hass auf die Natur angenormt. Doch gleichzeitig werden sie auf die Liebe zum Freiluftsport konditioniert, denn banale Sportarten wie Obstacle Golf oder Electromagnetic Golf erfordern großen materiellen Aufwand.
Kultur und Kunst werden abgelehnt, da den Menschen die nötigen Gefühle fehlen. Außerdem fördern Kunst und Kultur keinen Verbrauch von Konsumgüter. Der Mensch in Huxleys Utopie soll sich nur zwischen Arbeit und kollektivem Konsumvergnügen bewegen. Das verhindert seine Isolation. Das verhindert Reflexion. Die Manipulation der Menschen erfolgt folglich neben den politischen ganz klar auch zu wirtschaftlichen Zwecken.
So produziert der eugenische Wirtschaftszweig den perfekten Menschen für die „consumer society“. Die Eugenik hält die Population stabil, welche wiederum die Wirtschaft stabilisiert, indem sie konsumiert. Dieses principum mobile muss reibungslos laufen, damit die Gesellschaft funktioniert. Deshalb gibt es zur Sicherung der Stabilität zusätzlich die Droge Soma. Sie wirkt euphorisierend, narkotisierend und weckt angenehme Halluzinationen. Sie bietet einen Urlaub von der Wirklichkeit ohne Nebenwirkungen. Man kann mit ihr aus einer Situation persönlichen Ungleichgewichts fliehen, um mit dem Aufwachen wieder seinen gewohnten Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Die Gesellschaft legalisiert diese Droge, um das statische Glück aufrechtzuerhalten. Ein Leben ohne negative Gefühle ist gleichzeitig ein Leben ohne Konflikte. Soma hilft, den Konflikten aus dem Weg zu gehen.
Wohin nun aber in einer glücklich-zufriedenen Gesellschaft mit den menschlichen Aggressionen und der überschüssigen Energie? Die Unterhaltungsindustrie hat so genannte |feelies| entwickelt. Das sind Filme mit einem simplen didaktischen Plot, die in speziellen Kinosesseln sitzend gesehen werden müssen, wobei durch Sensoren in den Sesseln menschliche Nerven stimuliert werden und der Zuschauer dadurch die Gefühle der Darsteller teilt. „Take a hold of those metal knobs on the arms of your chair,‘ wispered Lenina. (…) That sensation on his lips! He lifted a hand to his mouth, the titillation ceased; let his hand fall back on the metal knobs, it began again. … the stereoscopic lips came together again, and once more the facial erogenous zones of six thousand spectators in the Alhambra tingled with almost intolerable galvanic pleasure. “
Man erlebt nicht nur sexuelle Stimulation, sondern auch eine katartische Wirkung über Schmerzen und Angst bis zu Freude und Erleichterung. So sorgt die Unterhaltungsindustrie dafür, dass Emotionen durch den Konsum von Unterhaltung abgebaut werden und einem Gefühl von Entspannung weichen.
In den Kinos laufen ebenso die Feelytone-News, und es gibt ein Hourly Radio. Das sind die beiden Informationsquellen, die wie alles in der brave new world der staatlichen Kontrolle und damit der Zensur unterliegen. Es gibt keinen Pluralismus in dieser Gesellschaft. Damit ist der Weg für die einseitige Massenbeeinflussung frei.
Für dem Abbau überschüssiger Energie und Emotionen existieren neben den feelies auch orgiastisch-gottesdienstähnliche Rituale wie der Solidarity Service. Wenn man den Konsum an sich als Religionsersatz betrachtet, finden wir in Ford den Gottesersatz. Für Our Ford werden Community Sings und Solidary Services abgehalten. Außerdem gibt es auch die Ford Day Celebration. Der controller Mustapha Mond wird als His Fordship bezeichnet, seine Äußerungen als: „Straight from the mouth of Ford himself.“ Er ist also die legitime Vertretung Fords in der literarischen Gegenwart. Die gottesdienstähnlichen Rituale der Gemeinschaftsandachten dienen wie die Unterhaltungsindustrie lediglich dazu, kontrolliert zu stimulieren, um die Emotionen abzubauen und zusätzlich das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Religion, wie heutige Leser sie auffassen, wird als Aberglaube angesehen.
Die Gegenwelt
Findet der Leser in der brave new world die moderne Gegenwartsgesellschaft der Utopie, wird er mit einem Ausflug in ein Reservat in eine andere Welt geführt. Sie mag für den Leser einerseits vertrauter sein, da sie eine Gesellschaft mit der heutigen sozialen Struktur zeigt. Doch ihre Primitivität mutet genauso befremdlich an wie die stabilisierte Gesellschaft der brave new world.
So empfindet Lenina es dort angesichts des allgegenwärtigen Schmutzes als |oppressively queer| und mit dem Alterungsprozess, mit Hässlichkeit und Krankheit konfrontiert als terrible und awful, denn jemand aus der fortschrittlichen brave new world kann sich nicht in das rückschrittliche Leben eingliedern, da der gewohnte Komfort immer vermisst wird, wie der Autor exemplarisch an Johns Mutter vorführt. Dennoch erkennt Lenina in einem Fruchtbarkeitsritual der Indianer zumindest anfangs Solidary Services, Ford’s Day Celebrations und lower-caste Community Sings wieder, kann also diesen Lebensbereich der Indianer mit ihrem Leben verbinden.
Das Reservat ist somit kontrastierend entworfen, bildet jedoch keinen völligen Gegensatz und ist ebenfalls nicht positv zu nennen. Dazu heißt es im Vorwort des Romans: „The Savage is offered only two alternatives, an insane life in Utopia, or the life of a primitive in an Indian village, a life more human in some respects, but in others hardly less queer and abnormal.“
Doch kann Huxley zugleich mit dem Reservat die Außenseiterfigur des John Savage einführen, eines völlig Fremden in der brave new world und, bedingt durch die Herkunft seiner Mutter, ebenfalls Außenseiter im Reservat. So ist die Welt des Reservats keine Alternative, sondern ein der brave new world entgegengesetzter Wahnsinn einer primitiven Welt mit Fruchtbarkeitskult und Büßertobsucht – und gleichzeitig ein literarischer Kniff.
Konflikte in einer konfliktlosen Welt
Natürlich darf es in einer stabilen Gesellschaft keine Konflikte geben. In Samjatins „Wir“ werden Oppositionelle hingerichtet. Falls sie jedoch gebraucht werden, so wie der Raketeningineur D-503, werden sie eugenisch umgeformt, so dass sie sich wieder in die Gesellschaft integrieren lassen. Auch Orwell lässt diese Integration nach erfolgreicher Gehirnwäsche als Alternative für den Protagonisten offen. Der Leser weiß jedoch auch, dass selbst Leute, die später hingerichtet werden, solch einer Gehirnwäsche unterzogen werden, damit sie mit dem Gefühl sterben, sie hätten es verdient, und dieses Gefühl bei ihrer Hinrichtung an die Zuschauer weitervermitteln.
Bei Huxley münden die Konflikte in einer Schlussdebatte mit dem controller (Kap. IX-XVII), der zunächst Helmholtz und Bernhard über ihre Verbannung auf eine Insel informiert. Während Helmholtz das gelassen aufnimmt, reagiert Bernhard mit so viel Angst und Entsetzen, dass er weggebracht und beruhigt werden muss. Mustapha Mond erzählt, dass er selbst einmal vor der Wahl stand, auf eine Insel verbannt oder controller zu werden; die Freiheit und die Wahrheit der Wissenschaft mit allen Konsequenzen oder controllership und die Stabilität mit all ihren Konsequenzen zu wählen. Er entschied sich für Letzteres und hat damit bezahlt, sich nicht mehr der Wissenschaft hingeben zu können. Diese Entscheidung wird auf Watson übertragen. Er bezahlt dafür, zu interessiert an Schönheit und damit Kunst zu sein. An dieser Stelle tritt Watson ab.
Die individuelle Entscheidung des controllers erweist sich als dieselbe Entscheidung, welche die Menschheit nach einem neunjährigen Krieg treffen musste. „God isn’t compatible with machinery and scientific medicine and universal happiness. You must make your choice. Our civilization has chosen machinery and medicine and happiness.“
Die Stabilität funktioniert also als logische Konsequenz aus der grundsätzlichen Wertentscheidung für happiness, machinery und medicine, damit aber auch für Frieden, Sicherheit, materiellen Wohlstand, Befreiung sowohl von negativen als auch positiven Gefühlen, universelles Glück und Unfreiheit. Es wird keine Entwicklung mehr geben. Die Zukunft ist immerwährende Gegenwart. Deshalb dürfen keine Außenseiter (destabilisierende Individuen) geduldet werden, werden Marx und Watson verbannt, muss der Autor John Savage sterben lassen.
Huxley hin oder her – es bleibt die Frage: Wie weit sind wir heute noch von der schönen neuen Welt enfernt? Ein Beitrag zu dieser Frage wurde im September/Oktober 1999 in der „Zeit“ diskutiert. Diese Diskussion ist als die Sloterdijk-Debatte in der Öffentlichkeit bekannt geworden.
Die „Schöne neue Welt“ unserer Zeit
An der Sloterdijk-Debatte in der „Zeit“ beteiligten sich namhafte Philosophen, Rechtswissenschaftler und Bioethiker wie Thomas Assenheuer, Jürgen Habermas, Manfred Frank und Ernst Tugendhat, um nur einige zu nennen.
Sie schätzten Sloterdijks Vortrag „Regeln für den Menschenpark“ (1997, 1999) einhellig für mehr provokativ-assoziativ als kompentent ein. Es wurde kritisisiert, dass eine klare These und rationale Handlungsempfehlungen fehlen, und stattdessen der Schauder, der heute noch von Nietzsches Philosophie ausgeht, ästhetisiert und sein Kontext nicht beachtet wurde. Anstatt mit Platon, „dessen Ruhm sich nicht gerade auf Beiträgen zur Naturwissenschaft gründet“, Heidegger und Nietzsche zu argumentieren und sich hinter ihnen zu verstecken, hätte brandaktuelles Material aus der Bioethik verwendet werden sollen (M.Frank).
Weitgehend einig war man sich jedoch darüber, dass die Anwendung gentechnischer Methoden heute bereits außer Frage steht. Die pränatale Diagnostik (PND; Ultraschall, Triple test, Chorionzottenbiopsie, Amniozentese) bietet die Möglichkeit, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und unmittelbar nach der Geburt, mitunter sogar noch im Uterus zu behandeln. Außerdem erleichtert es die Selektion behinderten Lebens. Da die Mehrzahl behinderter Kinder heute abgetrieben wird, findet eine stille Selektion bereits seit Jahren statt. Was in der Sloterdijk-Debatte also noch theoretisch diskutiert wurde, ist längst schon gegeben. Inzwischen wurde der „genetische Bauplan des Menschen“ bereits zum großen Teil dechiffriert. Damit erhofft sich die Wissenschaft weitere Möglichkeiten u. a. zur Früherkennung von Erbkrankheiten.
Mit Hilfe der Polkörperdiagnostik und Präimplantationsdiagnostik (PID) kann Leben in vitro erzeugt und bewusst selektiert werden, da sie innerhalb von 24 Stunden bereits Aufschluss darüber gibt, ob das Embryo schädliches Erbgut trägt. Somit öffnet die PID „die Tür zur schönen neuen Welt des Baby-TÜVs.“
Die künstliche Insemination bietet theoretisch zusätzlich zu der Option auf ein gesundes Kind, wie es die PND und PID ermöglichen, auch noch die Möglichkeit, das Geschlecht seines Kindes selbst zu bestimmen, da Spermien mit einem weiblichen und Spermien mit männlichem Chromosomensatz bis zu einem gewissen Grade getrennt werden können.
Die Schwangerschaft mit den bereits besprochenen Möglichkeiten ist ein moralisches Minenfeld geworden. Vermutlich wird es nicht bei der negativen Auslese bleiben, sondern früher oder später werden Eltern auch positive Forderungen stellen: größer, schöner, intelligenter. Was so lange nur Wunsch war und dem genetischen Zufall überlassen wurde, könnte bald durch genetische Planung in den Bereich des Möglichen treten. Schon heute ist ein Verlust der Schicksalsakzeptanz zu erkennen. Junge Eltern erwarten von Ärzten nicht nur Unterstützung während der Schwangerschaft, sondern ein Gütesiegel auf ein gesundes Kind.
PND, PID … Die Grenzen des Machbaren werden immer mehr ausgeweitet. Dennoch kann sich jedes Retortenkind sicher sein, dass es einzigartig auf der Welt ist; das Produkt zweier biologischer Eltern. Doch spätestens seit Klonschaf Dolly weiß die Weltöffentlichkeit, dass man Nachkommen auch aus einer einzigen Zelle und ganz ohne den biologischen Akt der Befruchtung züchten kann. Das Klonverfahren Dollys entspricht zwar nur bedingt dem Huxleyschen Bokanowsky-Verfahren, aber den Kerngedanken der künstlichen Reproduktion, der Züchtung identischer Lebewesen haben sie dennoch gemein. Und Nachrichten von angeblichen Klonbabys zeigen, dass die Wissenschaft beim Klonen von Tieren nicht Halt macht.
Der wissenschaftliche Fortschritt bietet den Menschen neue Möglichkeiten, die zugleich die menschlichen Wertesysteme erschüttern. Wird man den Menschen nicht länger als ein Produkt des Zufalls, sondern als das einer bewussten Entscheidung sehen müssen? Wissenschaftler stimmen darin überein, dass es nicht möglich sein wird, das menschliche Erbgut in toto umzukrempeln, doch die gesellschaftliche Moral verändert sich stark. Deshalb wird es in nächster Zukunft wichtig sein, die Grenzen der experimentellen Zweckmäßigkeit festzulegen, damit man zwischen falsch und richtig unterscheiden kann, und die Ethik dem Fortschritt nicht länger hinterherhinkt.
Fraglich ist nur, worauf sich ein Codex der Anthropotechniken, wie ihn Sloterdijk sich wünscht, basieren soll. Kann der Ersatz der Ethik nur aus der Züchtung selbst kommen? Oder sollte man sich bei der bei der Grenzfestlegung auf ethische Werte wie Freiheit und Verantwortung stützen? Was als Utopie Huxleys began und als Sloterdijk-Debatte fortgesetzt wurde, ist noch lange nicht abgeschlossen.
Taschenbuch: 237 Seiten
Sprache: Englisch
www.klett.de
Barclay, James – Schattenpfad (Die Chroniken des Raben 3)
Der Rabe zieht endlich weiter, die Schlacht um Balaia geht in die nächste Runde, und wiederum haben sich zahlreiche Wendungen im Kriegsspiel der Söldnertruppe ergeben. Oder besser gesagt, James Barclay hat sich wieder so einiges einfallen lassen, um die Geschichte um Hirad Coldheart und seine Mannen fortzusetzen, und wiederum – das wundert mich jetzt auch eher weniger – hat er dabei eine wirklich fabelhafte Erzählung erschaffen, die in der modernen Fantasy-Literatur ihresgleichen sucht.
Denser hat den magischen Spruch „Dawnthief“ gewirkt und die Wytchlords besiegt. Die Wesmen fallen in der Schlacht in großen Zahlen, der Kampf gegen das Böse scheint also gewonnen. Doch schon erfüllt eine neue Bedrohung die Welt von Balaia mit Angst und Schrecken, denn der magische Spruch hat ungeahnte Folgen mit sich gebracht. Direkt über der Pyramide der Wytchlords ist ein Riss im Himmel entstanden, der ein Tor zur Paralleldimension der Drachen geöffnet hat. Zwar kämpfen der mächtige Drache Sha-Kaan und die Söldnertruppe des Raben Seite an Seite, doch weil sich dieser Riss immer mehr ausweitet, kann die Pforte von den Drachen nicht mehr lange bewacht werden. Nur Hirad, Denser, Ilkar, Der Unbekannte, Erienne, Thraun und Will (oder kurz: der Rabe) können diese Entwicklung noch aufhalten, indem sie in kürzester Zeit in Erfahrung bringen, wie sie mittels „Dawnthief“ das Loch wieder schließen können.
Doch die Zeit rennt davon, der Rabe muss sich mit Männern aus den eigenen Reihen auseinandersetzen und die Drachenbrut Kaan wird auch immer schwächer. Und als wäre dies nicht schon schlimm genug, steht das Magier-Kolleg Julatsa unter Belagerung. Jetzt beginnt der Kampf gegen das Böse erst so richtig …
„Schattenpfad“ ist meiner Meinung nach das bislang beste Buch aus der Serie „Die Chroniken des Raben“. Nachdem ich von den ersten beiden Bänden schon restlos begeistert war und die Welt von Balaia mit all ihren Details und Intrigen kennen gelernt habe, begreife ich jetzt erst die Tragweite bestimmter Verhältnisse und Beziehungen und komme auch langsam hinter das Geheimnis der verschiedenen Dimensionen. Wenn ich oben schreibe, dass der Kampf gegen das Böse erst jetzt so richtig losgeht, dann kann man das in vollem Maße wörtlich nehmen. Die ersten beiden Bände, die in sich eine abgeschlossene Handlung beinhalteten, darf man getrost als Einleitung für die ‚richtige‘ Geschichte betrachten, ohne „Zauberbann“ und „Drachenschwur“ so abzuwerten.
Nun kennt man alle Protagonisten, man hat sich gedanklich mit der Karte von Balaia vertraut gemacht, und man ist mittendrin in den Verstrickungen unter den verschiedenen Kollegs. Deshalb ist es während der gesamten 400-seitigen Geschichte auch absolut kein Problem, dass teilweise fünf oder sechs Handlungen nebeneinander ablaufen. Da wird um Julatasa gekämpft, der Rabe muss sich mit verschiedenen ‚Kollegen‘ herumschlagen, die Geschichte des mächtigen Magiers Septern wird in Form einer Retrospektive aufgearbeitet, die Schlacht zwischen der Drachenbrut Kaan und ihren Konkurrenten wird verfolgt und darüber hinaus werden auch noch jede Menge zwischenmenschliche Dinge ausgelotet – ohne dass auch nur zu einer Sekunde Verwirrung entstehen könnte.
Barclay kann sein Talent als Schriftsteller hier mehr als nur eindrucksvoll unter Beweis stellen. So kompliziert die Story nach außen hin auch klingen mag, so simpel ist sie prinzipiell dann auch wieder. Sein einfacher, recht moderner Schreibstil erleichtert dabei den Zugang und setzt dort an, wo die Vorgängerbände aufgehört haben, nur dass er sich dieses Mal noch verzwicktere Situationen ausgedacht hat. Für mich sind „Die Chroniken des Raben“ so ziemlich das Beste, was der Fantasy-Bereich neben dem Tolkien-Stoff zu bieten hat. Ich ärgere mich jedenfalls jetzt schon, dass ich den Nachfolgeband „Himmelsriss“ (angekündigt für September 2005) noch nicht in meinen Händen halte, denn der Wissensdurst nach einer Fortsetzung der Geschichte des Raben ist kaum noch auszuhalten.
Wer in Sachen Fantasy mitreden möchte, kennt „Die Chroniken des Raben“ bereits oder besorgt sich jetzt ganz schnell die ersten beiden Bücher, holt noch einmal tief Luft und verschlingt dann „Schattenpfad“ in einem Rutsch. Ich habe sage und schreibe einen Tag für diesen Wälzer gebraucht …
Homepage des Autors: http://www.jamesbarclay.com
Homepage des Zyklus: http://www.ravengazetteer.com
Band 1: [„Zauberbann“ 892
Band 2: [„Drachenschwur“ 909
Hand, Stephen – Texas Chainsaw Massacre
Travis County, ein von Gott und der Welt vergessener Landstrich im US-Staat Texas im brütend heißen August des Jahres 1973. Fünf junge Menschen sind unterwegs zu einem Rockkonzert in Dallas. Zuvor war man in Mexiko und hat dort billiges Marihuana gekauft. Kemper, der Fahrer und Besitzer des Vans, hat auch deshalb eine Abkürzung abseits des Highways gewählt. Seine Freundin Erin darf nichts von dem Schmuggel wissen; die junge Frau ist wesentlich „erwachsener“ als er und kann geistige Unreife und moralischen Schlendrian überhaupt nicht leiden. Aus anderem Holz sind Kempers Freunde Morgan und Andy geschnitzt, die den Spaß am Leben genießen. Ähnlich denkt Pepper, eine junge Frau, die man als Anhalterin auf der Straße aufgelesen hat.
Die Fahrt findet ihre abrupte Unterbrechung, als ein offensichtlich verwirrtes Mädchen dem Van fast vor den Kühler läuft. Es ist verletzt, steht unter Schock – und als es merkt, dass Kemper in die Richtung fährt, aus der sie kam, gerät sie in Panik, zieht einen Revolver und schießt sich durch den Kopf.
Das Quintett ist entsetzt. Mitten im Niemandsland hat man eine Leiche am Hals. Erin behält die Nerven und will die Polizei benachrichtigen. Gerade nähert man sich dem Dorf Fuller, wo Sheriff Hoyt seines Amtes waltet. Auf die jungen Leute wirkt er merkwürdig und verschlagen, aber als der Sheriff das Dope entdeckt, sind sie ihm ausgeliefert. Ohnehin sitzen sie längst in einer wohl geschmierten Todesfalle, wie Erin und Kemper bestätigen könnten, die inzwischen den vertierten Hewitt-Clan getroffen haben. Thomas, genannt „Leatherface“, ein durch Krankheit verstümmelter, wahnsinniger Mörder, zerlegt seine Opfer mit der Kettensäge in Stücke und verarbeitet sie zu Wurst. Den Besitz der so Verschwundenen reißen sich der Rest der lieben Familie und Hoyt unter den Nagel. Die Bande hat den Ort völlig unter ihrer Kontrolle; wohin die fünf Freunde sich auch wenden, finden sie nur das Grauen – und Leatherface, der sie mit knatternder Kettensäge erwartet …
Die Geschichte ist längst Legende, ihre Neufassung als Film war erfolgreich, das Buch zu diesem liest sich flott und anspruchslos – ein weiterer Horrorstreifen des frühen 21. Jahrhunderts also, gern gesehen/gelesen & schnell wieder vergessen? So einfach ist es nicht. Es steckt mehr hinter dieser ganz speziellen Story.
„Texas Chainsaw Massacre“ ist als Film von 2003 und erst recht als Buch zum Film von 2003 nur unter Berücksichtung der dreißig Jahre älteren Originalverfilmung zu interpretieren. Ohne das Wissen um Tobe Hoopers Klassiker, der sogar seinen Weg ins „Museum of Modern Art“ gefunden hat, erlebt man nur einen weiteren, handwerklich gut gemachten aber sicher nicht originellen Horrorfilm der „alten Schule“, d. h. brutal, blutig, ohne ironische Brüche, die das Grauen relativieren und leichter erträglich werden lassen.
Welches Grauen eigentlich?, fragt sich indes der Eingeweihte. Zu Recht, denn über kurze Momente einer jenseits des Ekels schwer verständlichen Verstörung kommt die neue „TCM“-Version nie hinaus. Da war der Vorgänger von ganz anderem Kaliber. Ausgerechnet im Buch zum neuen Film wird immerhin ein Aspekt deutlicher herausgearbeitet, werden Leben, Tod & Essen – drei Grundkonstanten und ihre gern verdrängte Nähe in den Mittelpunkt gerückt. Normalerweise sind „tie-in“-Romane nur Nebenprodukt einer Filmproduktion, die dem Enthusiasten ein bisschen zusätzliches Geld aus der Tasche locken sollen. Auch „TCM“, das Buch von Stephen Hand, ist sicherlich keine „gute“ Literatur im Sinne eines Buches, das mehr will als pure Unterhaltung, obwohl der Verfasser zumindest bemüht ist, mehr als die Nacherzählung des Drehbuchs abzuliefern.
Doch die ursprüngliche „TCM“-Story, wie sie Kim Henkel und Tobe Hooper 1974 ersannen, beinhaltete wie gesagt weit mehr als den lobenswerten Zweck, eine möglichst erschreckende Horrorgeschichte zu erzählen. Ob nun beabsichtigt oder zufällig: Die „TCM“-Schöpfer rührten an einem sehr empfindlichen Nerv der amerikanischen Gesellschaftsgeschichte. Mit Recht und Wirkung erinnert Hand daran in der von ihm verfassten Rahmenhandlung, die im Film von 2003 keine Rolle (mehr) spielt.
„TCM“ 1974 erzählte drei Geschichten, von denen diejenige über einige Teenager, welche unter die Menschenfresser fallen, die unwichtigste ist. Die eigentliche Beklemmung resultiert nicht aus den schockierenden Bildern, sondern aus der Tatsache, dass die „TCM“-Story genau dort spielt, wo die Welt angeblich noch in Ordnung ist: auf dem Land, d. h. dort, wo jeder jeden kennt, man einander im Auge behält und hilft, nachts die Haustür unverschlossen lässt und auch sonst das Herz auf dem rechten Fleck hat.
So wird es von konservativen und natürlich reaktionären, aber auch von Tugendbolden und Tagträumern gern gesehen. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussehen kann, belegte die unglaubliche Geschichte des Ed Gein (1906-1984), der zwischen 1954 und 1957 als Grabräuber und schließlich Serienmörder aktiv war und aus den Körperteilen seiner Opfer Masken, Kleidungsstücke, Möbel, Schmuck und Fetische bastelte. Diese „true story“ traf das zeitgenössische Amerika tief ins moralische Mark. (Wer’s mag, kann sich in Wort und Bild auf unzähligen Websites – z. B. http://www.crimelibrary.com/gein/geinmain.htm – über Mr. Gein und seine Gräueltaten informieren lassen.) Ed Gein war „einer von ihnen“. Dass solcher Horror unbemerkt überall nisten kann – damit hatte man nicht gerechnet! Dieses Wissen und das daraus resultierende Unbehagen prägten sich der Volksseele tief ein und sollten sie nicht mehr verlassen.
Der Fall Ed Gein beschäftigte nicht nur die Wissenschaft (und natürlich die Medien), sondern wurde auch Teil der Volkskultur. Zahllose Horrorthriller griffen die Geschichte mehr oder weniger akkurat auf. Zu den berühmtesten Beispielen gehören neben „TCM“ Alfred Hitchcocks „Psycho“ (1960 entstanden nach dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch) und [„Das Schweigen der Lämmer“ 354 („The Silence of the Lambs“, 1991 gedreht nach dem Roman von Thomas Harris).
Auf einer dritten Ebene handelt „TCM“ in der Version von 1974 von der Rache des hilflosen US-Establishments gegen die aufbegehrende, unkontrollierbar gewordene Jugend: Das alte Amerika schlachtet und frisst buchstäblich seine eigenen Kinder. „Heim“ und Familie der degenerierten Hewitts sind eine böse Parodie auf die traditionelle US-Familie à la „Father is the Best“. Das war er – bzw. der Sheriff, der Lehrer und jede andere Autorität einschließlich des Präsidenten der Vereinigten Staaten – 1974 eben nicht mehr. Drei Jahrzehnte später ist dies der Normalzustand, doch für die Zeitgenossen und hier vor allem die „Elterngeneration“ war dies neu und erschreckend. Wie sollte man junge Leute bändigen, sie „bestrafen“, weil sie sich keine politischen oder moralischen Vorschriften mehr machen oder nicht mehr nach Vietnam in den Krieg und in den Tod schicken ließen, sondern auf ihre Gedanken- und Handelsfreiheit pochten? Mit erbarmungsloser Härte durchgreifen und das „Übel“ mit Stumpf und Stil ausrotten, so argumentierten die Wächter der alten „Tugenden“. Tobe Hooper griff dies auf und steigerte entsprechende Wunschvorstellungen ins Groteske. Der Kritik fiel dies auf, die Zensur ignorierte es und stürzte sich auf die Gewaltexzesse – oder schob sie dies nur vor, weil auch ihre Vertreter sehr genau erkannten, worauf Hooper zielte?
Dreißig Jahre später wurde „TCM“ gezähmt. Wer den Film von 2003 sieht, mag das womöglich nicht glauben, weil es erneut sehr splatterig zugeht. Doch das ist halt nur Schau, wozu die wie gelackt wirkenden Bilder passen. Besser als Regisseur Nispel fängt Romanautor Hand den besonderen Geist des texanischen Hinterlandes ein. Hier gibt es kein weites, fruchtbares Land, das der US-amerikanische Pionier so schätzt. Travis County ist öde, einsam, von der Sonne verbrannt, in sich schon eine Falle, in der es keine Deckung gibt. Auch sonst ist alles verkommen und verrottet, was Amerika einst groß gemacht hat: „die Farm“, „der Laden“, „die Fabrik“ etc. Wenn etwas blüht, so sind es üppig wuchernde Nachtschattengewächse, die sich von der Verwesung nähren.
Wohl unbeabsichtigt überlebte interessanterweise genau das verquere Bild der Jugend die Neuverfilmung. In „TCM“ 2003 ist die werttreue, „vernünftige“, konservative Erin die einzige Überlebende. Sie kifft und säuft nicht, will von ihrem Kemper geheiratet werden, macht den „schwachen“, unmoralischen Freunden ständig Vorwürfe und hält sich auch sonst an die Regeln. Nur sie findet in der Krise die offenbar aus ihrer Gutmädchen-Seele erwachsende Kraft, sich dem Bösen zu stellen wie es dies verdient: mit noch größerer Gewalt als der Gegner sie aufzubringen vermag. Leatherface hat gegen eine Erin keine Chance. Er kann es nur mit ihren verderbten Begleitern aufnehmen. Die bekommen, was sie verdienen.
Dabei lassen sie es bloß locker angehen. Sie wirken bedeutend sympathischer als Erin, die freilich nach schwerer Kindheit und als werdende Mama – ein weiterer Grund, der die Regie moralisch verpflichtet, sie überleben zu lassen – die Prioritäten des Lebens anders setzt. Fatalerweise kann Buchautor Hand Kemper & Co. genauso wenig leiden wie Drehbuchautor Scott Kosar und Regisseur Marcus Nispel. Sie zeichnen ihre Opfer flach und ohne echten Bezug zum Zeitpunkt der Handlung – 1973 – nicht als „aufsässige“ Jugendliche, die als potenzielle Gefahr zu betrachten sind, sondern als zeitlos dumme Teenager, die gezüchtigt werden müssen. Leatherface kommt über sie, weil sie Gras rauchen, Rockmusik hören und es miteinander treiben. Das ist keine Provokation mehr, sondern Horrorfilmmoral von der Stange.
Der Glättung der 2003er „TCM“-Macher fiel auch der Hewitt-Clan zum Opfer. Tobe Hooper zeichnete ihn als schrecklich nette Familie, als Karikatur auf Ma & Pa & ihre braven Kinder. Leatherface tauchte als buchstäblich gesichtsloser Rachegeist, als das pure Böse aus dem Nichts auf. Kosar/Nispel und Hand wollen unbedingt „erklären“: Ihre Hewitts sind Wegelagerer, die es auf den Besitz ihrer Opfer abgesehen haben; Leatherface ist ihr Instrument, leidet unter einer entstellenden Krankheit und ist wahnsinnig im Sinne von krank. Das macht ihn nicht weniger mörderisch, aber es enthebt ihn der Verantwortung für seine Taten, die ihrerseits einen praktischen „Sinn“ ergeben. Dieses „Leatherface light“ bedauert man sogar ein bisschen und das kann sicher nicht im Interesse der „TCM“-Story sein.
In einem Punkt funktioniert „TCM“ 2003 freilich (als Film und als Buch) besser als der Vorgänger: Figuren wie „Old Monty“, „Luda May“ und vor allem „Sheriff Hoyt“ sind keine deformierten Monster, sondern wirken äußerlich vergleichsweise „normal“. Gerade das macht sie so gefährlich, denn sie können sich kontrollieren und das Netz schließen, an dessen Ende Leatherface lauert.
Über Stephen Hand ist nicht gerade viel herauszufinden. Der Mensch verschwindet hinter seiner Arbeit, die zunächst vor allem die Entwicklung von Brettspielen und Produktion von Computergames beinhaltete. Erst seit recht kurzer Zeit ist Hand auch als Romanautor tätig, wobei er sich auf Fantasy und Filmbücher spezialisiert. Aus seiner Feder stammt u. a. das Buch zum Gruselstreifen „Freddy vs. Jason“ sowie – wen wundert’s – eine Fortsetzung von „TCM“: „Texas Chainsaw Massacre II: Skin Freak“ (2004). Stephen Hand lebt und arbeitet in Südengland, wie der Klappentext zudem noch vermeldet.