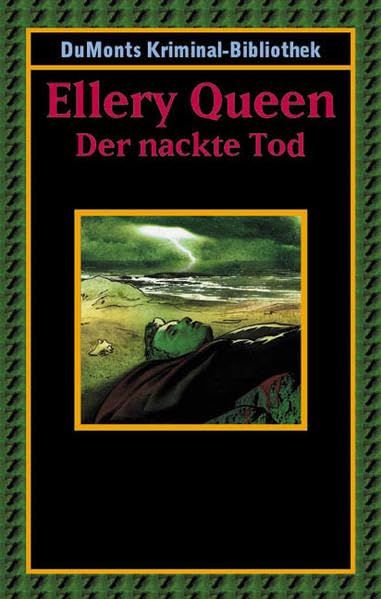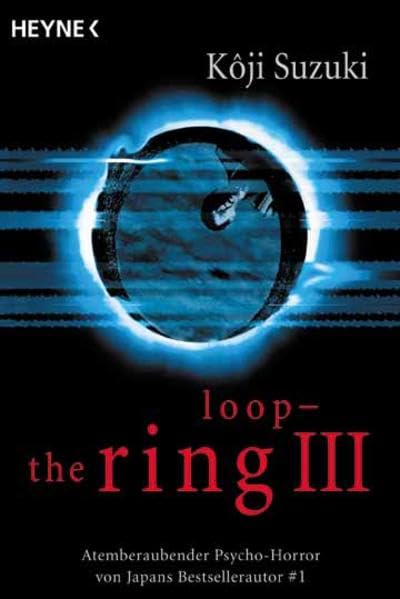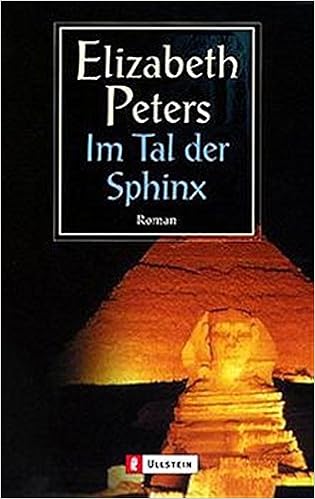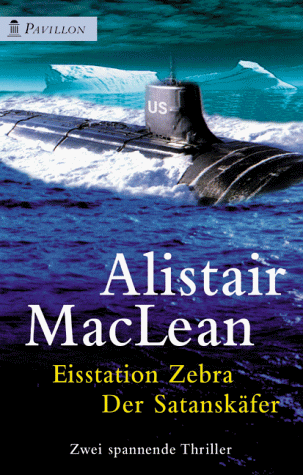
Alistair MacLean – Eisstation Zebra weiterlesen
Alle Beiträge von Michael Drewniok
Scarborough, Elizabeth A. – Frau im Nebel, Die
Edinburgh um 1800. Der junge Jurist und Schriftsteller Walter Scott beginnt sich einen Namen als Chronist seiner schottischen Heimat zu machen. Er sammelt alte Sagen und Lieder, die er auch in seinen historischen Romanen verarbeitet. Dass es tatsächlich Magie und Fabelwesen gibt, ist nicht neu für ihn. Als ständiger Begleiter des Sheriffs – diesen Posten wird er bald selbst übernehmen – kommt er weit herum und hat viel Unheimliches gesehen.
Der Nor‘ Loch ist ein kleiner See, der die Altstadt Edinburghs von der Neustadt trennt. Nun soll er aufgeschüttet und bebaut werden. Im Verlauf der Arbeiten werden Überreste einer Frauenleiche im Schlick gefunden. Ihr gesellen sich bald weitere Opfer zu. Eine Gruppe fahrender Kesselflicker hat im Wald vor der Stadt ihr Lager aufgeschlagen. Des Nachts werden sie mehrfach überfallen, Frauen und Mädchen entführt. Die „Noddies“, skrupellose Leichenräuber, die Studienobjekte für die Seziersäle der Universität besorgen, sollen dahinterstecken.
Scott wird mit der Untersuchung betraut. Er lernt im Lager Midge Margret Caird kennen – und bald schätzen. Seine Ermittlungen führen ihn auf die Spur des „Wissenschaftlers“ Cornelius Primrose. Hinter der Maske des biederen Kirchenmannes lauert der Wahnsinn. Primrose will seine vor Jahren verstorbene Frau zum Leben erwecken und transplantiert einem selbst gebastelten Neu-Körper frische Leichenteile. Scott kommt ihm auf die Spur, doch zu spät, denn schon hat der „Doktor“ sein begehrliches Auge auf Midge Margret geworfen und verschleppt auch sie in sein grausiges Labor …
„Die Frau im Nebel“ gehört in eine (kleine) Nische des Fantasy-Genres. Elizabeth Scarborough siedelt das Geschehen in einer verfremdeten Realität an. Edinburgh Anno 1800 hat sich mit seinen Bewohnern dem Zeitgenossen durchaus so dargeboten wie die Autorin es beschreibt. Aber dennoch ist es gleichzeitig eine Spielwiese, auf der um des Effektes willen allerlei Übernatürliches vorgeht.
Am besten stellt man sich Scarboroughs Edinburgh als „Parallelstadt“ zur echten Metropole vor, eingebettet in eine Welt, in der Zauberei oder Gespenster zwar nicht alltäglich, aber möglich sind. Als Idee funktioniert das vorzüglich, weil im Jahr 1800 – dem realen und dem fiktiven – der europäische Mensch auf dem schmalen Grat zwischen dem Mystizismus des Mittelalters und der Aufklärung der Moderne balanciert.
In diese Kulissen – der Vergleich ist nicht schlecht, wie gleich auszuführen sein wird – platziert Scarborough ihre Geschichte. Flott geschrieben ist sie und ohne die gedrechselten Altertümeleien, die so mancher Autor unverzichtbar für eine in der Vergangenheit spielende Handlung hält. Besondere Originalität kann Scarborough zwar nicht für sich beanspruchen; sie bedient sich kräftig diverser, durch die Kinomühlen gedrehter Trivialmythen. Der böse Primrose wirkt beispielsweise wie eine Mischung der Doktores Frankenstein und Phibes, ergänzt durch mehr als einen Hauch Jack the Ripper.
Aber der Nostalgiefaktor ist durchaus einkalkuliert in Scarboroughs Spiel. „Die Frau im Nebel“ ist sauber getischlerte Unterhaltung, die einfach Spaß macht und sich wohltuend abhebt von den x-bändig ausladenden Tolkien/König Artus/Nibelungen-Abklatschen, mit denen wir Fantasy-Freunde viel zu ausgiebig gepiesackt werden.
(Sir) Walter Scott (1771-1832) ist eine echte Gestalt der Geschichte, die indes von Scarborough von ihrer Biografie gelöst und in ein fiktives Abenteuer gestürzt wird. Mit Leib und Seele gleicht „ihr“ Scott dennoch dem Original – einem ungestümen, unternehmungslustigen, lesewütigen und neugierigen Mann aus Schottland, der 1799 in der Tat zum Sheriff – freilich in der Grafschaft Selkirk – ernannt wurde und sich bis zum Sekretär des Gerichtshofs zu Edinburgh hocharbeitete, ein gut dotierter Posten, der ihm die Muße schenkte, seiner geliebten Schriftstellerei zu frönen. Mit 40 abenteuerlichen, meist historischen Werken wie dem Ritterroman „Ivanhoe“ (1819) erreichte Scott ein kopfstarkes Publikum und wurde ein schottischer Nationaldichter.
In unserer Geschichte ist Walter Scott der Repräsentant zweier Welten. Scheußliche Morde ereignen sich. Das war (und ist) in einer großen Stadt nicht ungewöhnlich. Scott beginnt seine Ermittlungen als Kriminalist, der sich für seine Zeit ungewöhnlich fortschrittlicher Methoden bedient. Damit kommt er nicht weit, so dass er relativ rasch wieder auf „traditionelle“ Praktiken zurückgreift, die das Übernatürliche nicht nur anerkennen, sondern auch nutzen. Schließlich hat Scott selbst einen „echten“ Magier unter seinen Vorfahren. Außerdem ist er Schotte. Bei aller Skepsis akzeptiert er deshalb letztlich die Existenz unerklärlicher Phänomene.
Auf seine Weise steht auch das Böse in unserer Geschichte mit je einem Bein fest in beiden Welten. Es trägt die Gestalt des „Doktors“ Cornelius Primrose, der ein |mad scientist| reinsten Wassers ist, obwohl nicht die Wissenschaft ihn ohne Rücksicht und Skrupel antreibt, sondern die wahnsinnige Liebe zur unter traurigen Umständen dahingeschiedenen Gattin. Die will er zum Leben erwecken und tritt dabei nicht nur als Frankenstein im modernen Labor auf den Plan, sondern auch als Alchimist und Magier der Vergangenheit. Kein Wunder, dass es ihm genauso ergeht wie Goethes Zauberlehrling und die eigene, weder verstandene noch gar lenkbare Schöpfung über ihn kommt.
Für Midge Margret Caird hat Elizabeth Scarborough einen Winkel in der zeitgenössischen Gesellschaft gefunden, in dem eine Frau relativ frei und ungebunden agieren konnte. Als vagabundierende Kesselflickerin steht sie am Rande und bleibt daher von vielen Konventionen verschont. Ihr freigeistiges Denken und Handeln ist wichtig, da ein Roman ohne mindestens eine weibliche Hauptrolle heute vom Publikum schlecht angenommen wird. Trotzdem umgeht Scarborough allzu ausgehöhlte Klischees elegant, indem sie Scott und Margret eben nicht, wie zu erwarten wäre, in Liebe entflammen lässt. Die schöne Kesselflickerin steht zunächst nicht einmal auf Primroses Liste unfreiwilliger Organ- und Körperspenderinnen. Sie ist kein Objekt, sondern handelnde Person. Das bleibt sie sogar, als sie schließlich doch im Labor des Diakons landet.
Elizabeth Ann Scarborough wurde am 23. März 1947 in Kansas City, Missouri, geboren. Sie lernte in der |Bethany Hospital School of Nursing| und studierte an der |University of Alaska| (!); während des Vietnamkriegs diente sie als Krankenschwester.
Seit 1982 arbeitet Scarborough als Schriftstellerin. Sie debütierte mit „Song of Sorcery“ (dt. „Zauberlied“) und erwies sich rasch als sowohl fleißige wie auch gewandte Autorin, die in der Science-Fiction genauso beheimatet ist wie in der Fantasy. Bis heute verfasste sie zwanzig nicht seriengebundene Romane beider Genres, darunter „Healer’s War“, für den sie 1989 einen |Nebula Award| gewann. Dazu kommen weitere Romane, die sie gemeinsam mit Anne McCaffrey schrieb, sowie Episoden zu ihren beiden Erfolgsserien „Petaybee“ und „Acorna“.
Scarborough gibt Kurse für angehende Schriftsteller am |Penninsula Community College|. Außerdem entwirft sie volkstümelnden Perlenschmuck, den sie online vertreibt. Ihre offizielle [Website]http://www.olympus.net/personal/scarboro beschränkt sich primär auf die Präsentation ihrer Waren, über deren künstlerische Qualität an dieser Stelle zu Gunsten der Autorin kein Urteil gefällt werden soll.
Shirley Jackson – Spuk in Hill House
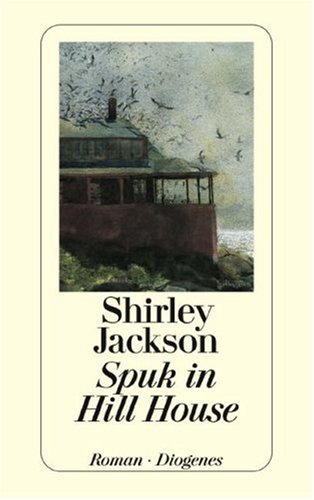
Shirley Jackson – Spuk in Hill House weiterlesen
Nigel McCrery – Denn grün ist der Tod [Dr. Samantha Ryan 1]

Queen, Ellery – nackte Tod, Der
Nach harten Arbeitswochen möchte sich Kriminalschriftsteller und Detektiv Ellery Queen einen erholsamen Urlaub am Meer gönnen. Ein alter Freund, der ehemalige Richter Avra Macklin, begleitet ihn zum Spanish Cape an der Atlantikküste, wo ein kleines Ferienhaus auf sie wartet. Doch die Reisenden finden die Haustür aufgebrochen – und im Inneren gefesselt die junge Rosa Godfrey, die eine abenteuerliche Geschichte erzählt: Mit ihrem Onkel David Kummer ist sie am Vorabend von einem piratenhaften Seemann namens „Captain Kidd“ überfallen und entführt worden. Kummer wurde von Kidd auf ein Boot verschleppt und später anscheinend über Bord geworfen.
Fatalerweise hat der Pirat den falschen Mann erwischt: Eigentlich sollte es einem gewissen John Marco an den Kragen gehen. Der ist Gast im Haus von Rosas Eltern Walter und Stella Godfrey. Walter ist ein steinreicher Wallstreet-Hai, dem praktisch das gesamte Cape gehört. In seiner Villa tummeln sich im Sommer stets viele Besucher. Marco würde der Gastgeber freilich gern an die Luft setzen, da dieser ein Auge auf Tochter Rosa geworfen hat.
Seinen Fehler hat Kidd offenbar rasch ausgebügelt: Als Queen und Macklin Rosa in ihr Elternhaus bringen, ist dort bereits die Polizei eingetroffen: Auf einem bequemen Stuhl am Strand sitzt John Marco – erdrosselt, nackt unter einem altmodischen Umhang.
Wer hat den Mann umgebracht, wieso wurde er anschließend entkleidet? Inspector Moley fühlt sich überfordert und bittet den berühmten Ellery Queen um Schützenhilfe. Die Schar der Verdächtigen ist identisch mit den Bewohnern von Godfreys Villa. Nach und nach stellt sich heraus, dass sie alle gute Gründe gehabt hätten, sich Marcos zu entledigen: Der hat sich seinen Lebensunterhalt als Gigolo verdient, der die umgarnten Damen anschließend als Erpresser kräftig zur Ader ließ.
Bis Queen endlich Licht am Ende des Ermittlungstunnels erblickt, muss er sich tüchtig belügen lassen, schier endlos widersprüchliche Beweise sortieren – und vor weiteren Attacken des Mörders auf der Hut sein, der zwar einen entscheidenden Fehler begangen, aber leider eine geradezu übernatürlich geniale Art der Tarnung für sich entdeckt hat …
Ein einsam gelegene Haus am Meer, erbaut auf einer Halbinsel, umgeben von schroffen Klippen – oder anders gesagt: Hier kommt niemand heimlich hinein oder hinaus. Wenn sich also ein Mord ereignet, dann befindet sich der Täter garantiert unter den Bewohnern. Damit sind die Weichen gestellt für einen archetypischen „Whodunit“-Krimi, in dem Mörder, Verdächtige, Opfer und natürlich diverse Gesetzeshüter unter einer Käseglocke behaglicher Isolation einander zur Gaudi des Lesers belauern.
Die Karten liegen offen auf dem Tisch: Ellery Queen und sein Publikum stoßen zeitgleich auf die für die Lösung des Falls relevanten Spuren. Offen bleibt die Frage, wer mit solcher Fairness mehr anzufangen weiß. Der Verfasser möchte selbstverständlich mit einem gewissen Vorsprung als Erster durchs Ziel gehen. Ist der Leser wenigstens guter Zweiter, wird er (oder sie) zufrieden auch zum nächsten Roman aus der bewährten Feder greifen.
Wer würde nicht gern solcher Verkaufslist auf den Leim gehen, da doch die Manipulation des Lesers ebenso elegant wie unterhaltsam gelingt? „Der nackte Tod“ ist ein hochkarätiger Krimispaß, der meisterhaft die „klassischen“ Regeln des Genres ausspielt. Wir kennen sie alle, aber wir lieben sie, so lange sie nur geschickt variiert werden. Das ist hier jederzeit garantiert.
Der Originaltitel ist übrigens ein hübsches Wortspiel: „Spanish Cape“ ist einerseits der Ort des Geschehens. Andererseits ist ein Cape das einzige Kleidungsstück, das die Blöße John Marcos – der ein Spanier ist – verhüllt.
Sie alle haben Dreck am Stecken. Irgendwie steht es ihnen auch ins Gesicht geschrieben. Manchmal so deutlich wie dem unglaublichen „Captain Kidd“, der nicht nur aussieht wie sein berüchtigtes historisches Vorbild, sondern sich auch so zu benehmen weiß. Mit seinem Auftritt findet Ellery Queen (der Autor) den idealen Einstieg in das vorliegende Abenteuer.
Auf Walter Godfreys feudalem Spanish-Cape-Anwesen tummeln sich zwar deutlich feinere, aber ganz sicher nicht vornehmere Zeitgenossen. Der Hausherr hat sein Vermögen auf höchstens halbwegs legale Weise erworben. Die meisten Gäste können nicht einmal das von sich behaupten. Ein zwielichtiger Abenteurer, eine Mitgiftjägerin, gleich drei Ehebrecherinnen zählen zu ihnen – und das sind nur die Sünder, die unser Detektiv mühelos enttarnt. Leid können sie uns nicht tun. Ellery Queen – der Ermittler wie der Autor – gönnt ihnen daher auch kein Happy-End. Als das Rätsel von Spanish Cape endlich gelöst ist, verlassen Queen und Macklin eine von den Ereignissen fast völlig zerstörte Gesellschaft.
Noch ganz andere Abgründe tun sich sehr bald in Gestalt von John Marco auf. Den lernen wir nur als Leiche kennen. Er ist aber lebendig genug in der Erinnerung seiner geplagten Opfer. Unerbittlicher Parasit, bösartiger Erpresser, zynischer Weiberheld – die Liste seiner Verfehlungen ist fast so lang wie seine Verfolger zahlreich sind. Heute mutet Marcos „Geschäft“ reichlich altmodisch an. Manche prominente Dame vermarktet ihre Schäferstündchen inzwischen selbst. Aber 1935 konnte „Schande“ eine Karriere in der gesellschaftlichen Elite noch zerstören. Insofern ist Marcos nacktes Ende – ein Skandal, der immer wieder schockiert angesprochen wird – eine Art ausgleichender Gerechtigkeit.
Ellery Queen erleben wir dieses Mal nicht an der Seite seines Vater. Inspektor Richard Queen bleibt zu Hause in New York. Die Stadt wird zu eng für einen Detektiv, der seinen Genius gern möglichst ungewöhnlichen Fällen widmet. Das verlangt letztendlich auch sein Publikum, das einen Tapetenwechsel ebenso schätzt.
Der Filius braucht anscheinend trotzdem einen weisen, alten Mann an seiner Seite. Diese Rolle übernimmt Richter Macklin, ein rüstiger, höchst unwürdiger Greis, der zusätzlich für die (sparsamen) Heiterkeitseffekte in dieser Geschichte verantwortlich ist.
Mehr als vier Jahrzehnte umspannt die Karriere der Vettern Frederic Dannay (alias Daniel Nathan, 1905-1982) und Manfred Bennington Lee (alias Manford Lepofsky, 1905-1971), die 1928 mit „The Roman Hat Mystery“ als Kriminalroman-Autoren debütierten. Dieses war auch das erste Abenteuer des Gentleman-Ermittlers Ellery Queen, dem noch 25 weitere folgen sollten. [„Chinesische Mandarinen“]http://www.buchwurm.info/book/anzeigen.php?id_book=222 ist neunte und letzte Fall der „1. Queen-Periode“, die neun Romane der Jahre 1929 bis 1935 umfasst, welche stets das Wort „Mystery“ im Originaltitel tragen und als klassische „Wer war es?“-Krimis zum Mitraten konzipiert wurden.
Dabei half das Pseudonym. Ursprünglich hatten es Dannay und Lee erfunden, weil dies eine Bedingung des besagten Wettbewerbs war. Ohne Absicht hatten sie damit den Stein der Weisen gefunden: Das Publikum verinnerlichte sogleich die scheinbare Identität des „realen“ Schriftstellers Ellery Queen mit dem Amateur-Detektiv Ellery Queen, der sich wiederum seinen Lebensunterhalt als – Autor von Kriminalromanen verdient!
In den späteren Jahren verbarg das „Markenzeichen Queen“ zudem, dass hinter den Kulissen zunehmend andere Verfasser tätig wurden. Lee wurde Anfang der 60er Jahre schwer krank und litt an einer Schreibblockade, Dannay gingen allmählich die Ideen aus, während die Leser nach neuen Abenteuern schrieen. Daher wurden viele der neuen Romane unter der mehr oder weniger straffen Anleitung der Cousins von Ghostwritern geschrieben.
Wer sich über Ellery Queen – den (fiktiven) Detektiv wie das (reale) Autoren-Duo – informieren möchte, stößt im Internet auf eine wahre Flut einschlägiger Websites, die ihrerseits eindrucksvoll vom Status dieses Krimihelden künden. Vielleicht die schönste findet sich unter http://neptune.spaceports.com/~queen : eine Fundgrube für alle möglichen und unmöglichen Queenarien.
„The Spanish Cape Mystery“ wurde bereits 1935, im Jahr seines Erscheinens, von Hollywood verfilmt. Unter der Regie von Lewis D. Collins spielte Donald Cook den Ellery Queen. Albert DeMond verfasste das Drehbuch – und wem diese Namen rein gar nichts sagen, der sollte sich nicht grämen: Dies ist ein sogenanntes „B-Movie“, eine Schöpfung der 1930er Jahre. Um das Publikum auch während der Wirtschaftskrise in die Kinos zu locken, wurde ihm eine Doppelvorstellung geboten. Vor dem teuer produzierten, mit Stars gespickten Hauptfilm lief ein durchschnittlich 70 Minuten kurzer, billiger „Aufheizer“. Gern waren dies Episoden von Serien, die durch den Fortsetzungseffekt einen weiteren Anreiz für die Zuschauer boten. Auch Ellery-Queen-Streifen wurden so heruntergekurbelt. Aus heutiger Sicht sind sie freilich wieder reizvoll anzusehen, da „billig“ einst nicht identisch mit „Schund“ war. Auch „The Spanish Cape Mystery“ ist deshalb durchaus unterhaltsam.
Simon Winchester – Der Mann, der die Wörter liebte

Simon Winchester – Der Mann, der die Wörter liebte weiterlesen
Hartwig Hausdorf – Die Rückkehr der Drachen

Dan Simmons – Fiesta in Havanna
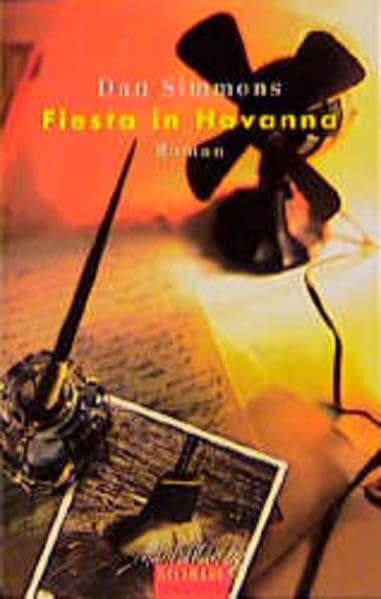
Dan Simmons – Fiesta in Havanna weiterlesen
Reginald Hill – Ins Leben zurückgerufen
1963 starb auf dem Landsitz von Lord Ralph Mickledore Pamela, Gattin des US-amerikanischen Diplomaten James Westropp, durch einen Schrotschuss in die Brust. Als Täter identifizierte der mit dem Fall beauftragte Superintendent Tallantire Sir Ralph höchstpersönlich, der mit der Verstorbenen ein Verhältnis unterhielt. Mickledore fand für seine Bluttat eine Komplizin: Cecily Kohler, das Kindermädchen der Westropps, war angeblich ebenfalls die Geliebte des Lords und diesem hörig.
Sir Ralph wurde kurz vor der Abschaffung der Todesstrafe 1964 gehängt. Noch unter dem Galgen hatte er seine Unschuld beteuert. Cecily Kohler verbüßte eine lange Haftstrafe. Nie gelang es, die ganze Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, denn unter den Gästen befanden sich an dem verhängnisvollen Wochenende auf Mickledore ein Minister, zwei hochrangige Diplomaten sowie ein reicher und spendabler Geschäftsmagnat – Männer, die alle Hebel in Bewegung setzten, sich aus dem Ermittlungsverfahren zu stehlen. Reginald Hill – Ins Leben zurückgerufen weiterlesen
Stephen King: Wolfsmond (Der Dunkle Turm 5)

Max Allan Collins – CSI Las Vegas: Tod im Eis
„Never change a winning team“, lautet eine alte Binsenweisheit, die sich dieses Mal jedoch nicht verwirklichen lässt. Die bewährte Nachtschicht-Besatzung des „Crime Scene Investigation” (CSI) Las Vegas muss dieses Mal getrennt arbeiten, d. h. Tatorte sichern und meist quasi unsichtbare oder sogar unmögliche Spuren untersuchen. Gil Grissom, der Chef, und seine Kollegin Sara Sidle nehmen an einer Konferenz im fernen und winterlichen Bundesstaat New York teil.
Zurück bleiben Grissoms Stellvertreterin Catherine Willows und ihre Mitarbeiter Warrick Brown und Nick Stokes. Sie werden mit einem seltsamen Leichenfund konfrontiert: Weit außerhalb von Las Vegas wurde in der Wüste eine tote Frau gefunden. Der Mörder hat sich viel Mühe gegeben, die Spuren seiner Untat zu vertuschen: Sorgfältig hat er die Leiche eingefroren und sich nun erst ihrer entledigt. Max Allan Collins – CSI Las Vegas: Tod im Eis weiterlesen
Nigel Marven & Jasper James – Monster der Tiefe. Im Reich der Urzeit

Nigel Marven & Jasper James – Monster der Tiefe. Im Reich der Urzeit weiterlesen
Suzuki, Kôji – Ring III – Loop
Die Welt irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft: Das ringförmige MHCV-Virus löst den Erreger der AIDS-Pest als unheilbaren Massenkiller Nr. 1 ab. Vor allem in Nordamerika und Japan erkranken die Menschen an einer neuen Sorte Krebs, der sich trotz fortgeschrittener Heilungsmethoden nicht stoppen lässt.
Auch die Eltern des Medizinstudenten Kaoru Futami aus Tokio sind betroffen. Der erst 20- Jährige sucht verzweifelt nach Rettung. Eine Reihe mysteriöser Zufälle führt ihn auf die Spur des bizarren „Loop“-Projekts. Fast vier Jahrzehnte zuvor hatten Forscher in den Vereinigten Staaten und Japan mehr als 1,2 Millionen Computer zusammengeschaltet, um eine Simulation künstlichen Lebens zu erschaffen. Das Experiment glückte zunächst und schuf eine Welt, die zum Spiegelbild der Realität wurde. Bevölkert wurde der „Loop“ schließlich von „Menschen“, die nie ahnten, dass sie nur im Inneren einer digitalen Matrix existierten.
Das „Loop“-Projekt scheiterte, als eine virtuelle Epidemie ihre Bewohner befiel und aussterben ließ. Das Grauen trug die Gestalt einer jungen Frau namens Sadako Yamamura, die es mit Hilfe eines trickreich verseuchten Videobandes in die künstliche Welt brachte. Schließlich bestand der „Loop“ nur noch aus Yamamura-Kopien und starb schließlich aus. Das Projekt wurde abgebrochen, sein Schöpfer, der Amerikaner Christopher Eliott, zog sich in die wissenschaftliche Emigration zurück.
Doch ist der „Loop“ wirklich „tot“? Kaoru kommt der schreckliche Verdacht, dass der „Ring“-Virus gar nicht Ergebnis einer natürlichen Mutation ist, sondern ursprünglich aus dem „Loop“ kam. Wenn dem so ist, müssten sich in den Unterlagen des Projekts Hinweise auf seine Bekämpfung finden lassen. Kaoru macht sich deshalb auf in die USA. In der Wüste New Mexicos stößt er auf das, was er gesucht hat. Allerdings ist die Wahrheit hinter dem „Loop“-Mirakel ist weitaus grotesker als der gesunde Menschenverstand es sich träumen ließe – und Kaoru entpuppt sich als Schlüssel zur einzigen Hoffnung für die Menschheit, die in einer bizarren Verschmelzung zwischen Realität und Simulation liegt …
Erfolge in Serie – seien sie geschrieben oder verfilmt – unterliegen wie die Protagonisten unserer Geschichte einem Fluch: Sie verlieren an Wirkung und schwächen sich zur Routine ab. Auch [„Ring II – Spiral“ 251 bestätigte diese alte Binsenweisheit aufs Bedauerlichste. Das drosselt die Erwartungen, die sich an eine weitere Fortsetzung knüpfen.
Überraschung: „Ring III – Loop“ ist ein sauber geplotteter und flott geschriebener Lesespaß, der den allzu routinierten Vorgänger glatt vergessen lässt. Tatsächlich ist der dritte (und bisher letzte) Roman der „Ring“-Reihe womöglich der beste. Dafür gibt es mehrere Gründe.
So gefällt vor allem Suzukis Bereitschaft, sich von den Wurzeln seiner Saga zu lösen. [„Ring“ 170 begann als Gruselgeschichte um eine ermordete, von den Toten rächend auferstehende Geisterfrau, die sich der (zum Zeitpunkt ihres Erscheinens) modernen Technik bediente, um Schrecken und Tod über ihre Opfer zu bringen. Später löste Science-Fiction den Horror ab: Sadako Yamamura „outete“ sich als personifizierte Inkarnation eines intelligent gewordenen Virus‘, der sich die Menschenwelt untertan machen wollte.
Dies lesen und sich fragen, wie es jetzt noch weitergehen könnte, lag nahe. Verfasser Suzuki ließ sich vier Jahre Zeit. Ihm gelang es in der Tat, eine logische Fortsetzung für seine Geschichte zu finden. Das muss freilich an dieser Stelle betont werden, denn inzwischen ist Suzuki ein Opfer der Zeit geworden: „Loop“ scheint die Imitation der Hollywood-Blockbuster-Trilogie „Matrix“ zu sein, so zahlreich sind die inhaltlichen Parallelen. Tatsächlich ist es höchstens umgekehrt, denn „Ring III“ war früher da. Offenbar haben sich eher die Wachowski-Brüder „inspirieren“ lassen …
Wobei die Idee der simulierten zweiten Realität ohnehin ein alter Hut der Science-Fiction ist. Daniel F. Galouye hat mit „Simulacron-3“ (dt. „Welt am Draht“/“Simulacron-Drei“) 1964 sicherlich den (verfilmten) Klassiker geschaffen. Der von der Kritik verehrte Philip K. Dick hat diese Idee gleich mehrfach kongenial durchgespielt, vielleicht am effektvollsten 1969 mit [„Ubik“ 652 (dt. „Ubik“).
Auch Suzuki hat also das Rad nicht erfunden, aber er weiß es im Rahmen seiner Möglichkeiten geschickt rollen zu lassen. Selbstverständlich könnte man mäkeln – über den allzu kunstlosen Erzählstil, die nur scheinbar dreidimensionalen Figuren, über die unnötige Reise nach USA, die vollständige Entzauberung des Yamamura-Mythos … Doch was ist die „Ring“-Saga eigentlich? Doch „nur“ Unterhaltungs-Handwerk, eine spannende Geschichte, die hier mutig ein neue Wendung nimmt und nicht nur ihre gelungene Fortsetzung, sondern auch eine zufriedenstellende Auflösung erfährt.
Dass „Ring III“ in der Zukunft spielt, wird übrigens nur am Rande deutlich. Science-Fiction kommt höchstens ins Spiel, wenn Suzuki (halbwegs) glaubhaft Technobabbel kreiert, wo virtuelle Welten oder Klone geschaffen werden. Politisch und gesellschaftlich hat sich sonst offenbar auf der Erde nichts Gravierendes getan.
Es klang bereits an: Von liebgewonnenen Figuren der „Ring“-Folgen 1 und 2 müssen wir uns verabschieden. Ein Trostpflaster schenkt uns der Verfasser jedoch: Der allzu neugierige Journalist Asakawa, die böse Sadako Yamamura sowie der zynische Ryuji Takayami tauchen in einer ausführlichen Rückblende auf, die (da war Suzuki im zweiten Teil wesentlich ungeschickter) nicht einfach eine Nacherzählung der Vorgeschichte ist, sondern diese gleichzeitig des besseren Verständnisses wegen und zur Erinnerung erzählt und gleichzeitig in ihren neuen, veränderten Handlungsrahmen stellt.
Ansonsten treffen wir – nicht ohne Grund, wie wir schließlich erfahren – in der Person des Kaoru Futami die typische „Ring“-Hauptfigur wieder: Der junge Mann ist eigentlich nur neugierig (bzw. in diesem Fall wissbegierig), ein Jedermann, der eher zufällig in das bedrohliche Geschehen verwickelt wird und dabei mächtig einstecken muss. Eine unglückliche Liebesgeschichte gehört ebenfalls zum Plot, während es dieses Mal keinen guten Freund an der Seite des Helden gibt.
Die japanische Welt ist dem westlichen Leser in „Ring III“ nur mehr bedingt fremd. Suzuki hat seine Geschichte „globalisiert“, lässt sie auf vielen Seiten sogar in den USA spielen. Nur noch selten finden sich die interessanten Eigenheiten der japanischen Gesellschaft. Weiterhin Unzufriedenheit dürfte bei den weiblichen Lesern die traditionelle asiatische „Unterwürfigkeit“ der auftretenden Frauen hervorrufen.
Christopher Eliott zieht als ebenso weiser wie undurchsichtiger „Gottvater“ aus dem Hintergrund die Fäden. Wie er seinen „Sohn“ zur Rettung der Welt schickt, weist durchaus Parallelen zur biblischen Geschichte auf, was zweifellos beabsichtigt ist und immer noch dazu taugt, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen und der Kritik Vielschichtigkeit vorzugaukeln.
Suzuki Kôji wird uns auf dem Cover inzwischen nicht mehr als „Japans Antwort auf Stephen King“ verkauft, sondern hat es zu „Japans Bestsellerautor #1“ gebracht; praktisch, wenn ein Land so weit entfernt und fremdartig ist, dass sich solche Behauptungen kaum überprüfen lassen … So enthusiastisch dröhnt jedenfalls die Werbung, die stets auf der Suche nach einer Schublade für neue, kommerziell noch unerprobte Talente ist.
Ob Kôji im Land der aufgehenden Sonne tatsächlich den zugewiesenen Ruhm genießt, müssen wir glauben oder nicht. Was wir wissen: Bis 1991 kannten auch die Japaner Kôji nicht. Der 1957 geborene Schriftsteller rackerte da noch redlich um Lohn, Brot und Ruhm; für die ersten beiden musste für einige Jahre seine Ehefrau, eine Lehrerin, sorgen. Als Absolvent der Keio University in Tokio hatte Kôji 1990 einen (japanischen) „Fantasy Novel Award“ für seinen Roman „Rakuen“ gewonnen, aber erst „Ring“ gab ab 1991 seiner dahindümpelnden Karriere den ersehnten Schub. Aus dem Geheimtipp wurde Gruselvolkes Eigentum, als Regisseur Hideo Nakata 1998 diesen Roman verfilmte. Trotz vieler Änderungen wurde „Ring“ zum internationalen Erfolg, der selbstverständlich mehrfach fortgesetzt wurde sowie die übliche verwässerte Hollywood-Interpretation erfuhr.
Wen es drängt, sich tiefer in das „Ring“-Universum ziehen zu lassen, sei auf die zahlreichen einschlägigen Websites verwiesen. Ihrem Rezensenten gefiel am besten http://ringworld.somrux.com – außerordentlich ausführlich und wunderbar gestaltet. Hier kann man sich wirklich verlieren.
Ruth Rendell – Dunkle Wasser
Kingsmarkham ist eine Kleinstadt in der britischen Grafschaft Sussex. In diesem Spätherbst haben sintflutartige Regenfälle den Kingsbrook und die anderen Flüsse über die Ufer treten lassen. Ganze Landstriche versinken in den Fluten, ein Ende der Wolkenbrüche ist nicht abzusehen. Auch dem Haus von Chief Inspector Reginald Wexford droht die Überflutung. Der Kriminalist ist daher abgelenkt, als dem Dezernat für Kapitalverbrechen ein seltsames Vorkommnis gemeldet wird: Die Geschwister Giles (15) und Sophie (13) Dade sind verschwunden. Ebenfalls vermisst wird Joanne Troy, eine Freundin der Familie, die ein Auge auf sie halten sollte.
Während Vater Roger, ein strenger und humorloser Mann, das Verschwinden seiner Kinder vor allem als Ärgernis zu betrachten scheint, verfällt Mutter Katrina der Hysterie und vermutet Sohn und Tochter irgendwo ertrunken in den Hochwasserfluten. Ein bei der Suche angeschwemmtes Shirt von Sophie könnte dies bestätigen, aber Wexford glaubt eher an eine Entführung. Ruth Rendell – Dunkle Wasser weiterlesen
Michael Connelly – Kein Engel so rein (Harry Bosch 8)

Carol O’Connell – Falscher Zauber [Mallory 5]

Carol O’Connell – Falscher Zauber [Mallory 5] weiterlesen
Rainer Eisfeld/Wolfgang Jeschke – Marsfieber. Aufbruch zum Roten Planeten. Phantasie und Wirklichkeit

Dieses Buch bietet einen Streifzug durch die Geschichte der Marsforschung. In zehn Kapiteln wird sie konterkariert durch die Dokumentation des Einflusses, den der rote Planet auf Kunst, Literatur und Film nahm. Die Darstellung setzt zeitlich nicht in der Vorzeit oder der Antike, sondern mit dem Beginn der Neuzeit oder präziser: mit dem Beginn der modernen Astronomie Ende des 16. Jahrhunderts ein. Die Instrumente dieser Epoche ermöglichten zum ersten Mal einen direkten Blick auf den Mars und signalisierten den Start seiner wissenschaftlichen Erforschung.
Frisch erworbenes Wissen wirft stets weitere Fragen auf und befördert ganz neue Dimensionen des Irrtums. Das „Marsfieber“ schreibt in dieser Hinsicht ein eigenes Kapitel. Noch viele Jahrhunderte blieben die Teleskope erdgebunden. Aufgrund der astronomischen Entfernung blieb das Bild vom Mars buchstäblich vage. Wie man das, was man nicht richtig sehen konnte, durchaus guten Gewissens erfand, stellt eine Lektion in wissenschaftlicher Fantasie dar: Eisfeld und Jeschke drucken viele Marskarten ab. Sie zeigen eine Marsoberfläche, die es niemals gab. Rainer Eisfeld/Wolfgang Jeschke – Marsfieber. Aufbruch zum Roten Planeten. Phantasie und Wirklichkeit weiterlesen
Dawkins, Richard – entzauberte Regenbogen, Der. Wissenschaft, Aberglaube und die Kraft der Phantasie
Isaac Newton ist an allem Schuld. Seit er vor Jahrhunderten schon seine Mitmenschen darüber aufklärte, wie ein Regenbogen zustande kommt, wird er als Repräsentant einer elitären, allzu neugierigen, gottlosen Bande von Zeitgenossen geschmäht, die es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Welt der Wunder und Rätsel in einen seelenlosen Monumental-Mechanismus zu verwandeln. Dichter, Kirchenleute, denkfaule Dummköpfe und natürlich Volkes Stimme schimpf(t)en laut ob solcher Blasphemie und nutzten gleichzeitig die Gelegenheit, den Forschern – weltfremde, gutes Geld verschwendende, d. h. „echte“ Arbeit scheuende Elfenbeinturmbewohner – die Eierköpfe zu waschen.
Im derzeitigen Klima einer wirtschaftlichen Rezession in der westlichen Welt sind solche Vorurteile lebendiger denn je. Wieso es keinen Grund gibt sich den Ignoranten, den Sparschweinen und den Sauertöpfen zu beugen, versucht schon seit Jahren der Evolutionsforscher Richard Dawkins deutlich zu machen. Er vertritt die Meinung, dass die wahre Faszination der Natur nicht in dem liegt, was der Mensch in sie projiziert, sondern in ihrer Realität: Der Regenbogen wird durch seine Erklärung nicht „entzaubert“. Statt dessen öffnet die Deutung dem Interessierten eine völlig neue Dimension: Die Natur verwandelt sich plötzlich vom Spielball manipulierender Dogmatiker, selbst ernannter Vordenker oder skrupelloser Geschäftemacher in ein für sich selbst stehendes Wunderland schier unbegrenzter Möglichkeiten.
Dies nachzuvollziehen ist keine einfache Aufgabe. Schon im Vorwort macht der Verfasser seinen Lesern keine Illusionen: Hier werden keine leicht verdaulichen Informationshäppchen geliefert. Der Leser muss das Hirn schon anwerfen und benutzen, sonst klappt es nicht mit der Datenübertragung. Das darf man jedoch nicht zu streng nehmen: Dawkins bemüht sich um eine allgemein verständliche Sprache, die selbst hoch komplexe Prozesse erfassbar macht, ohne dass dafür die naturwissenschaftliche Realität mit Füßen getreten wird. Die angenehme Überraschung: Es funktioniert.
Mit „Die betäubende Wirkung des Vertrauten“ bereitet Dawkins das Terrain für das Folgende vor. Er schildert in lebhaften Worten die Einzigartigkeit der realen Schöpfung, die wundergläubige oder zaghafte Gesellen gegen selbst erdachte Spinnereien einzutauschen bereit sind. Bereits hier wird Dawkins‘ Argumentation klar: Die Klarheit ist dem Verharren im Bekannten, scheinbar Bewährten allemal vorzuziehen, ohne dass darunter die Eindruckskraft der Schöpfung leidet.
Statt dessen nimmt sie zu, und dies zu vermitteln sollte nicht nur Aufgabe, sondern auch Anliegen derer sein, die nicht mit der Wissenschaft, sondern eher mit der Feder umzugehen wissen. „Im Salon der Herzöge“ erzählt von der nach Auffassung des Verfassers unnötigen, ja schädlichen Unverträglichkeit von Forschern und Dichtern. Dawkins lässt einen „natürlichen“ Konflikt nicht gelten, sondern verweist erneut auf die Herausforderung, die Realität in Worte zu fassen.
Auf diese Weise vorbereitet beschreiten wir nun an Dawkins Seite diverse Wunderwelten. „Strichcodes in den Sternen“ überschreibt der Verfasser jenes Kapitel, das uns das Wesen des Universums näher bringt. Von Newtons Beobachtung, dass ein gläsernes Prisma das Licht in eine genau zu definierende Palette von Farben bricht, bis zur Entdeckung, dass sich so Aussagen auch über die Struktur unendlich weit entfernter Sterne treffen lassen, spannt sich das Spektrum – Dawkins‘ erster überzeugender Beweis dafür, dass der Realist der Welt mindestens so viel Poesie abgewinnen kann wie der Träumer.
„Strichcodes in der Luft“ führt in eine weitere Wunderwelt ein – die des Schalls, der sich ähnlich entwirren und zur Lösung mannigfacher Probleme und Fragen einsetzen lässt. Für den Leser, der dennoch hartnäckig nach dem „Nutzen“ von Forschung fragt, verfasste Dawkins den Beitrag „Strichcodes vor Gericht“, was sicherlich die Fans der diversen „CSI“-Fernsehkrimis sogleich aufhorchen lässt.
„Märchen, Geister, Sternendeuter“ leitet den vielleicht spannendsten Abschnitt dieses Buches ein. Es geht um jene, die den Regenbogen nicht erklären, ihn aber auch nicht entzaubern, sondern ihn um des eigenen Vorteils missbrauchen – und um jene, die missbraucht werden wollen, weil sie lieber in einer Hokuspokuswelt angeblicher „Wunder“ als im Hier und Jetzt leben. Dawkins ist ein Mann, der keine Rücksicht auf den Zeitgeist nimmt, der Astrologie, Parapsychologie, New-Age-Gewaber und UFO-Esoterik schätzt oder gar der Wissenschaft vorzieht. Wieso dem so ist und warum er dies als echte Gefahr (z. B. im Zusammenhang fundamentalistischer Unterdrückungs-Religion) betrachtet, weiß er hier und im Kapitel „Berechnete Schauer“ sehr deutlich zu machen.
„Wolkige Symbole von höchster Romantik“ straft die moderne „Voodoo Science“ ab. Sie kleiden abstruse Theorien in wohl klingende Worte und missbrauchen die Realität, indem sie diese nach eigenem Gusto verbiegen. Das Nachsehen haben wieder einmal die redlichen, aber leider grauen, weil weniger wortgewandten, von den Medien missachteten, lobbylosen Labormäuse, deren auf langwierigen Nachforschungen basierende Urteile einfach nicht „attraktiv“ genug für die breite Öffentlichkeit ausfallen.
Dann wird es Ernst. Dawkins, der Evolutions-Spezialist, wählt den eigenen Fachbereich, um den Zauber der wissenschaftlich fundierten Realität im Detail zu belegen. Er wählt ein schwieriges, aber auch hochaktuelles Thema, denn es geht um Gene. „Der egoistische Kooperator“ berichtet von der aus brachialökologischer Sicht höchst unbeliebten Tatsache, dass sich das Leben auf der Erde primär per Konflikt weiterentwickelt und keineswegs eine übergeordnete „kosmische Intelligenz“ es kooperieren lässt. Harte Fakten beschreiben den Weg des Lebens, dem romantische Interpretationen höchstens nachträglich und zwanghaft übergestülpt werden können.
„Das genetische Totenbuch“ ist ein „Friedhof“ von Genen, die womöglich ursprünglich wichtige Aufgaben erfüllten, aber inzwischen ihre Bedeutung verloren haben. Ihre Deutung ermöglicht vielleicht einen Blick in die Vergangenheit. „Die Welt wird neu verwoben“ leitet in die Gegenwart über. Dawkins führt aus, dass unser Gehirn die Welt weniger registriert als übersetzt. Seine unglaubliche Leistungsfähigkeit lässt sich eben nicht oder nur bedingt durch den Vergleich mit dem technischen Wunderwerk Computer erklären. Das Gehirn hat zur Interpretation tausendfacher Umwelteinflüsse seine eigenen Methoden entwickelt; es schafft sich schon seit Äonen seine „virtuelle Realität“, die wir nur zum Teil entschlüsseln können, aber bereits bestaunen sollten.
Unter dem flappsigen Titel „Ein Ballon zum Denken“ spekuliert Dawkins darüber, wie das Gehirn seine einzigartige Kraft entwickelt haben könnte. Das lässt ihn letztlich den Kreis schließen, denn es war genau dieses Hirn, das ein Buch wie dieses ermöglichte, welches stellvertretend für die „richtige“ Art steht, sich die Welt zu erschließen. Noch einmal hält Dawkins sein Plädoyer gegen Augenwischerei und Aberglaube und für die Poesie der (naturwissenschaftlichen) Realität.
Und er hat zumindest die Realisten unter seinen Lesern überzeugt. Dawkins ist ein Romantiker. Das gibt er zu; dass für ihn die Poesie zur Naturwissenschaft gehört, macht schon der (manchmal allzu) reichliche Einsatz von Zitaten bekannter Literaten wie Shakespeare, Keats & Co. deutlich. Dies unter Beweis zu stellen, ist schließlich auch sein aktuelles Vorhaben.
Jenen, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, legt Dawkins eine Fülle überzeugender Beweise dafür vor, wieso man unter der gemütlichen „Akte X“-Decke hervor und an die frische Luft der blanken Tatsachen sollte. Diese Luft mag einem zwar zunächst kalt ins Gesicht blasen, aber sie macht den Kopf klar, statt das Hirn mit lauwarm vorgewärmten und -gekauten, aber eben erfundenen „Fakten“ zu verkleistern. Dies wird übrigens nur der unverbesserliche Weltverschwörungstheoretiker als Arroganz verstehen, denn Dawkins bemüht sich auch, den Mechanismen nachzuspüren, die Pseudowissen so attraktiv wirken lassen.
In einem ist Dawkins freilich konsequent. Überhaupt kein Verständnis bringt er für jene gefährlich dummen Zeitgenossen auf, die Wissenschaft nur unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt gelten lassen wollen. Auf diese Weise lässt sich leicht ein neues geistiges Mittelalter erzeugen; der Verfasser kann beunruhigend gute Argumente dafür anführen.
Wichtiger noch: Dawkins ruft jene, die hinter die Kulissen der Natur schauen wollen, zur Standhaftigkeit auf. Allzu mürbe sind die Vertreter „unnützer“ Wissenschaften bereits geworden; sie neigen dazu sich dem Urteil der „Realisten“ zu beugen, das eigene Wissen zu verleugnen, es in Frage zu stellen. Dawkins steuert dagegen, legt die Ungeheuerlichkeit dieser Verkehrung aller Werte offen: Wer viel weiß, solle nicht stolz im Sinne von überheblich, sondern selbstbewusst und froh durchs Leben schreiten, so sein Rat, denn er oder sie habe allen Grund dafür. Auf Unwissenheit oder gar Ignoranz brauche man sich dagegen überhaupt nichts einbilden.
Das ist nicht nur Balsam für geplagte Eierkopf-Seelen, sondern ein schlichtes Faktum: Obwohl die Wissenschaft – die schließlich von Menschen betrieben wird – der Menscheitsgeschichte ihren Teil an Irrtümern, Tragödien und Verbrechen zugefügt hat, lässt sich ihr fundamentaler Anteil am Fortschritt nicht leugnen. Deshalb gibt es keinen Grund, sich falschen Kritikern zu beugen oder sich gar von pseudo-ökologischen Bilderstürmern und fanatisierten Weltverbesserern gängeln zu lassen. (Damit es klar ist: Dawkins setzt diese nicht mit Umweltschützern oder anderen konstruktiven Gruppen gleich.) Selbst wenn man im Detail nicht mit dem Verfasser übereinstimmen mag (der sich manchmal vom gerechten Zorn gar zu sehr hinreißen lässt), ist sein Werk doch wie ein einsamer Leuchtturn über einer See der Ignoranz und lohnt deshalb die Lektüre, auch wenn manchmal der Kopf dabei zu schmerzen beginnt; es ist ein gutes Gefühl, das Hirn wirklich in Gang zu setzen …
Richard Dawkins wurde 1941 in Nairobi geboren. Die Familie verließ Kenia 1949 und kehrte nach England zurück. Dort studierte Richard in Oxford. Seinen Abschluss als Zoologe machte er 1962, blieb aber zunächst in Oxford, um als Doktorand für und mit dem berühmten Ethnologen Nikolaus Tinbergen zu arbeiten. 1967 ging Dawkins nach Kalifornien und lehrte in Berkeley, kehrte aber 1970 als Dozent nach Oxford zurück.
Sein erstes Buch („The Selfish Gene“; dt. „Das egoistische Gen“) erschien 1976 und wurde sogleich ein internationaler Sachbuch-Bestseller. Es folgten „The Blind Watchmaker“ (dt. „Der blinde Uhrmacher“) und 1982 seine Fortsetzung „The Extended Phenotype“. Weitere Erfolge: „River Out of Eden“ (1995, dt. „Und es entsprang ein Fluss in Eden“), „Climbing Mount Improbable“ (1996, dt. „Gipfel des Unwahrscheinlichen“) und „Der entzauberte Regenbogen“.
Schon früh setzte sich Dawkins dafür ein, Wissen dort, wo es angebracht war, allgemein verständlich zu vermitteln. Folgerichtig ist er der erste Inhaber des 1995 ins Leben gerufenen „Charles Simonyi Chair of Public Understanding of Science“.
Gleichzeitig bemühte sich Dawkins um die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Literatur, die er persönlich nicht im Widerstreit sieht. Für seine Bemühungen nahm ihn 1997 die „Royal Society of Literature“ auf.
Weitere Fakten zu Leben und Werk lässt sich folgender Website entnehmen: http://www.brainyencyclopedia.com/encyclopedia/r/ri/richard__dawkins.html
Jules Verne – Reise zum Mittelpunkt der Erde

Jules Verne – Reise zum Mittelpunkt der Erde weiterlesen
Elizabeth Peters – Im Tal der Sphinx
Ägypten im Herbst des Jahres 1895. Unter den vielen ausländischen Archäologen, die das uralte Land der Pharaonen erforschen (oder heimsuchen), finden wir das Ehepaar Radcliffe und Amelia (Peabody) Emerson. Sie zieht es ins Gräberfeld von Dahschur, wo vor mehr als 4500 Jahren der König Snofru zwei Pyramiden errichten ließ. Schon im Vorjahr war das Ehepaar im benachbarten Mazghuna aktiv gewesen und dabei auf die kriminellen Machenschaften eines Mannes gestoßen, der die Grabanlagen systematisch plündern ließ. Die Emersons hatten dem nur als „Sethos“ bekannten Räuberhauptmann dessen Beute abjagen können; er selbst war unter bitteren Racheschwüren entkommen. (vgl. „The Mummy Case“, dt. „Der Mumienschrein“).
Amelia, die sich auch als Amateur-Detektivin betätigt, ist auf der Hut, als nun die neue Grabungssaison beginnt. Ihr Misstrauen scheint berechtigt, als die Emersons noch in Kairo den Gauner Kalenischeff treffen, der im Vorjahr Sethos als rechte Hand diente. Nun bemüht er sich als Reisebegleiter um die junge Enid Debenham, die einzige Tochter des just verstorbenen Barons Piccadilly. Natürlich hat Kalenischeff es auf das Millionenerbe abgesehen, wie ihm Amelia auf den Kopf zusagt. Als kurz darauf ein Versuch knapp scheitert, Sohn Ramses zu entführen, weist sie die Schuld allerdings dem neuerlich aktiven Sethos zu. Ihre Überzeugung wächst, als Kalenischeff erdolcht in Miss Debenhams Hotelzimmer gefunden wird; offenbar hat sich sein Meister gerächt. Die Polizei verdächtigt allerdings Enid, zumal diese spurlos verschwunden ist. Elizabeth Peters – Im Tal der Sphinx weiterlesen