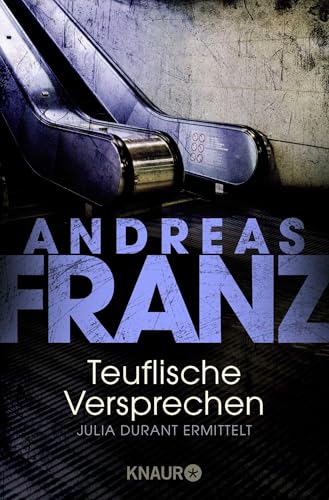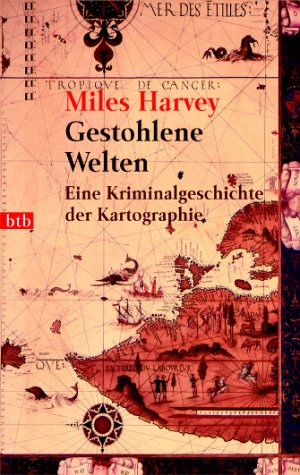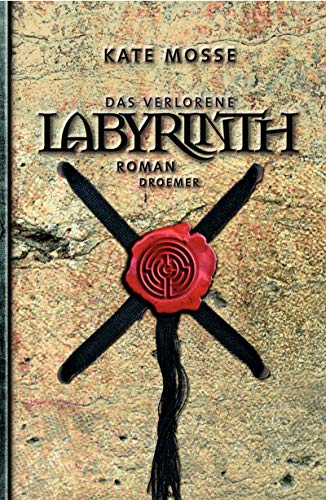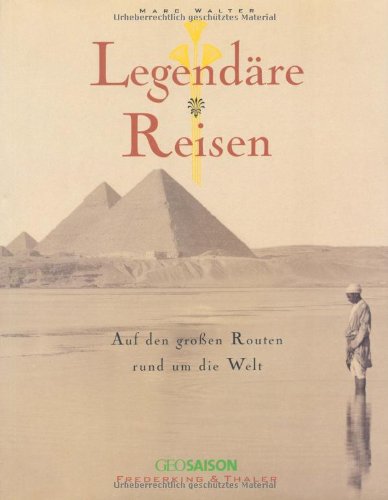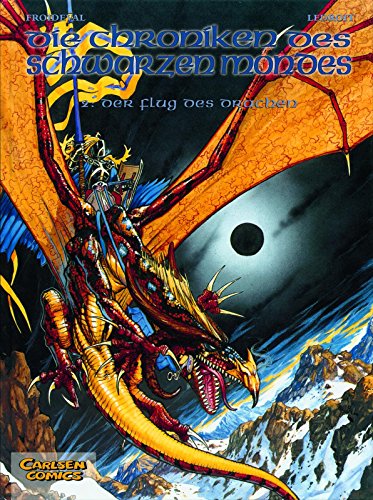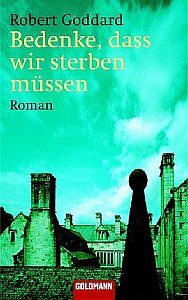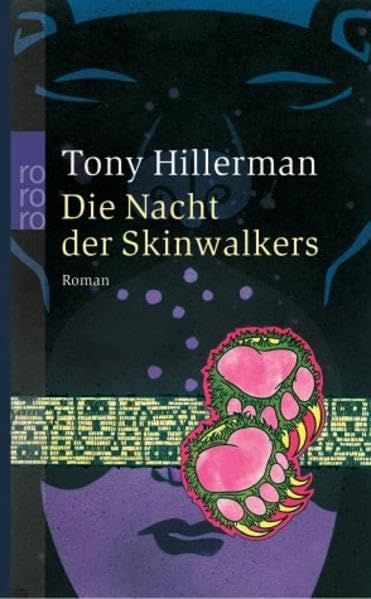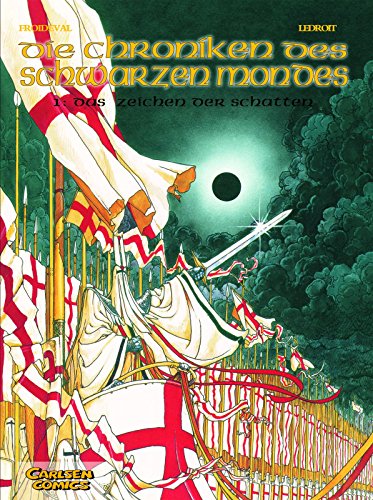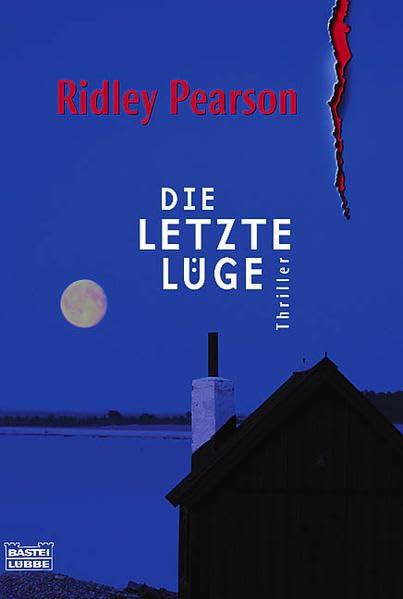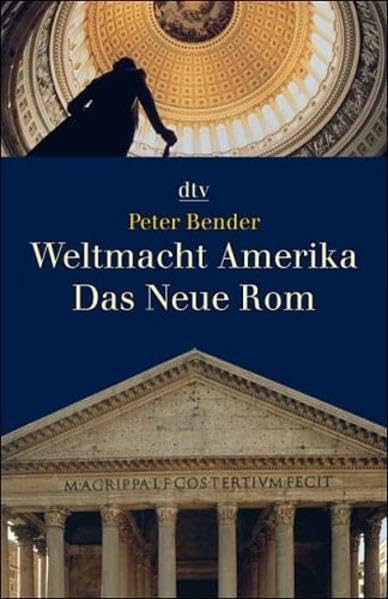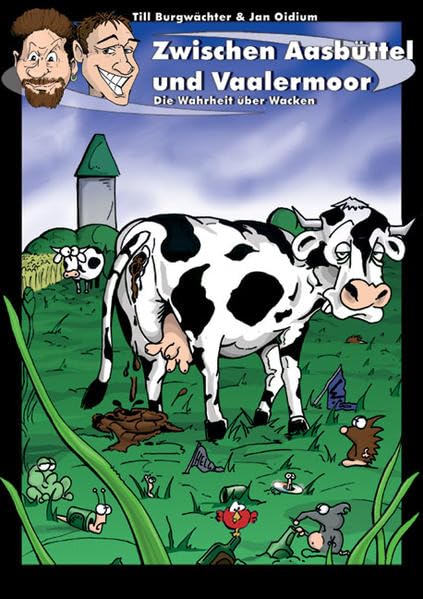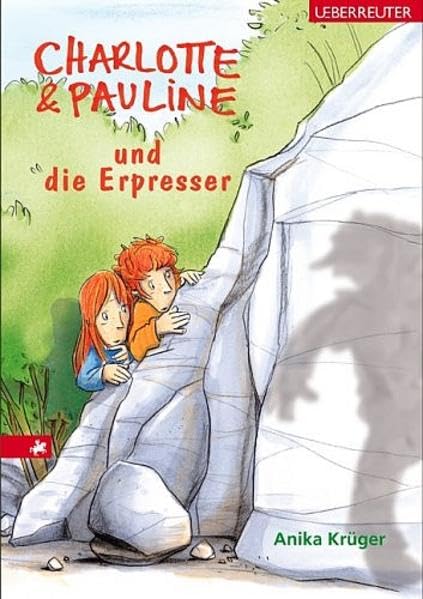_Auf der Flucht_
Bei einem Einkaufsausflug kann die junge Maria ihren beiden Bewachern entkommen. Völlig orientierungslos läuft sie durch die Straßen und flüchtet sich in die Praxis einer ihr unbekannten Psychologin. Dort erzählt Maria einen Teil ihrer Lebensgeschichte. Mit 17 wurde ihr in ihrer Heimat Moldawien versprochen, dass sie in Deutschland als Aupairmädchen arbeiten könne. Doch zunächst wird Maria nach Jugoslawien verschleppt, wo sie Deutsch lernen muss und gefügig gemacht wird. Mehrere Männer vergewaltigen sie abwechselnd. Auch in Frankfurt arbeitet sie nicht als Aupairmädchen, sondern als Edelhure in einem geheimen Bordell, in welchem nur berühmte Männer verkehren, die in den höchsten Kreisen sitzen und als Politiker oder auch Anwalt bekannt sind.
Die Psychologin Verena Michel weiß sich keinen Rat und ruft noch spätabends bei ihrer besten Freundin Rita Hendriks an, von der sie sich Hilfe erhofft. Auch Rita ist entsetzt von der Geschichte, die Maria zu erzählen hat. Am nächsten Tag trifft sich Rita mit einem befreundeten Journalisten, der zur Zeit an einem Buch über das organisierte Verbrechen in Deutschland arbeitet. Dietmar Zaubel kennt sich aus in diesen Kreisen und verweist Rita an Hauptkommissarin Julia Durant. Doch leider erreicht Rita Hendriks telefonisch nur Julia Durants Kollegen und kann Julia lediglich eine Nachricht zukommen lassen. Bevor Rita sich mit Durant treffen kann, erhält sie Besuch von einem angeblichen Blumenboten, der sie zu Tode foltert, weil er Marias Aufenthaltsort erfahren möchte.
Am gleichen Tag findet man auch den Journalisten Zaubel ermordet auf. Da Julia Durant von Hendriks und Zaubels Bekanntschaft weiß, ahnt sie sofort eine Verbindung zwischen beiden Morden. Ritas letztes Telefonat führt die Polizei schließlich zu Verena und zu der verängstigten Maria. Julia Durant kümmert sich um Maria und besorgt ihr eine sichere Wohnung. Anschließend stellt sie sich dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität, auch in dem Bewusstsein, dass sie diesen Kampf wohl nur verlieren kann, weil so hochrangige Persönlichkeiten darin verwickelt sind, dass keine Verfahren gegen sie eingeleitet werden können. Dennoch findet sich eine kleine Gruppe zusammen, die das geheime Bordell ausheben möchte. Um den Drahtziehern auf die Schliche zu kommen, macht Polizist Kullmer sich auf die Suche nach dem ominösen Marco Martini, von dem er angeblich 15 junge Frauen aus den Ostblockstaaten kaufen möchte. Das Spiel beginnt …
_Sodom und Gomorrha_
Andreas Franz fasst in seinem aktuellen Julia-Durant-Krimi ein heißes Eisen an, nämlich das organisierte Verbrechen, das sich hauptsächlich in den oberen Schichten der Gesellschaft abspielt und daher meist ungesühnt bleibt, weil immer jene Leute darin verwickelt sind, die alles vertuschen können. In seinem Roman zeichnet Franz ein düsteres Bild, das den Leser erschreckt und sicherlich auch erschrecken soll. Etwas paranoid beginnt man sich beim Lesen zu fragen, ob die Missstände in der heutigen Gesellschaft tatsächlich so groß sind und ob Macht und Ansehen wirklich reichen, um von Gefängnisstrafen verschont zu bleiben.
In der Person der Julia Durant bezieht Franz eindeutig Stellung zu diesem Thema und macht deutlich, dass es immer noch Menschen mit Idealen gibt, die nicht davor zurückschrecken, diesen aussichtslosen Kampf gegen die organisierte Kriminalität aufzunehmen. „Teuflische Versprechen“ zeigt, dass der Kampf zwar aussichtslos erscheint, aber die Mühen dennoch wert ist, auch wenn es vielleicht nur darum geht, ein Zeichen zu setzen. Inhaltlich gefällt „Teuflische Versprechen“ vom Grundkonzept daher sehr gut, an Düsternis und Hoffnungslosigkeit könnte der Krimi durchaus mit einem Mankellschen Roman konkurrieren, nicht jedoch, wenn es um die geschickte Inszenierung eines mitreißenden und ausgefeilten Plots geht. Hier offenbaren sich bei Andreas Franz einige Schwächen und Unstimmigkeiten.
So halte ich es für ziemlich unrealistisch, dass eine alleinstehende Frau sofort eine Wildfremde bei sich aufnimmt und gleich am ersten Abend sofort eine Vertrauensbasis zwischen den beiden Frauen zu spüren ist. Verena und Maria haben keine Scheu voreinander, entkleiden sich in Gegenwart der anderen Frau und bewundern gegenseitig ihre Figur, was ich doch etwas übertrieben finde. Auch dürfte so viel Hilfsbereitschaft, wie Verena Maria entgegenbringt, eher die ganz große Ausnahme sein. Aber hier setzt Franz dem Ganzen noch die Krone auf, als Rita Hendriks sich nämlich zu Tode foltern lässt, um nur nicht Marias Aufenthaltsort preiszugeben. Rita hat Maria nur ein einziges Mal getroffen und kennt sie kaum. Man kann wohl annehmen, kein normaler Mensch würde sich foltern lassen, um einen (fast) Unbekannten zu schützen.
Später inszenieren Julia Durant und ihre Kollegen schließlich eine Undercoveraktion, die mir wie eine ziemlich unüberlegte Hauruck-Aktion vorkommt; innerhalb weniger Tage wird ein Polizist in die Kreise des organisierten Verbrechens eingeschleust und hat sofort einen wasserdichten Lebenslauf parat, der jeglicher Überprüfung durch die Verbrecher standhält. Und obwohl bei dieser Aktion zahlreiche Menschen eingeweiht werden müssen, haben Durant und Co. so viel Glück, dass kein Verräter dabei ist (obwohl doch eigentlich überall die organisierten Kriminellen sitzen). Mir erscheint dies mehr als unwahrscheinlich, insbesondere vor dem Hintergrund der doch so ausweglos erscheinenden Situation. Auch das Buchende wirkt weichgespült, als hätte Andreas Franz den Mut verloren, seinem Kriminalfall ein angemessenes Ende zu verpassen.
Diese Unstimmigkeiten trüben den Gesamteindruck des Buches dann doch ein wenig, zumal gerade der Schluss nicht überzeugen kann.
_Krimihelden wie im Bilderbuch_
Auch die Figurenzeichnung macht einen schlichten Eindruck. Julia Durant erscheint zu perfekt, obwohl sie als alleinstehende und sich manchmal einsam fühlende Krimiheldin doch eigentlich recht realistisch wirken müsste. Aber auch hier relativiert Andreas Franz die negativen Seiten, fast als würde er seinen Lesern etwas anderes nicht zumuten wollen. So kommt Julia Durant mit einem pensionierten Pfarrer als Vater daher, der seine Tochter über alles liebt und der Meinung ist, dass Gott etwas ganz Besonderes mit seiner Tochter vorhat und sie daher aus gutem Grund Kriminalkommissarin geworden ist. Natürlich ist Julia Durant nicht einmal ansatzweise korrupt und umgibt sich auch nur mit vollkommen vertrauenswürdigen Kollegen, die sich ebenfalls ganz selbstlos in den Kampf gegen das organisierte Verbrechen stürzen. Am Ende greift Andreas Franz dann noch tiefer in die triefende Kitschecke und zerstört dadurch eigenhändig das vorher so düster beschriebene Bild.
Neben Julia lernen wir nur wenige Kollegen näher kennen, aber auch hier treffen wir nicht auf normale Alltagshelden, sondern auf Menschen, die selbst in großer Angst nie den Mut verlieren und immer den kühlen Überblick behalten. Die Klischees und Absonderlichkeiten setzen sich auch bei den anderen auftauchenden Personen fort, wie eben bei der völlig selbstlosen Rita Hendriks.
Leider wirken diese eindimensionalen Charaktere kein bisschen authentisch oder realistisch, sodass eine Identifikation nicht möglich wird und man sich auch nicht so recht in die Situationen einfühlen kann. Alles erscheint zu abstrus, als dass wir in die Geschichte eintauchen könnten.
_Pageturner par excellence_
Dem gegenüber muss man Andreas Franz zugute halten, dass er seine Leser dennoch fesseln kann. Besonders während der Einleitung der Undercoveraktion kann man das Buch kaum aus der Hand legen, weil die Ereignisse sich überschlagen und an mehreren Fronten gleichzeitig entscheidende Dinge passieren. Hier werden dann auch zwei Handlungsstränge zusammengeführt, sodass der Leser sich langsam ein klares Bild davon machen kann, was denn nun eigentlich vorgefallen ist und welche Verbrechen aufzudecken sind.
Andreas Franz‘ Schreibweise ist kurz und prägnant und trägt dadurch ebenfalls zum flüssigen Lesevergnügen bei. Der Roman ist kurzweilig und unterhaltsam, auch wenn sich die Unstimmigkeiten später immer mehr häufen.
Insgesamt bleibt ein mittelmäßiger Eindruck zurück. In Ansätzen gefällt „Teuflische Versprechen“ dabei wirklich gut. Anfangs zeichnet Andreas Franz ein düsteres Bild des organisierten Verbrechens und fesselt seine Leser durch die schrecklichen Dinge, die Maria hat erleiden müssen. Eigentlich hätte Franz daraus eine packende Geschichte schreiben können (müssen!), wenn er den Mut bewiesen hätte, nicht jede negative Seite durch positive Ereignisse zu relativieren. Ein weichgespültes Buchende passt so rein gar nicht in das Gesamtkonzept und wirkt ziemlich lieblos. Wäre dies nicht bereits der achte Krimi um Julia Durant und ihre Kollegen, würde ich behaupten, in der Figurenzeichnung wäre noch viel Raum für Weiterentwicklung, so allerdings empfinde ich diese eindimensionalen Charaktere als enttäuschend. Positiv fällt dagegen die flüssige Schreibweise auf, die dazu beiträgt, das Buch zu einem Pageturner zu machen.