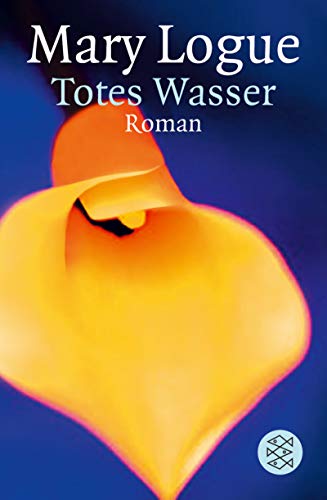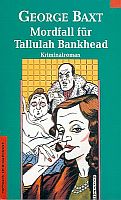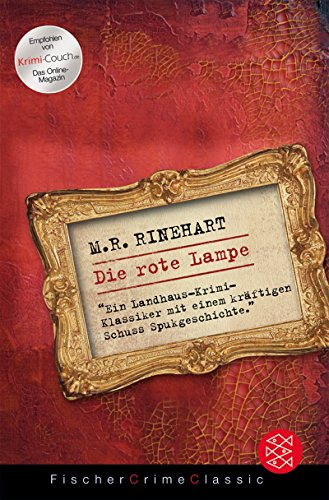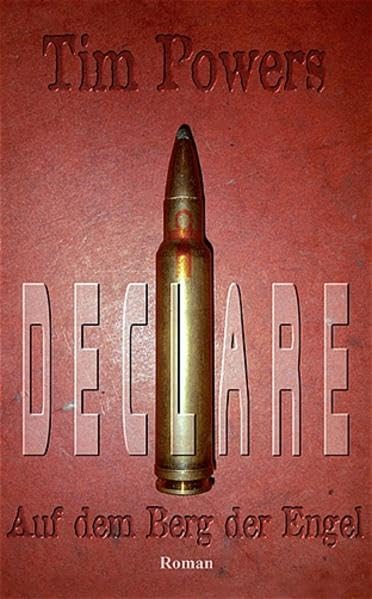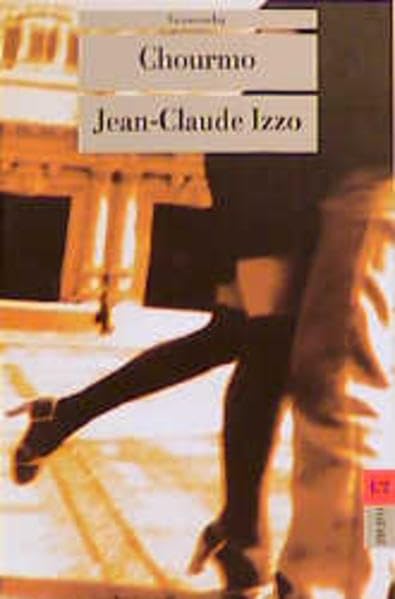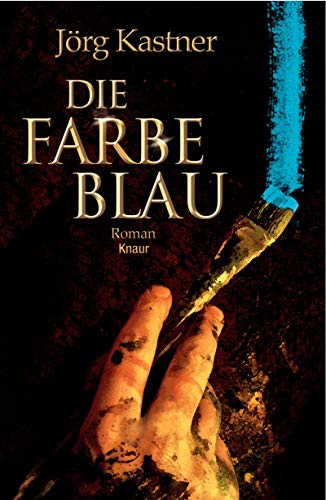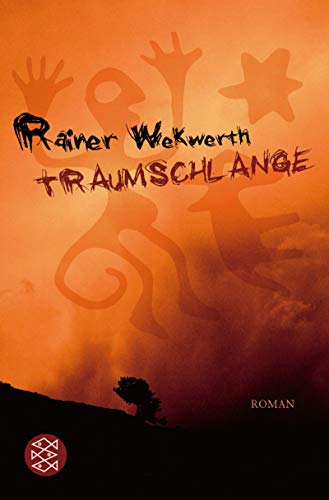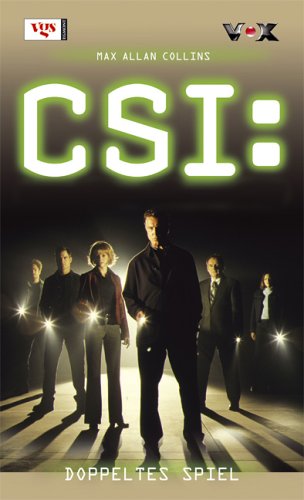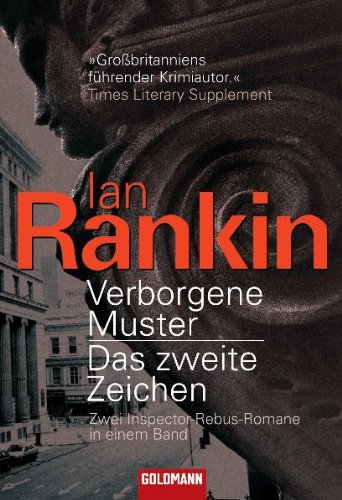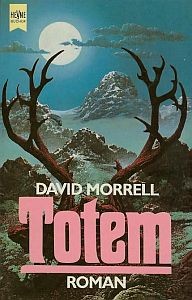Detective Superintendent (dieses Mal in der Übersetzung seltsamerweise & unnötig als „Kommissar“ betitelt) Andrew Dalziel, „der dicke Andy“ (auch „das Ekelpaket“, „der fette Bastard“ usw.) genannt, absolutistischer Herr der Kriminalpolizei von Mid-Yorkshire, muss zu seinem Ärger kurzfristig auf seinen besten Ermittler und Freund Peter Pascoe verzichten. Dem ist seine streitbare Oma Ada gestorben, um deren Bestattung und Nachlass er sich nun zu kümmern hat. Dabei fällt ihm aus einem Geheimfach des großmütterlichen Sekretärs ein altes Foto in die Hände. Es zeigt seinen Urgroßvater, der während des Ersten Weltkriegs in einer der vielen Schlachten bei Ypern 1917 gefallen ist.
Peter wird neugierig. Über ihren Vater hatte Ada nie reden wollen. Stattdessen stellte sie einen lebenslangen Hass auf alles Militärische zur Schau. Weil ihn das schlechte Gewissen plagt – mit der Großmutter hatte er sich vor Jahren zerstritten -, stellt er Nachforschungen über seinen Vorfahren an. Aus Interesse wird rasch Besessenheit, denn Peter stellt fest, dass ein düsteres Geheimnis das gar nicht so offizielle Ende des alten Soldaten umgibt.
In Mid Yorkshire lauert freilich schon Andy Dalziel auf seine Rückkehr. Militante Tierschützer haben ein versteckt im Wald gelegenes Pharmalabor überfallen. Es misslang ihnen, durch den Sperrgürtel ins Innere vorzudringen. Stattdessen fanden sie in einem Schlammloch ein menschliches Skelett. Dies lag dort wohl schon länger als das Labor existiert. Trotzdem ist Dalziel misstrauisch. Ihn irritiert der enorme Sicherheitsaufwand, der hier getrieben wird. Der Laborleiter ist auffallend nervös. Unter dem paramilitärisch gedrillten Wachpersonal erkennt Dalziel alte Bekannte, die manches Gefängnisjahr abgebrummt haben. Was geht also wirklich vor hinter diesen vorzüglich abgeschirmten Mauern – und hat Dalziels neue Liebe, die anarchistische Cap Marvell, etwas damit zu tun …?
Die Lektüre eines Dalziel/Pascoe-Romans von Reginald Hill bereitet dem vergnügten Leser jedes Mal eine Überraschung: Was hat sich der Verfasser nun wieder einfallen lassen, um sein Publikum zu unterhalten? Es gibt D/P-Krimis à la Agatha Christie, Politthriller, Noir-Parodien, Geister treten auf … Hills Fantasie sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Mit Genreelementen treibt er sein intelligentes Spiel. Puristen mögen ihm das übel nehmen. Wagemutige Leser dagegen schätzen es, immer wieder intelligent aufs Glatteis geführt zu werden – nun mit einem Historien-Drama; einem halben jedenfalls, denn Hill vergisst auch jene nicht, die einen „richtigen“ Mordfall gelöst sehen möchten (um stattdessen doch wieder aufs Kreuz gelegt zu werden).
Der Erste Weltkrieg, den man in England immer noch den „Großen“ nennt, gehört in die Reihe der nationalen Triumphe und Tragödien der Inselnation. Der zeitlich nähere Kampf gegen Nazideutschland verdeckt manchmal die Erinnerung an die unmenschlichen Schützengrabenschlachten zwischen 1914 und 1918, denen 750.000 Engländer zum Opfer fielen.
Der Triumph bestand darin, dass Großbritannien 1918 zu den Siegernationen gehörte. Auf diese Seite wird vor allem von offizieller Seite gern und oft aufmerksam gemacht. Von der Tragödie spricht man dagegen weniger gern: Tatsache ist, dass dieser Sieg nicht wegen, sondern trotz militärischer Befehlshaber errungen wurde, die ihre Soldaten unzureichend ausgerüstet in völlig sinnlose Kämpfe schickten, wo sie nicht selten täglich zu Zehntausenden umkamen. Erst recht nur ansatzweise thematisiert wird das Schicksal von Kämpfern wie dem älteren Pascoe, die zwar überlebten, durch das erlebte Grauen in den Kraterlöchern und Schützengräben jedoch buchstäblich verrückt wurden. Sie verdarben das glanzvolle Siegesbild, befleckten es gar, denn manchmal taten sie das Undenkbare: Statt für das Vaterland in einem namenlosen Schlammloch zu verrecken, ergriffen sie die Flucht, wollten nur nach Hause. Die Konsequenz: der Tod durch ein Hinrichtungskommando, das aus den eigenen Kameraden bestand. Es braucht keinen Feind, um vom Krieg verschlungen zu werden. Diese bittere Lektion ist es, die Peter Pascoe lernen muss, der auf seiner Zeitreise seine schwierige Familiengeschichte bewältigt und erleidet.
Wem das zu schwermütig klingt, sei auf die Eskapaden des fidelen Falstaff-Kriminalisten Andy Dalziel hingewiesen. In regelmäßigen Abständen tritt er in seiner unnachahmlichen Art auf die Bühne. Als Polizist dieses Mal kaum gedämpft von seinem Partner, läuft er zu ganz großer Form auf. Wie ein Tornado fällt er über Freund und Feind, über Verdächtige, Kollegen und ignorante Amtsträger gleichermaßen her. Kein bisschen lässt er sich durch die ungeschriebenen Regeln des Establishments beeindrucken: Hilfst du mir, dann geb’ ich dir – und Maul gehalten vor dem dummen Pöbel! Nichtsdestotrotz kennt Dalziel sich aus im Gefüge der Macht. Er ist seinen Gegnern stets einen Schritt voraus und verwirrt sie mit unerwarteten Schachzügen. So dröselt er den rätselhaften Todesfall am Großlabor denn auch von hinten auf und schlägt bei den Ermittlungen erstaunliche Hasenhaken. Natürlich löst er den Fall – aber der Leser darf sich an einer wendungsreichen Jagd erfreuen.
„Fröhliches Mäandern“ ist ohnehin ein Markenzeichen der Dalziel/Pascoe-Romane. Viele Krimileser der alten Schule (Untat – Ermittlung – Überführung – Sühne) ärgern sich über die Abschweifungen, die den Verfasser manchmal den roten Faden aus den Augen verlieren lassen. Reginald Hill hält sich nicht daran. Wieso auch, ergänzt er den klassisch strengen Handlungsablauf doch durch unterhaltsame Episoden, die zudem eine Chronik von Mid-Yorkshire erkennen lassen, die über nun schon viele Bände fortgesetzt wird. Und Vorsicht: Es kann durchaus sein, dass eine scheinbare Nebensache an anderer Stelle oder gar in einem späteren Roman wieder aufgegriffen wird. Insofern ist es natürlich schade, dass die D/P-Serie in Deutschland völlig planlos erscheint.
Nebenbei streut Hill, der Literaturkenner, wieder reichlich Zitate aus alten, halb oder ganz vergessenen Buch- oder Theaterklassikern ein. Man muss sie nicht zur Kenntnis nehmen. Sie bieten ein zusätzliches (intellektuelles) Vergnügen, denn sie kommentieren das Geschehen und geben versteckte Hinweise auf den Fortgang der Handlung. Zum ersten Mal folgt dem Roman zudem ein Glossar, das jene Anspielungen auflöst, welche die Übersetzung nicht überstanden – Hill ist ein Meister des Wortspiels – oder zu schade zum Überlesen sind; ein hübscher Einfall.
Mehr Raum als sonst räumt Reginald Hill wie schon gesagt dem unvergleichlichen Dalziel ein. Normalerweise dosiert er dessen Auftritte klug, so dass man sich freut, ihn wirken und wüten zu sehen. Peter Pascoe und – auf seine eigene, stille Weise – Sergeant Wield puffern seine Einmannfeldzüge normalerweise ab. Wir lesen außerdem oft nur indirekt über Dalziels Eskapaden, die von ehrfürchtigen Kollegen, Freunden und den vom Dalziel-Blitz Getroffenen im Stile von Heiligenlegenden erzählt werden. So nutzt sich die Figur nicht ab und kann ihre Einzigartigkeit sichern.
Dieses Mal stellt Verfasser Hill seinen Helden vor eine sogar für ihn schwere Herausforderung: Dalziel verliebt sich. Das ist für einen Mann seines Charakters eine ernste Sache, zumal die Angebetete erstens ebenfalls über einen veritablen Dickkopf verfügt und zweitens als Verdächtige in mindestens einem Mordfall gilt, was den auf Freiersfüßen wandelnden (oder besser stampfenden) Dalziel zu einem aberwitzigen Eiertanz zwischen Balz- und Ermittlungsspielchen zwingt.
Peter Pascoe ist der zögerliche oder besser nachdenkliche Part des dynamischen Duos. Nur zu oft muss Dalziel darauf achten, dass aus Denken nicht Grübeln wird. Pascoe neigt dazu, die Welt sehr schwer zu nehmen. Ihm geht das Talent seines Vorgesetzten und Freundes ab, Unerfreuliches an sich abtropfen zu lassen wie eine Ente das Wasser. Die Suche nach dem getilgten Urgroßvater ist ein Beispiel für Pascoes Engagement sowie sein Talent, sich in eine Sache zu verrennen. Dazu kommt seine liberale Ader, die ihm manchen inneren Konflikt beschert. Pascoe ist nicht zufrieden mit dem System, das allzu viele Schlupflöcher für schlaue Strolche mit guten Beziehungen bietet, während mancher arme Tropf auf der Strecke bleibt. Forciert wird dieser Konflikt durch Peters Gattin Ellen, eine nur mühsam zu mäßigende Radikale, die um der guten Sache gern bereit ist, öffentlichen Ärger zu beschwören, was der Karriere ihres Ehemanns verständlicherweise nicht gerade förderlich ist.
Dieses Mal geht es also gegen die Pharmaindustrie bzw. ein Labor, in dem Präparate an Tieren getestet werden. Ein militantes „Rettungskommando“ Mid-Yorkshirer Aktivistenfrauen begibt sich auf einen nächtlichen Einsatz. Was mit den befreiten Kreaturen geschehen soll, die in der freien Natur schneller umkommen würden als im besagten Labor – darüber haben sie sich keine Gedanken gemacht. Das ist auch unwichtig, denn es geht primär um „die Sache“: Hier macht sich Hills ironischer Witz besonders deutlich bemerkbar. Die meisten seiner Figuren sind leicht überzeichnet. Den Dalziel/Pascoe-Romanen fehlt der seifenoperliche Grundton, der pseudodramatisch-kitschige Beziehungsdramen aus einem schwierigen Polizistenleben in den Kriminalplot zwingen will. Hill kann ernst, nachdenklich, traurig werden. Er stülpt dies der Handlung jedoch nicht über oder lässt es diese gar überwuchern. (Man lese nur einen Elizabeth-George-Thriller aus jüngerer Zeit, dann ist sogleich klar, was gemeint ist.)
Lässt Hill also den nötigen Ernst vermissen? Wer legt eigentlich fest, dass nur ein „ernster“ Krimi ein „guter“ Krimi ist? Genau diese Haltung räumt zumindest hierzulande einem Henning Mankell immer das Primat vor einem Reginald Hill, einem Ian Rankin, einem Carl Hiaasen ein, die wichtige Themen und kluge Gedanken mit Witz präsentieren. Das ist ausgesprochen ungerecht sowie falsch, und das scheint auch dem deutschen Publikum klar geworden zu sein, das inzwischen die D/P-Serie so aufmerksam zur Kenntnis nimmt, dass sich die Lücken zwischen den übersetzten Bänden allmählich schließen.
Reginald Hill wurde 1936 in Hartlepool im Nordosten Englands geboren. Drei Jahre später zog die Familie nach Cumbria, wo Reginald seine gesamte Kindheit verbrachte. Später studierte er an der University of Oxford und arbeitete bis 1980 als Lehrer in Yorkshire, wo er auch seine beliebte Reihe um die beiden ungleichen Polizisten Andrew Dalziel und Peter Pascoe ansiedelte.
Deren Abenteuer stellen nur eine Hälfte von Hills Werk dar. Der Schriftsteller ist fleißig und hat insgesamt mehr als 40 Bücher verfasst – längst nicht nur Krimis, sondern auch Historienromane und sogar Science-Fiction. Einige Thriller erschienen unter den Pseudonymen Dick Morland, Charles Underhill und Patrick Ruell. Erstaunlich ist das trotz solcher Produktivität über die Jahrzehnte gehaltene Qualitätsniveau der Hill-Geschichten. Das schlägt sich u. a. in einer wahren Flut von Preisen nieder. Für „Bones and Silence“ zeichnete die „Crime Writers‘ Association“ Hill mit dem begehrten „Gold Dagger Award“ für den besten Kriminalroman des Jahres 1990 aus. Fünf Jahre später folgte der „Diamond Dagger“ für seine Verdienste um das Genre. Reginald Hill lebt mit seiner Frau Pat in Cumbria.
In Deutschland erschienen die frühen Dalziel/Pascoe-Romane im Wilhelm-Goldmann-Verlag. Nach mehr als zehnjähriger (beklagenswerter) Pause nahm sich das Verlagshaus |Europa| der Serie an und veröffentlichte die neueren Episoden vorzüglich übersetzt und angemessen im Hardcover. Die Taschenbuch-Ausgaben erscheinen bei |Knaur|. Inzwischen hat der Erfolg wohl auch hierzulande Reginald Hill endlich gefunden: Der 20. D/P-Roman („Die Launen des Todes“) erscheint bei Droemer, zeitgleich bringt Europa den „Wald des Vergessens“ auf den Buchmarkt.
Die Dalziel/Pascoe-Serie:
01. A Clubbable Woman (1970, dt. „Eine Gasse für den Tod“) – Goldmann Krimi Nr. 4070
02. An Advancement of Learning (1971, noch kein dt. Titel)
03. Ruling Passion (1973, noch kein dt. Titel)
04. An April Shroud (1975, noch kein dt. Titel)
05. A Pinch of Snuff (1978, dt. „Der Calliope-Club“) – Goldmann Krimi Nr. 4836 u. 4991
06. A Killing Kindness (1980, dt. „Der Würger von Yorkshire“) – Goldmann Krimi Nr. 5230
07. Deadheads (1983, dt. „Welke Rosen muss man schneiden“) – Goldmann Krimi Nr. 4996
08. Exit Lines (1984, noch kein dt. Titel)
09. Child´s Play (1987, dt. „Kein Kinderspiel“) – Goldmann Krimi Nr. 5054
10. Under World (1988, dt. „Unter Tage“) – Goldmann Krimi Nr. 5108
11. One Small Step (1990, noch kein dt. Titel)
12. Bones and Silence (1990, dt. [„Die dunkle Lady meint es ernst“) 194 – Europa Verlag
13. Recalled to Life (1992, dt. [„Ins Leben zurückgerufen“) 350 – Europa Verlag
14. Asking for the Moon (1994, noch kein dt. Titel)
15. Pictures of Perfection (1994, dt. [„Der Schrei des Eisvogels“) 206 – Knaur TB Nr. 62441
16. The Wood Beyond (1996, dt. „Der Wald des Vergessens“)
17. On Beulah Height (1998, dt. „Das Dorf der verschwundenen Kinder“) – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 61984
18. Arms and the Women (1999, dt. [„Das Haus an der Klippe“) 633 – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 61983
19. Dialogues of the Dead (2001, dt. [„Die rätselhaften Worte“) 857 – Europa Verlag (geb.)/Knaur TB Nr. 62400
20. Death´s Jest-Book (2002, dt. „Die Launen des Todes“) – Droemer Verlag (geb.)
21. Good Morning, Midnight (2004, noch kein dt. Titel)
22. For Love nor Money (2005; noch kein dt. Titel)
23. Secrets of the Death (2005; noch kein dt. Titel)
Wir treffen unsere Helden außerdem in:
Pascoe´s Ghost and Other Brief Chronicles of Crime (1979, dt. „Das Rio-Papier und andere Kriminalgeschichten“) – Goldmann Krimi Nr. 5216