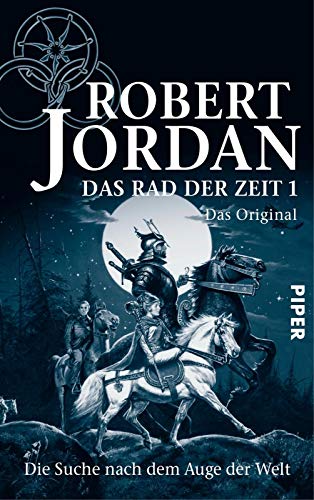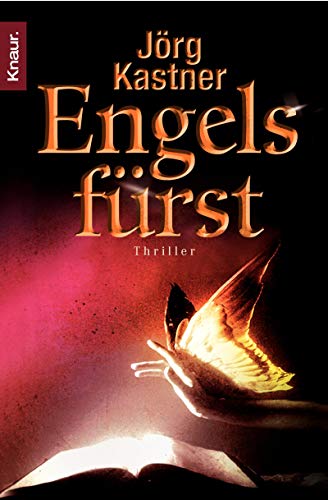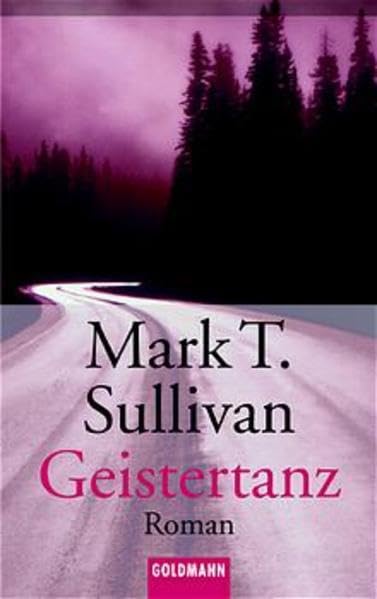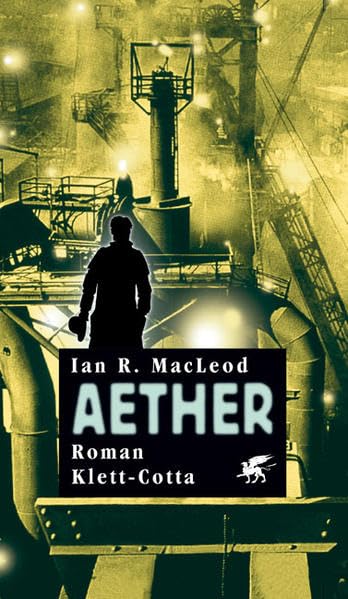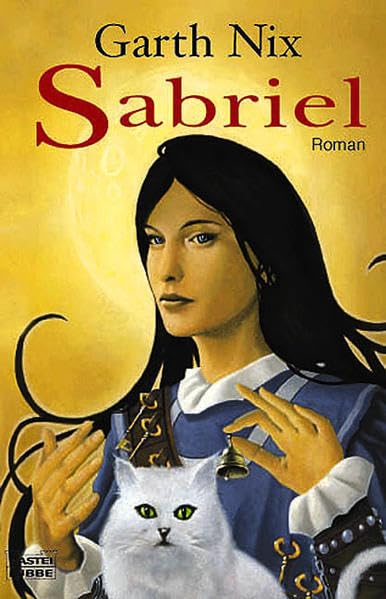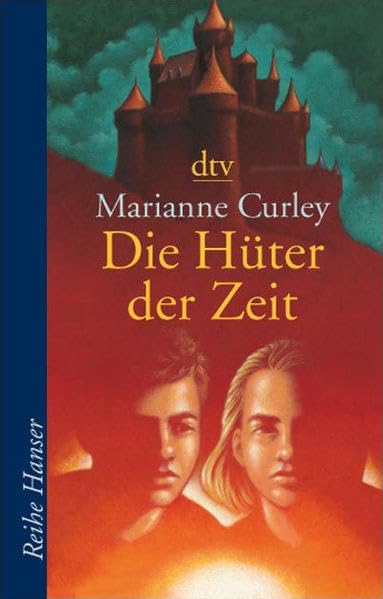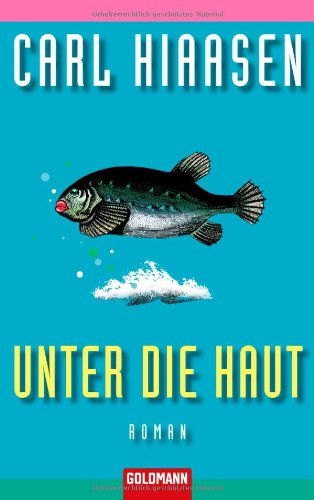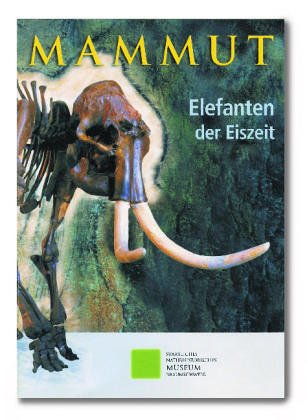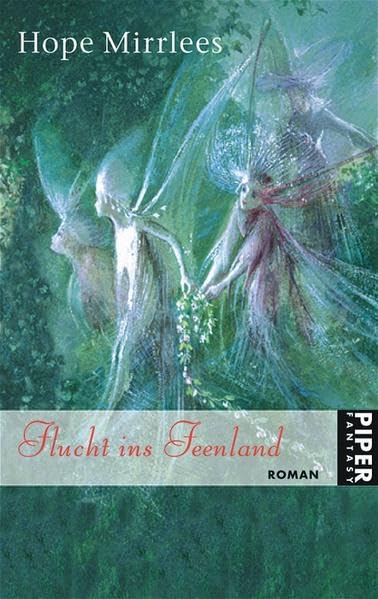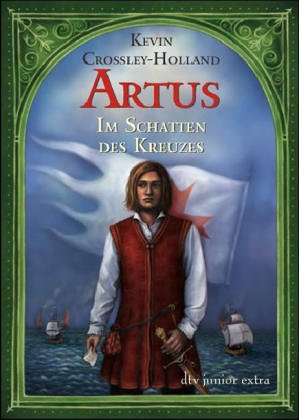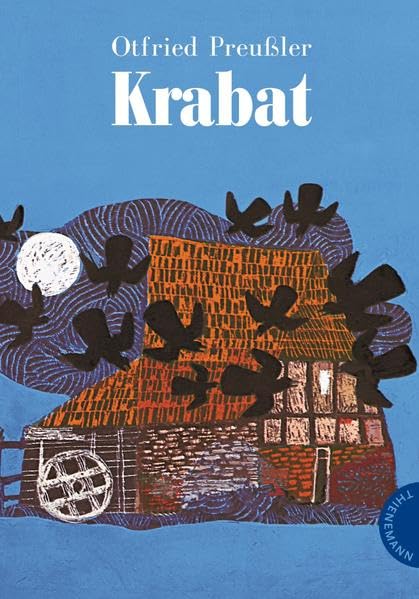Pat(rick) Hachfeld, 1969 in Wolfsburg geboren, ist Illustrator und bebildert unter anderem die Serien „Larry Brent“, „Macabros“ und „Wolfgang Hohlbeins Schattenchronik“ für den |BLITZ|-Verlag. Florian Hilleberg hat sich mit dem Künstler unterhalten:
_Florian Hilleberg:_
Hallo Pat, wie bist du eigentlich zum Zeichnen gekommen?
_Pat(rick) Hachfeld:_
Also, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass mein Onkel dafür die Verantwortung trägt! Er hat früher immer echt geile Comicfiguren gezeichnet; Silver Surfer, Spiderman, Hulk usw. Und da dachte ich mir als Fünfjähriger: Hey, was der große Mann da kann (er war 17 Jahre), das musst du auch versuchen. Tja, und so kam der erste Kontakt mit diesen „langen dünnen Dingern“ zustande. Ich malte und malte … und irgendwann, nach gefühlten 80 Jahren, sind dann die ersten erkennbaren Figuren entstanden.
_Florian Hilleberg:_
Ist das Zeichnen dein Hauptberuf?
_Pat Hachfeld:_
Mh, wenn man das, was ich mache, als Beruf bezeichnet (Beruf klingt fast immer nach ungeliebter Arbeit), kann ich sagen: „Ja“. Wobei ich das Zeichnen – ob Illustration, Portrait, Wunschportrait, oder private Auftragszeichnungen – |nicht| als Arbeit bezeichnen möchte. Dafür hat es für mich eine viel zu persönliche Bedeutung, und ich verdanke dem Zeichnen sehr, sehr viel!
_Florian Hilleberg:_
Orientierst du dich beim Zeichnen an bestimmten Stilrichtungen, hast du Vorbilder?
_Pat Hachfeld:_
Als ich die Comicfiguren „im Sack“ hatte, bekam ich die erste LP von |IRON MAIDEN| zwischen meine Finger. Ich war circa 11 Jahre „alt“, und das Cover fand ich einfach so |hammergeil| – es war der gute alte „Eddi“ – dass ich |den| auch zeichnen wollte.
Also begann ich damit und raffte alles zusammen, was diese für mich damals |härteste| Heavy-Band der Welt so hatte. Und so entdeckte ich für mich, dass mir das Zeichnen von etwas düsteren und morbiden Bildern viel mehr Spaß machte als die „schöne heile Welt“.
Später wurde ich sicherlich von H. R. Giger und Paul Booth (Tattoowierer aus den USA) inspiriert.
_Florian Hilleberg:_
Mittlerweile bist du wohl der produktivste Künstler, der für den [BLITZ-Verlag]http://www.BLITZ-Verlag.de arbeitet. Wie kam der Kontakt zustande?
_Pat Hachfeld:_
Das war eigentlich kein großes Ding. Ich habe den Suchbegriff „Fantasie und Autoren“ eingegeben, und das Suchergebnis war dann Bernd Rothe (für Bernd habe ich auch die Fantasy-Anthologie „Rattenfänger“ illustriert, sie erschien ebenfalls im BLITZ-Verlag). Ich habe seine HP angeklickt und ihm eine E-Mail mit drei meiner Zeichnungen geschickt.
Bernd hat dann Alisha Bionda angeschrieben, ob sie noch einen Illustrator sucht. Alisha schaute sich dann auf meiner HP um, und so bin ich zu meiner ersten Buchillustration „Der ewig dunkle Traum“, Band 1 von „Wolfgang Hohlbeins Schattenchronik“ gekommen, die Alisha Bionda zusammen mit Michael Borlik herausgegeben hat.
_Florian Hilleberg:_
Woher nimmst du deine Inspirationen?
_Pat Hachfeld:_
Wenn ich Bilder für meine [DUNKELKUNST]http://www.dunkelkunst.de zeichne – diese Motive werden bald im Shop als T-Shirts erhältlich sein -, kommen die Ideen ganz von selbst und aus meinem tiefen Inneren. Da die Bilder sehr „finster“, „morbid“ und „detailverliebt“ sind, und wegen der steigenden Anzahl der Aufträge, kommt es vor, dass ein Bild schon mal bis zu seiner Vollendung an die sechs Monaten braucht. Aber, wie gesagt, bedingt durch die Auftragsarbeiten habe ich |für mich| das letzte Mal vor circa zwei Jahren gezeichnet.
_Florian Hilleberg:_
Kennst du eigentlich die Romane, die du illustrierst, oder gibt dir der Verlag Vorgaben, nach denen du die Motive zeichnest?
_Pat Hachfeld:_
Das ist unterschiedlich. Bei den Anthologien, z. B. „Der ewig dunkle Traum“, „Rattenfänger“, „Wellensang“ (herausgegeben von Alisha Bionda und Michael Borlik, erschienen im |Schreiblust|-Verlag) oder aktuell eine Katzenanthologie (Hrsg. Frank W. Haubold & Alisha Bionda), bekomme ich die gesamten Geschichten zugeschickt. Ich picke mir dann eine Story raus, mache mir beim Lesen kleine Notizen, und meistens bilden sich dann schon die ersten Illus in meinem Kopf.
Bei den Dan-Shocker-Serien „Macabros“ und „Larry Brent“ oder der Fortsetzung von „Wolfgang Hohlbeins Schattenchronik“ im |BLITZ|-Verlag bekomme ich von Alisha Bionda grobe Illustrationswünsche, die ich dann versuche umzusetzen. Und damit fahren wir eigentlich sehr gut.
_Florian Hilleberg:_
Wie weit lässt dir der Verlag in der Interpretation Freiraum?
_Pat Hachfeld:_
Der Freiraum, den mir der Verlag (den ich aber auch brauche) lässt, ist nahezu grenzenlos! Ich habe festgestellt – durch die vielen Illustrationen, die ich bisher für den |BLITZ|-Verlag erstellt habe -, dass ich mit Alisha, bezogen auf die Bilder, geschmacklich sehr nahe beieinander liege. Sie muss mich manchmal sogar etwas zügeln, weil ich sehr detailverliebt bin, und hier und dort noch eine Kleinigkeit hinzeichnen möchte.
_Florian Hilleberg:_
Wie auf deiner Homepage zu lesen ist, zeichnest du auch Portraits und nimmst Auftragsarbeiten an. Dagegen wirken die Illustrationen zu „Larry Brent“ und „Macabros“ recht surreal. Welche Motive zeichnest du am liebsten?
_Pat Hachfeld:_
|Das| ist das Faszinierende an Kunst! Man kann „düster“, „morbid“ und „hart“ zeichnen, je nach Vorlage der Geschichte oder der Serien, und seiner Fantasie freien Lauf lassen. Wobei es mir sehr, sehr wichtig ist, dass die Illustrationen |nicht| „billig“ und „flach“ wirken. Ich versuche also immer, „noch einen Hauch“ Ästhetik mit einfließen zu lassen.
Und dazu steht dann das Portraitzeichnen im krassen Gegensatz – alles sehr feine Linien und sehr weiche Übergänge.
In mir ist die Frage aufgetaucht, ob ich nicht meinen Stil, also das „Düstere“, in die Weichheit des Portraitzeichnens einfließen lassen kann.
Und dadurch bin ich auf die Idee des „Wunschportraits“ gekommen.
Das heißt, wenn beispielsweise jemand Fan, egal ob Weiblein oder Männlein, des Fantasiespiels „Warhammer“ ist, und so wie eine Figur aus dem Spiel gezeichnet werden möchte, dann zeichne ich den Auftraggeber so. Aber auch als verführerische Hexe, oder als Zombie. Entscheidend dabei ist allerdings, dass der, der sich portraitieren lassen möchte, seiner Phantasie freien Lauf lässt! Da bin ich dann sogar etwas abhängig von der Vorstellungskraft meines Auftraggebers!
Daher: Ich bin immer bestrebt, mich zeichnerisch weiterzuentwickeln, so dass ich |nicht| sagen kann, welche Motive ich am liebsten zeichne.
_Florian Hilleberg:_
In welchem Umfeld arbeitest du am liebsten?
_Pat Hachfeld:_
Am liebsten zu Hause. Ich habe mir im Dachgeschoss unserer Maisonettewohnung einen kleinen Platz geschaffen, wo alles in meiner Nähe ist, was mir wichtig ist – meine Verlobte Angie, unser grüner Leguan Jabba, die Musikanlage (ohne Musik geht echt nix!, ich liebe |System of a Down|, |Slipknot|, |Rammstein| usw.) und natürlich Fernseher.
_Florian Hilleberg:_
Gibt es bestimmte Tageszeiten, zu denen du besonders kreativ und produktiv bist?
_Pat Hachfeld:_
Ich muss sagen, dass ich am produktivsten in den frühen Morgenstunden bin. Soll heißen, dass ich gegen sechs Uhr aufstehe, nach oben gehe, mir meinen frischen Guten-Morgen-Kaffee schnappe, ins Wohnzimmer wanke, mir eine Zigarette drehe (Kaffee und Zigarette gehören zusammen), den Fernseher anschalte, um Nachrichten (Euro News) zu sehen, und beginne so gegen 6 Uhr 30 mit dem Zeichnen, was ich dann zwei bis drei Stunden am Stück mache.
_Florian Hilleberg:_
Was für Projekte hast du für deine nähere Zukunft geplant?
_Pat Hachfeld:_
Neben dem Wunschportrait, was sehr gut angenommen wird, arbeite ich (hier allerdings reines Portraitzeichnen) neuerdings mit Schauspielern aus einer TV-Serie, die auf RTL im Vorabendprogramm ausgestrahlt wird, zusammen. Sie schicken mir ihre Fotos zu, welche ich dann auf DIN A3 zeichne. Bis jetzt ist das ziemlich interessant und aufregend für mich, weil es absolutes Neuland ist, bezogen auf das Zeichnen von Schauspielern aus dem TV.
Dann illustriere ich die Horroranthologie „Blutmond“ (wo ich auch Mit-Herausgeber bin) für Bernd Rothe. Die Katzenanthologie „Fenster der Seele“ mit Alisha Bionda läuft auch noch zeitgleich. Die beiden Serien „Larry Brent“ & „Macabros“ für den BLITZ-Verlag. Hier und da private Auftragszeichnungen (vor kurzen einen japanischen Drachen auf DIN A3 für ein Geburtstagsgeschenk) oder ein schönes Familienportrait. Und bald starten auch die Illustrationen für die nächsten „Schattenchronik“-Bände.
_Florian Hilleberg:_
Lebst du vom Zeichnen oder hast du noch einen Brotjob?
_Pat Hachfeld:_
Ich denke, ich kann sagen: „Ja, ich lebe davon“; zwar noch sehr wacklig, aber es geht. Es müssen halt mehrere „Zahnräder“ ineinander greifen: Portrait, Wunschportrait, Buch und Romanillustrationen, Auftragszeichnungen – z. B. Tattooflashs – entwerfen.
_Florian Hilleberg:_
Da du durch die enge Zusammenarbeit mit Alisha Bionda und dem BLITZ-Verlag ja überwiegend literarische Projekte illustrierst, drängt sich die Frage auf: Was liest du? Welche Autoren bevorzugst du?
_Pat Hachfeld:_
Also, ich lese sehr gerne John Grisham und Brad Meltzer und mag ihre Schreibweise. Ich finde es sehr gut, dass bei John Grisham ein überschaubarer Personenkreis mitwirkt und dass die Personen leicht verständliche Namen erhalten, so dass man nicht ständig sieben bis zehn Seiten zurückblättern muss, um nachzulesen, was oder wer „Mister X“ war, bzw. so gemacht hat. Ich mag sehr gerne Thriller oder Geschichten, die vor Gericht spielen („Die Jury“).
Außerdem lese ich sehr gerne historische Romane. Aktuell lese ich „Die Rächer“ von Aaron J. Klein über das Attentat auf die Israelis während der Olympischen Spiele 1972 in München. Ab und zu ziehe ich mir auch mal den guten alten |Larry Brent| rein.
_Florian Hilleberg:_
Was gibt es noch über den |Menschen| Patrick Hachfeld zu sagen? Was ist dir wichtig? Welche Wertigkeiten hast du? Welche Menschen sind dir, neben deinem direkten privaten Umfeld, über das du ja schon gesprochen hast, wichtig?
_Pat Hachfeld:_
Mh, was gibt es über mich zu sagen? Mir ist Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig! Dass ich sehr viel Wert darauf lege, Freundschaften zu pflegen, und sei es auch nur ein kurzes Telefongespräch. Mit der Zeit hat sich auch eine freundschaftliche Beziehung mit Alisha Bionda und Bernd Rothe entwickelt, und mit Bernd habe ich mich auch schon drei-, viermal privat getroffen. Er lebt ja nun mal in meiner Lieblingsstadt Hameln, die ich schon von meinen früheren Besuchen auf der „Hameln-Tattooconvention“ her kenne und deren Ruhe und Altstadt ich sehr zu schätzen gelernt habe.
_Florian Hilleberg:_
Welche Projekte würdest du gerne noch machen? Was würdest du gerne selbst initiieren?
_Pat Hachfeld:_
Ich möchte mich noch stärker, bezogen auf das Wunschportraitzeichnen, in die Gothic-Szene einbinden lassen. So kann ich meinen Stil mit dem Portraitzeichnen verbinden. Außerdem möchte ich mit meinen Illustrationen aus der DUNKELKUNST wieder verstärkt an Ausstellungen teilnehmen. Zwar nicht hier in Wolfsburg, sondern mehr die Richtung Ruhrpott, Gelsenkirchen, Essen usw.
_Florian Hilleberg:_
Gibt es dabei Menschen/Kollegen/Verlage, mit denen du bevorzugt arbeiten würdest? Oder zählt für dich nur die „Auftragslage“?
_Pat Hachfeld:_
Abgesehen von dem BLITZ-Verlag, wo ich mich sehr wohl fühle, ist es mir eigentlich (fast) egal, mit welchen Verlagen oder Menschen ich zusammenarbeite. Ich versuche einfach, jeden Auftrag so umzusetzen, dass nach Erledigung der Zeichnung die Leute oder der Verlag sagen: „Ja, war eine prima Zusammenarbeit, hat echt Spaß gemacht“. Und so baut man(n) sich gleichzeitig wieder neue Brücken.
_Florian Hilleberg:_
Vielen Dank für das Interview.
_Pat Hachfeld:_
Ich habe zu danken für die interessanten Fragen. Ich hoffe, ich habe nicht zu umfassend geantwortet. Hat mir echt großen Spaß gemacht, und wenn jemand Interesse an einem Portrait, Wunschportrait oder Ähnlichem hat, so kann er ganz zwanglos und locker mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich sehr!
In diesem Sinne, „mit einem Segen auf den Lippen“ – alles Gute und danke!
Bye, Pat
http://www.dunkelkunst.de/