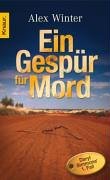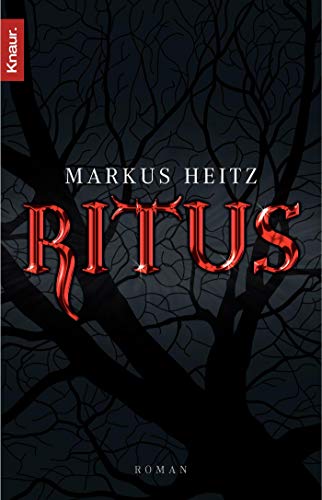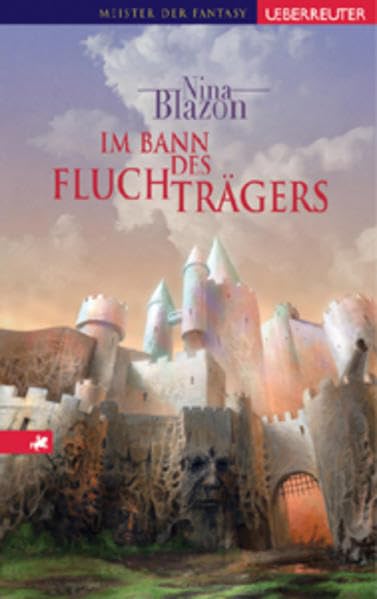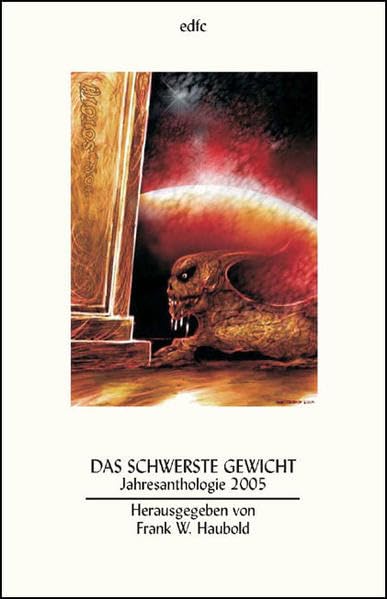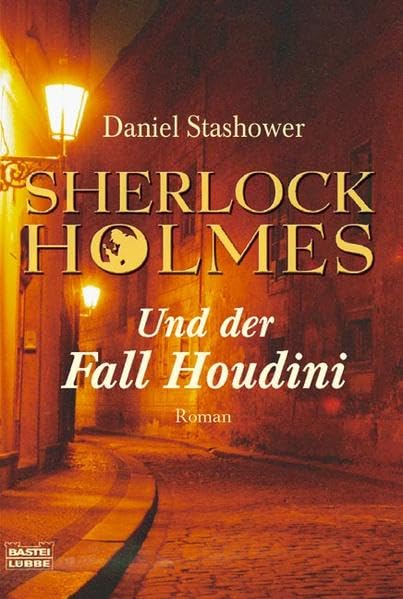In einer Zeit, in der legendäre Krimi-Spürnasen wie Sherlock Holmes ein schier unaufhaltsames Revival feiern, ist die moderne Literatur händeringend darum bemüht, neue Helden zu finden. Starke, gefestigte Charaktere mit dem besonderen Etwas sind gefragt; außergewöhnliche Fähigkeiten ebenso wie markante Macken. Dementsprechend viele neue Krimi-Serien gehen derzeit an den Start und jeder will die gesuchte Figur in seinem Roman gefunden haben.
Der schweizerische Schriftsteller Alex Winter kommt der Vorstellung von einer solchen Ikone schon ziemlich nahe. Daryl Simmons, sein Titelheld, ist nämlich ein sehr smarter Kerl, mit dem man sich auf Anhieb anfreundet, weil er einerseits ein gewiefter Ermittler ist, andererseits aber auch einen gewissen Charme ausstrahlt, der einem sehr schnell sympathisch ist. Und noch etwas: Simmons ist als Weißer bei den Aborigines aufgewachsen und stark in den Ursprüngen dieser Kultur verwurzelt. Das Wissen um die Traditionen seiner ‚Brüder‘ und natürlich sein cooles, herzliches Auftreten helfen ihm in seinem ersten literarischen Auftritt dabei, einen verzwickten Fall zu lösen.
_Story_
Daryl Simmons hat den Polizeidienst in Perth endgültig satt. Schon mehrfach hat er bei seinem Boss Garratt um eine Versetzung gebeten, und auch eine endgültige Beurlaubung hat er schon ins Auge gefasst. Eines Tages kommt dem Obersten dieser Drang zur Landflucht gerade recht: Ein Freund hat ihn um Hilfe gebeten, um einen mysteriösen Todesfall aufzuklären. Garratt schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen kann er seinen besten Mann zwangsbeurlauben und trotzdem weiterarbeiten lassen, und zum anderen kommen die Ermittlungen im Zuge des Todes von Floyd Butler auf einer Farm im Outback endlich ins Rollen.
Simmons hat es bei der Ankunft auf dieser Farm allerdings nicht leicht; hart muss er um die Akzeptanz der übrigen Mitarbeiter kämpfen, die dem verdeckt ermittelnden Kommissar sehr skeptisch entgegentreten. Erst nach und nach wird Daryl als echter Kerl akzeptiert und kann sich durch das neu gewonnene Vertrauen erste Informationen zu Butlers Tod erfragen. Obwohl er seinen Chef im Dunkeln tappen lässt, kommt langsam aber sicher Licht in die Sache – bis dann eine weitere Leiche gefunden wird und den Fall erneut zurückwirft. Doch Simmons gibt nicht auf, denn die Anzahl der Verdächtigen ist überschaubar und erste Vermutungen scheinen ihn auf die richtige Fährte zu führen. Nur die Motive der potenziellen Täter scheinen unklar. Als dann auch noch die beliebte Meena spurlos verschwindet und einen dubiosen Abschiedsbrief hinterlässt, gerät der Beamte in Zeitnot. Doch Daryl hat noch eine Geheimwaffe: das Wissen, das er aus der Lehre bei den Aborigines gesammelt hat, und welches ihm im direkten Umfeld eines weiteren Stammes nun entscheiden weiterhelfen soll …
_Meine Meinung_
Als absoluter Australien-Liebhaber war dieses Buch natürlich eine echte Pflichtlektüre, zumal Alex Winter die Kultur und die Landschaft des kleinen Kontinents immer wieder in die Geschichte integriert und ihr letztendlich auch eine entscheidende Bedeutung zuspielt. Allerdings kommt die Geschichte trotz aller interessanten Facetten nicht so richtig in Schwung. Bevor Simmons überhaupt mal richtig ins Geschehen eingreift, ist schon mehr als die Hälfte des Buches durch, denn statt die Seiten mit einem gewissen Spannungsaufbau zu füllen, verliert sich Alex Winter zunehmend darin, das Leben auf der Farm zu beschreiben. Die Geschichte ist dabei in einem Fluss geschrieben und lässt sich insgesamt auch sehr angenehm lesen, jedoch mangelt es ihr bisweilen an einer klar erkennbaren Struktur. In aller Seelenruhe erzählt Alex Winter, wie sich Daryl Simmons langsam aber sicher im Tross der Farmer einlebt und dort nicht immer auf Gegenliebe stößt, vergisst allerdings manches Mal, dass eigentlich die Morde und das Verschwinden von Meena im Mittelpunkt stehen. Viel zu spät besinnt sich der Autor darauf, für einen klaren Höhepunkt zu sorgen und diesen aufzubauen. Selbst wenn er am Ende mit einem ziemlich überraschenden Ende aufwarten kann, ist die Erzählung über weite Strecken eher unspektakulär und gewinnt nach sehr behäbigem und überaus langem Einsteig erst sehr spät an Fahrt.
Was mich weiterhin an „Ein Gespür für Mord“ stört, sind diese haltlosen Andeutungen. Nicht selten taucht irgendwo die Aussage auf, dass der verdeckte Ermittler in Gedanken bereits eine Spur verfolgt, die dann aber nicht benannt wird. Auf diese Weise Spannung zu schaffen, funktioniert beim ersten Mal noch ganz gut, wirkt aber auf die Dauer etwas einfallslos.
Dem entgegen sammelt Winter bei der Beschreibung von Landschaft, Menschen und Kultur wiederum mächtig Pluspunkte. Die Darstellung von traditionellen Bräuchen und kulturellen Eigenheiten zeugt von intensiver Recherche und verleiht dem Roman auch deutlich mehr Farbe als die recht simple und schwerfällig voranschreitende Story, und ich muss auch zugestehen, dass mich hier nicht selten das Fernweh gepackt hat. Das Problem an der Sache ist, dass die eigentliche Erzählung im Zuge dessen schon mal vernachlässigt wird. Es gelingt dem Autor viel zu selten, das Land Australien und den Roman „Ein Gespür für Mord“ zu einer Einheit zu verschweißen; irgendwie läuft beides nebeneinander her. Dass ich mich zum Schluss dann doch noch gut unterhalten gefühlt habe, liegt (neben den Rahmenbeschreibungen) in erster Linie an der sehr interessanten Wendung kurz vor Schluss, die den Verlauf der Geschichte noch mal ein wenig auf den Kopf stellt. Sowieso geizt Winter nicht mit guten Ideen, nur will vor lauter Harmonie und etlichen Annäherungsversuchen der Hauptdarsteller kein richtiges Krimi-Feeling entstehen.
Für kurzweilige Unterhaltung ist „Ein Gespür für Mord“ daher auch gut geeignet; als undurchschaubarer Thriller taugt das Ganze aber nur bedingt. Australien-Liebhaber sollten aber dennoch überlegen, sich dieses recht überschaubare Werk anzuschaffen, denn die genannten Qualitäten sollten dieses Klientel definitiv zufrieden stellen. Ansonsten gilt: Kann man lesen, tut man’s nicht, hat man kein herausragendes Buch verpasst.