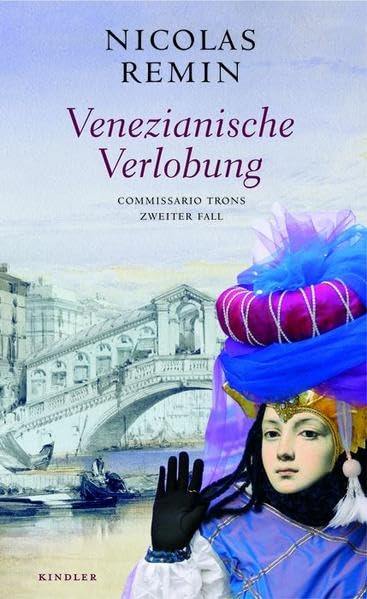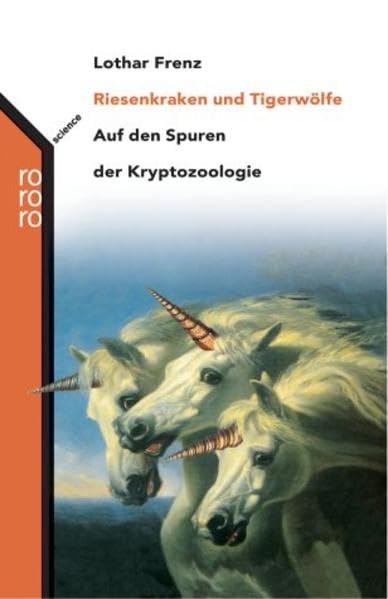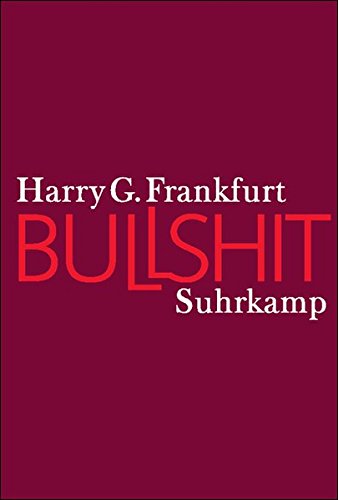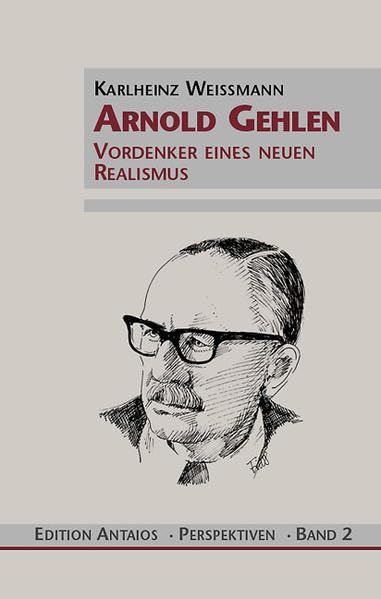_Der Fänger im Schlafmohnfeld._
Edgar Allen Poe ist eine wichtige Persönlichkeit der phantastischen Literatur, so weit nichts Neues. Seine teils delirierenden Streifzüge durch bizarre Alpdruckwelten sind noch heute Inspiration für Autoren. Um dem Rechnung zu tragen, hat der |BLITZ|-Verlag „Edgar Allen Poes Phantastische Bibliothek“ ins Leben gerufen, eine literarische Verbeugung vor dem opiumschmauchenden Wort-Virtuosen. Aber es irrt sich, wer glaubt, dass der |BLITZ|-Verlag eine Horde von Nachwuchstalenten verpflichtet hat, um in Poe’schen Werken zu wildern. Natürlich hat Herausgeber Markus K. Korb den deutschen Phantastik-Underground nicht außen vor gelassen, (er selbst hat ja den ersten Band zu der Reihe beigesteuert), aber gleichzeitig hat er einige Schätze von Autoren geborgen, die dem deutschsprachigen Leser bisher nicht zugänglich waren.
_Veteran gegen Nachwuchs: K.O. in der 2. Runde._
Markus K. Korb hat in „Grausame Städte“ (Band 1 der Phantastischen Bibliothek) gute Arbeit geleistet, aber mit Thomas Ligotti steigt ein Meister in den Ring, der seinen Vorgänger gnadenlos von der Matte putzt. Der 1953 geborene Amerikaner durchlebte eine Phase wachsender Depressionen, die im August 1970 in Agoraphobie gipfelte, der Angst, sich jenseits bekannter Orte zu bewegen. Seine Geschichten sind das Ventil für seine Ängste, das Sprachrohr seiner rabenschwarzen Weltsicht, die in ihrem Nihilismus einem H.P. Lovecraft durchaus ebenbürtig ist. Dabei ist Ligotti aber „realistischer“ (so weit man das bei ihm sagen kann), er streift dem Bösen nicht die Maskerade kosmischer Ungetüme über, sondern sucht es mitten unter uns, beleuchtet den Alltag dabei mit derartig bitterem Humor, dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt.
_Meine Arbeit ist noch nicht erledigt._
Unscheinbarer könnte ein Storytitel kaum sein. Dementsprechend überrascht war ich über die schiere Sprachgewalt, mit der Ligotti den Arbeitsalltag von Frank Dominio darstellt. Ausgeblutet ist dieser, angeekelt vom Karriere-Streben seiner Kollegen, vom Mobbing und vom Schleimen in der Chefetage. Mit bitterstem Zynismus betrachtet er die Beziehungen seiner Kollegen unter sich, muss hilflos mitansehen, wie sie ihm, dem Außenseiter, das berufliche Grab schaufeln, weil er es wagt, sich nicht dem braven Blöken unterwürfiger Angestellter anzuschließen. Dementsprechend vor die Tür gesetzt, sieht er seinen Ausweg nur noch in einem Amoklauf, doch dann kommt plötzlich alles ganz anders …
Hört sich nach Standard an? Nur bis man es gelesen hat! Ligotti möchte in seinen Storys nicht das „echte Leben“ imitieren, von Anfang an ist klar, dass man es hier mit einem Gleichnis zu tun hat, mit einem rabenschwarz gezeichneten Abgesang auf die Welt. Das fängt schon mit Dominios sieben Gegenspielern an, den Sieben Zwergen, (oder sieben Schweine, wie er sie nennt): Barry, Harry, Perry, Mary, Kerrie, Sherry, angeführt von Richard, dem Doc. Man erlebt die komplette Geschichte aus Dominios Perspektive heraus, und es dauert nicht lange, bis man von seinem Ekel angesteckt wurde. Beispiel gefällig? Bitteschön:
|Allgemein gesagt: Erwarte nichts als alptraumhafte Obszönitäten, die geboren werden, wenn menschliche Köpfe miteinander Verkehr haben. Noch allgemeiner gesagt: Was immer geboren wird, wächst letzten Endes zu einer alptraumhaften Obszönität heran – im „großen Ganzen“. Für mich selbst gesagt: Es gibt keine Engel, es sei denn Engel des Todes … und ich würde nie wieder meinen Platz unter ihren Reihen anzweifeln, oder es an Entschlossenheit mangeln lassen, in ihren wilden Reihen zu dienen.|
_Ich habe einen speziellen Plan für diese Welt._
Wiederum eine Horror-Story, die sich innerhalb einer seelenlosen Firma abspielt. In einer unbenannten Stadt mit dem wenig verheißungsvollen Spitznamen „Murder City“ hat diese Firma ihren Sitz, und wie jede Firma will sie wachsen, sich durch Umstrukturierungsmaßnahmen optimieren, um aus „Murder City“ schließlich wieder eine „Golden City“ zu machen. Stattdessen verdrängen bizarre Zombie-Mitarbeiter die Belegschaft, und ein ätzender, gelber Nebel breitet sozialen Verfall über die Stadt …
Stilistisch ähnlich zum Vorgänger, von dünnerer Handlung, aber von massiver sprachlicher Dichte, die unter die Haut geht. Mehr über die Story zu verraten, hieße den Leser vorab eines bitteren Erlebnisses zu berauben.
_Das Alptraum-Netzwerk._
Nur zehn Seiten lang, aber mit Abstand das verstörendste Werk aus diesem Sammelband: Es ist keine Erzählung im eigentlichen Sinn, sondern ein Flickwerk aus „Kleinanzeigen“, Videosequenzen, Träumen, Gedankenblitzen und vielem mehr, die alle die Entwicklung eines Mega-Konzerns beschreiben, beginnend im Jetzt und in einer weit entfernten, ultra-bizarren Zukunft endend. Nirgends ist Ligottis Zynismus so ätzend, sein Menschenekel so ausgeprägt wie im Alptraum-Netzwerk. Seine Sprache ist kalt, abstrakt, teilnahmslos und zeichnet den Wolf im Menschen mit skalpellartiger Schärfe:
|Aus dem Notizbuch eines Leiters:
Und wäre ich dazu entschlossen, mich nur vom Fleisch meines eigenen Personals zu ernähren, ohne Zugang zu den Leuten der anderen überlebenden Aufseher oder sonstigem Personal zu haben, so bestünde die größte Herausforderung darin, jeden von ihnen im essbaren Zustand zu halten und zugleich meinen Verbrauch zu regulieren.|
_Erzähltechnische Kreativität vs. Lesefluss._
Nun zeichnet sich bei den Zitaten eines ab: Ligotti erzählt kraftvoll und gewählt, aber er hält sich nicht an die Konventionen der Mainstream-Literatur. Seine Sätze sind mitunter lang und kompliziert, seine Vergleiche sind eher abstrakt als bildreich und gerne verzichtet er auf die klare Auflösung der Fragen, die sich während der Erzählungen ergeben mögen. Dabei merkt man ihm aber an, dass er das mit voller Absicht tut, Verstörung ist sein elementarstes Stilmittel, und nichts liegt ihm ferner als eine Anbiederung an den Entspannungs-Leser.
Dementsprechend ist „Das Alptraum Netzwerk“ ein Sammelband, der polarisieren dürfte: Wer sich unter gutem Horror eine Ansammlung rotgetränkter Phantastereien erwartet, liegt hier vollkommen falsch. Zynische Kreaturen allerdings finden hier eine heilsam boshafte Abrechnung mit den alltäglichen Perversionen der „Normalgesellschaft“. Und wenn ich schon so oft zitiert habe in dieser Rezension, kommt es auf ein drittes Mal auch nicht an. So soll der geneigte Leser selbst entscheiden, ob ihm das gewisse Quäntchen Misanthropie zueigen ist, um Werke genießen zu können, über deren Motive der Autor Folgendes schreibt:
|Haß auf das System im weitestmöglichen Sinn. In diesem Fall diente das System der Firmenumgebung als Mikrokosmos für das größere System des Lebens, das sich schließlich eindeutig als das ultimate Objekt des Abscheus herausstellt.|
Da lacht einem doch das schwarze Herz in der modrigen Brust! Eine Schande nur, dass es gerade mal ein Bruchteil von Ligottis Werk in den deutschen Sprachraum geschafft hat. Eine Schande vor allem, wenn man bedenkt, dass der nihilistische Kurzgeschichten-Autor schon seit zwanzig Jahren seine giftige Feder schwingt …
http://www.BLITZ-Verlag.de