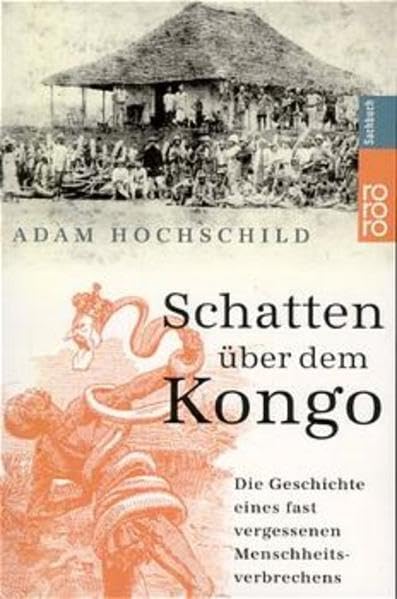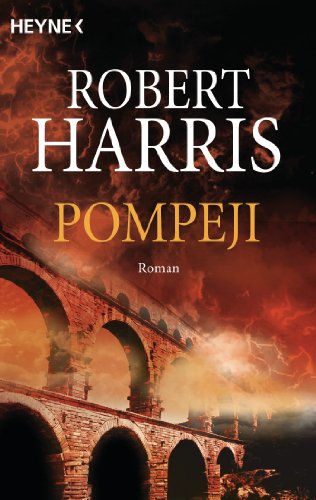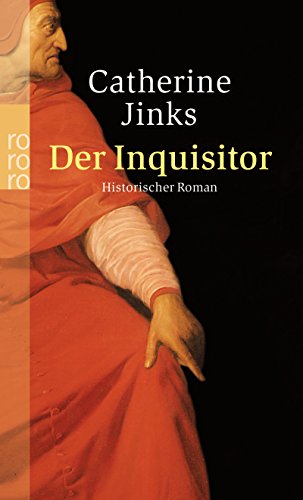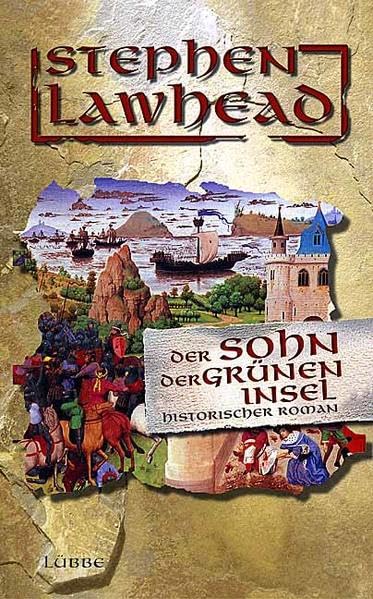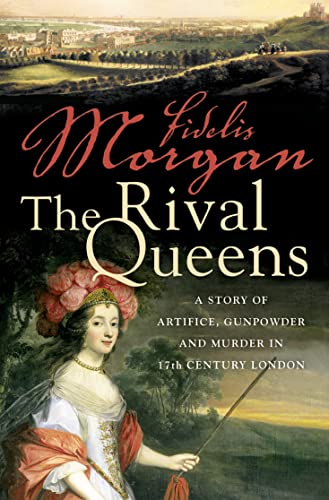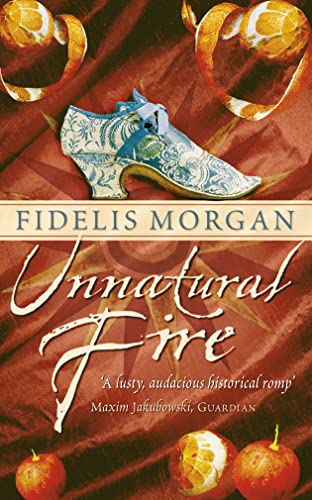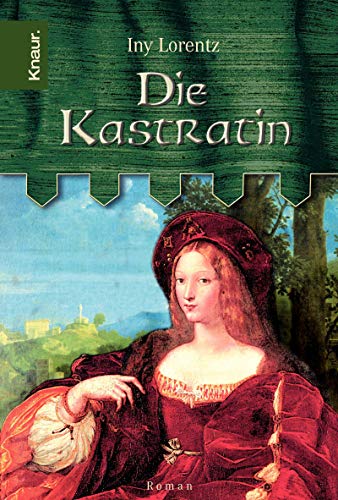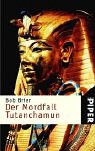Afrika ist niemals ein „friedlicher“ Kontinent gewesen – welcher Erdteil, der von Menschen bevölkert ist, war dies jemals? Dennoch gibt es eine eigenständige afrikanische Geschichte, die große, wohl organisierte, kulturell hoch entwickelte Reiche kennt. Sklaverei und anderes Unrecht war in den „Schwarzen Königreichen“ nicht unbekannt, aber das galt auch für den Rest der Welt.
Alles änderte sich nachhaltig, als die Europäer Afrika „entdeckten“. Um 1500 befuhren die Schiffe der damaligen Seefahrermächte Spanien und Portugal die Küsten. Handels-Expeditionen tasteten sich ins Landesinnere vor. Missionare folgten den Kaufleuten. Sie nahmen vorsichtig Kontakt auf zu den oft wehrhaften örtlichen Herrschern, erwarben deren Vertrauen, weckten Begehrlichkeiten, die gegen die Herausgabe heimischer Schätze gern gestillt wurden. Bald verhökerten skrupellose Stammesfürsten ihre Untertanen an die weißen Händler. Die „Gäste“ wurden immer dreister und begannen sich zu nehmen, wonach sie verlangten. Sie blieben, gründeten Kolonien. Franzosen und Briten gesellten sich den neuen Machthabern zu. Königreich für Königreich wurde unter die europäische Knute gezwungen. Im 19. Jahrhundert „gehörte“ Afrika längst nicht mehr der einheimischen Bevölkerung.
Einmalig ist das Schicksal des Kongo: 1885 fiel er an Leopold II. König von Belgien – nicht als Kolonie, sondern quasi als Privateigentum. Als solches betrachtete es Leopold auch. Nach Kräften bemühte er sich, so viel Geld wie möglich aus dem Kongo zu schinden; dieses Verb wird hier mit Bedacht eingesetzt. Leopold zwang praktisch die gesamte Bevölkerung, ihm die Schätze des Kongo – Elfenbein und Kautschukgummi – zu sammeln und auszuhändigen. Wer nicht spurte oder aufbegehrte, wurde grausam bestraft. Ganze Dorfgemeinschaften fielen dem Terror zum Opfer. Millionen umgebrachter Kongolesen umfasste Leopolds blutige Liste schließlich, als er 1908 endlich zur Aufgabe „seines“ Kongos gezwungen wurde.
So toll hatte er es getrieben, dass man inzwischen in den ansonsten nicht zimperlichen „zivilisierten“ Ländern der Erde aufmerksam geworden war. Das Entsetzen (sowie die Chance, einen kolonialen Konkurrenten auszuschalten) führte zur Bildung diverser, weltweit operierender Menschenrechtsbewegungen, die entschlossen und gegen alle Ressentiments und infamen Attacken des wütenden Belgierkönigs und seiner Spießgesellen das Ziel verfolgten, dem zum Himmel schreienden Unrecht ein Ende zu bereiten. Es gelang schließlich, aber der Übergang von „Leopolds Kongo“ zur belgischen Kolonie Kongo führte nur zu einer Neuorganisation des Systems, an dessen ausbeuterischem Charakter sich rein gar nichts änderte. Die Strukturen änderten sich, aber sie überlebten Leopold und sogar den Kolonialismus und sind zum Teil bis auf den heutigen Tag mit fatalen Folgen aktiv geblieben.
In Afrika steckt hoffnungslos der Wurm drin. Seit Jahr und Tag hängt beinahe der ganze Kontinent am Tropf diverser „Entwicklungshelfer“. Dennoch werden ständig Hiobsbotschaften über Aufstände, Bürgerkriege, Hungersnöte, Seuchenzüge und ähnliche, meist hausgemachte Katastrophen in den Medien verbreitet. Was läuft falsch? Es gibt eine lange Liste einleuchtender Erklärungen. Die Ursachen lassen sich womöglich auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt zurückführen: Afrikas Geschichte als politischer Spielball und Opfer imperialistischer Mächte. Ein halbes Jahrtausend wurde der „Schwarze Kontinent“ geplündert, wurden seine Menschen buchstäblich wie Vieh behandelt. Da scheint es leicht verständlich, dass in dem knappen halben Jahrhundert, seit die ehemaligen Kolonien ihre Unabhängigkeit errungen haben, die Folgen dieses düsteren historischen Kapitels nicht einmal annähernd überwunden werden konnten.
Adam Hochschild belegt diese These am Beispiel des Kongo. Ein besseres – oder schlimmeres – Beispiel hätte er leicht finden können: Keineswegs übertraf König Leopold die zeitgenössischen Kolonialmächte, in Sachen Gier & Grausamkeit. Der Kongo eignet sich dennoch besonders gut für eine Demonstration der Schattenseiten des Kolonialismus, weil diese sich hier auf die Person eines einzelnen Mannes projizieren lassen. König Leopold II. von Belgien ist so, wie ihn Hochschild schildert, eine Gestalt, die das Kino nicht besser erfinden könnte. Doch glauben wir dem Verfasser wirklich, dass ein gnadenloser Mistkerl wie Leopold seiner Macht- und Geldgier so skrupellos nachgehen konnte wie beschrieben? Die genaue Lektüre lässt indessen die ungemütliche Ahnung aufkeimen, dass Leopold höchstens in seiner bis zum Exzess übersteigerten Maßlosigkeit eine zeitgenössische Ausnahmeerscheinung war. Noch einmal sei betont: Die Machthaber der anderen großen Mächte benahmen sich als Kolonialherren keineswegs menschenfreundlicher. Um Macht und Geld ging es ihnen letztlich allen. Leopold trieb es nur auf die Spitze.
War Leopold denn nun ein von Minderwertigkeitskomplexen und Größenwahn getriebenes, gefühlskaltes, fuchsschlaues Würstchen, wie Hochschild ihn uns vorstellt? Wir neigen angesichts des grenzenlosen Leids, das dieser Mann über den Kongo gebracht hat, dazu, dem Verfasser uneingeschränkt zuzustimmen. Kritisch ließe sich freilich die Frage stellen, ob Hochschild im Laufe seiner Nachforschungen von solch’ gerechtem Zorn über Leopold ergriffen wurde, dass er die notwendige Objektivität für seine Darstellung schlicht nicht mehr aufbringen konnte.
Aber ist es relevant, ob Hochschild Leopold „versteht“ oder verabscheut? Sprechen die Fakten denn keine eigene Sprache? Apropos Sprache: Kann es sein, dass die elegante Prosa Misstrauen weckt, ob man dem Verfasser „trauen“ darf? Hochschild kann schreiben. Er fällt niemals in jenen drögen, bewusst sachlichen Ton, der vor allem hierzulande als Qualitätssiegel für ein „gutes“ Sachbuch gilt. Hochschild erzählt mit Fakten, wie es sich so offenbar nur die Angelsachsen trauen. Er wird ironisch, schweift ab, erzählt Anekdoten. Anders ausgedrückt: Er hält seine Leser bei der Stange – alle Leser, auch jene, die wohl kaum ein Buch über historische Menschenrechtsverletzungen im fernen Kongo bis zur letzten Seite durchhalten würden.
Das ist legitim, denn Hochschild ist kein Historiker, sondern Journalist. Schon seine (überaus wirkungsvoll eingesetzte) Entscheidung, sich nicht auf die Wiedergabe von Ereignissen zu beschränken, sondern diese mit den Biografien von „Opfern“ und „Tätern“ zu verknüpfen, weist darauf hin. Hochschild will seine Leser in Kopf und Bauch treffen. Nie macht er einen Hehl daraus, dass er auf den Schultern wissenschaftlich kundiger Vorarbeiter steht. Hochschild betreibt keine Grundlagenforschung – er nutzt Wissen, das bereits vorhanden ist, und präsentiert es möglichst publikumstauglich. Wem dies nicht „anspruchsvoll“ genug ist, der kann getrost zu den primären Quellen greifen; der Verfasser liefert sie in einem eindrucksvollen Anmerkungsapparat nach.
Hilfreich, weil informativ über das eigentliche Thema hinausgreifend, ist Hochschilds Panorama der kongolesischen Geschichte nach 1908. Er erzählt nämlich nicht nur eine aufrüttelnde und interessante, aber letztlich vergangene Geschichte, sondern bettet die Episode „Freistaat Kongo“ in den historischen Kontext ein – und der reicht ungebrochen bis in die Gegenwart! An dieser Stelle würde es zu weit führen, die vielfältigen Zusammenhänge aufzulisten, aber Hochschilds Argumentation ist deprimierend schlüssig. Mit klaren & klugen Worten gelingt ihm für sein Werk ein perfekt anmutender Abschluss.
In einem Punkt schießt Hochschild freilich wirklich übers Ziel hinaus: Zu verlockend erscheint ihm die Verbindung zwischen dem kolonialen Terror und dem Schrecken der nazideutschen Judenvernichtung. Dies liegt nahe, ist aber grundsätzlich falsch, wie der Verfasser schließlich selbst feststellt (ohne jedoch seine früheren diesbezüglichen Äußerungen zu relativieren): Für die Nazis war die physische und psychische Auslöschung der Juden das Primärziel, die Zwangsarbeit nur eine von vielen Stationen dorthin. Leopold und die anderen Kolonialmächte waren dagegen keine vorsätzlichen Völkermörder. Im Gegenteil: Für sie war jeder Einheimische wichtig, denn diese sollten ja so zahlreich wie möglich Sklavenarbeit leisten. Die Betroffenen mag diese juristische Differenzierung indessen kalt gelassen haben.
Adam Hochschild wurde 1942 in New York City geboren – und zwar mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund: Sein Vater leitete einen der erfolgreichsten Minenkonzerne der Welt. Jung-Adam bewegte sich in einer Welt der Privilegierten (die er in seinem Buch „Half the Way Home: a Memoir of Father and Son“ 1986 Revue passieren ließ). Eine in jungen Jahren unternommene Reise ins Südafrika der Apartheid weckte Hochschilds soziales Gewissen. Er schloss sich der Bürgerrechtsbewegung in den USA an, protestierte gegen den Vietnamkrieg, kämpfte journalistisch gegen das Unrecht in der Welt. Seine Artikel erscheinen in allen großen Magazinen.
Unter Hochschilds Buchveröffentlichungen ragen vor allem seine Werke „The Mirror at Midnight: a South African Journey“ (1990) und „The Unquiet Ghost: Russians Remember Stalin“ (1994; dt. „Stalins Schatten. Gespräche mit Russen heute“) heraus. Hochschild lebt heute in San Francisco. Er lehrt kreatives Schreiben an der „Graduate School of Journalism“, die zur „University of California“, Berkeley, gehört.