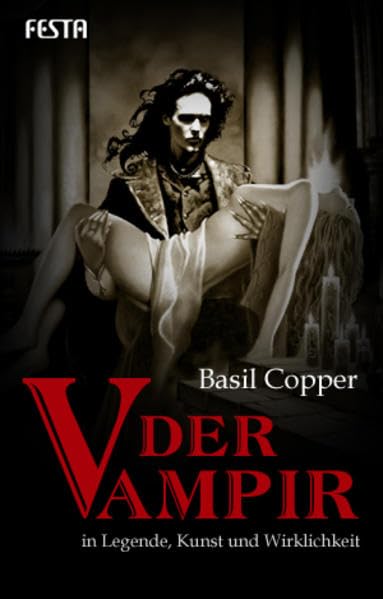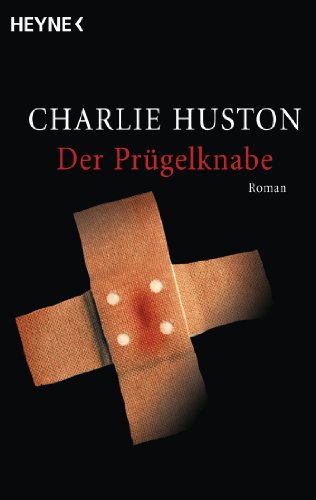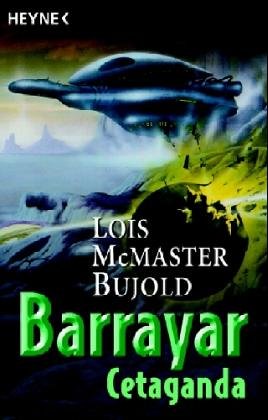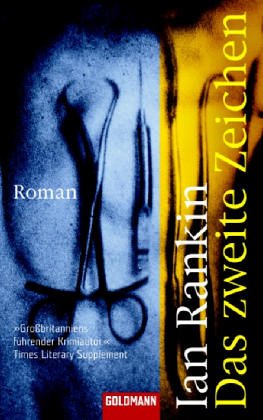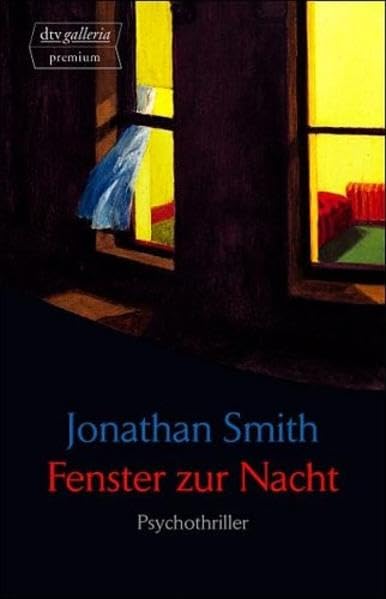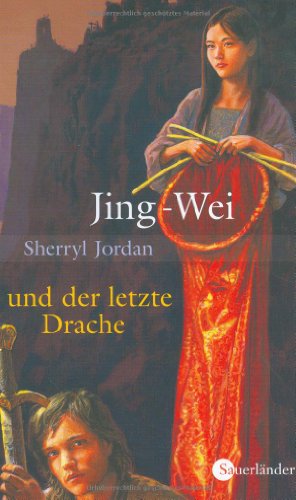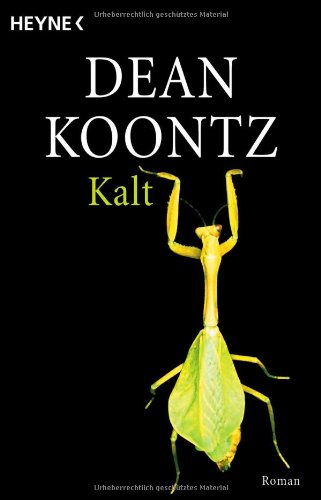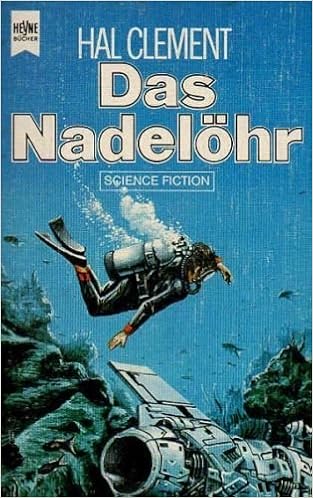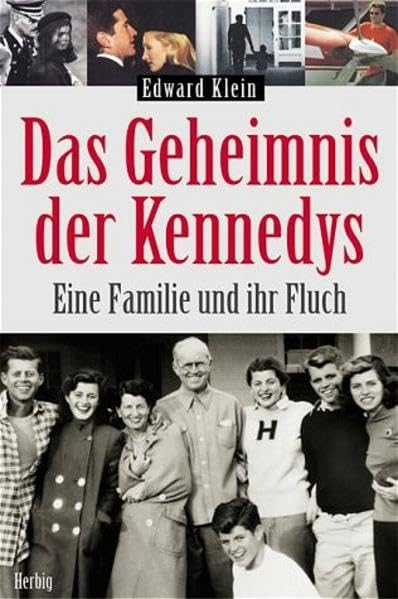In vier Großkapiteln nähert sich Copper seinem komplexen Thema. „Der Vampir in der Legende“ ist in erster Linie ein durch zeitgenössische Quellen gestützter historischer Rückblick. Der Glaube an nächtlich auftauchende Blutsauger kommt nicht von ungefähr, sondern hat Wurzeln, die erstaunlich weit zurückreichen. Copper unternimmt den Versuch, ein wenig Licht in das mythische Dunkel zu bringen. Er erinnert an den Drang, für jene Dinge, die der Mensch nicht versteht, eine „Erklärung“ zu konstruieren. Seltsame Krankheiten, merkwürdige Umtriebe an Grabstätten, dazu Vorurteile, üble Nachrede, Dummheit und Furcht bildeten den Nährboden für den Glauben an „Wiedergänger“ und „Nachzehrer“, der in praktisch allen Kulturen präsent war, sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zog und die „gebildeten“ Stände keineswegs ausschloss. Der Verfasser präsentiert außerdem „echte“ Vampire – kleine Fledermäuse aus Südamerika – und einen kuriosen Schmetterling, der sich ebenfalls von Blut ernährt. Basil Copper – Der Vampir in Legende, Kunst und Wirklichkeit weiterlesen
Archiv der Kategorie: Rezensionen
Huston, Charlie – Prügelknabe, Der
Was dabei herauskommt, wenn Drehbuchautoren anfangen Romane zu schreiben, sieht man an „Der Prügelknabe“ von Charlie Huston: Ein Buch, das verständlicherweise wie geschaffen dafür ist, verfilmt zu werden. Kein Wunder also, dass die Filmrechte zu Hustons Debütroman schon verkauft sind. Doch funktioniert das Buch als eigenständiger Roman genauso gut wie als möglicher Film? Oder ist es als Vorlage für den Film eher Mittel zum Zweck?
„Der Prügelknabe“ erzählt die Geschichte des sympathischen Verlierers Hank. Nachdem er aufgrund einer schweren Sportverletzung seine hoffnungsvolle Baseballkarriere an den Nagel hängen musste, zog es Hank von Kalifornien nach New York. Dort führt er ein bescheidenes Leben als dem Alkohol arg zugeneigter Barkeeper. Alles in allem eine unspektakuläre Existenz – bis er eines Abends in der Bar von zwei Russen übel zugerichtet wird. Einige Tage später wird Hank aus dem Krankenhaus entlassen, um eine Niere ärmer und den (zugegebenermaßen vom Arzt aufgezwungenen) Vorsatz, sein Leben zu ändern, reicher.
Hank soll dem Alkohol entsagen (was ihm verständlicherweise nicht ganz leicht fällt) und sich von den Strapazen der Nieren-OP erholen, doch Ruhe ist ihm nicht vergönnt. Kaum ist er zu Hause angekommen, tauchen die beiden Russen wieder auf. Dass die Sache offenbar mit seinem Nachbarn Russ zu tun hat, dämmert ihm, als dessen Bude von einem Haufen Gangstertypen durchwühlt wird.
Russ ist derweil untergetaucht, während Hank brav dessen Katze hütet. Was Hank allerdings nicht ahnt, ist, dass in dem Käfig, mit dem Russ vor seiner Abreise vor Hanks Tür stand, nicht nur die Katze war, sondern auch ein ominöser Schlüssel. Und auf den sind plötzlich eine Menge Leute scharf. Für Hank ist dies der Beginn einer Odyssee kreuz und quer durch den New Yorker Großstadtdschungel. Skrupellose Gangster, korrupte Polizisten, die Russenmafia – alle sind sie hinter Hank her, und der lernt in den folgenden Tagen eine Menge einzustecken …
„Der Prügelknabe“ ist eine recht rasante Geschichte. Ohne viel Umschweife steigt Huston direkt ins Geschehen ein, keine Worte werden verschwendet, keine Zeile ist zu viel. Hustons Erzählstil ist ein Stil der schnellen Schnitte und der sprunghaften Überleitungen. Kurze, knappe Sätze, schnelle Wortwechsel und ein hohes Erzähltempo sind die markantesten Eigenschaften des Romans. Huston wechselt schnell von einer Szene zur nächsten, springt, ohne den Leser lang und breit darauf vorzubereiten, in der Handlung vor und zurück und dokumentiert die Dialoge als rasante Wortwechsel, bei denen man als Leser schon mal hier und da nachdenken muss, wer jetzt eigentlich was gesagt hat.
Das wirkt manchmal ein wenig abgehackt und hastig, zum Handlungsbogen passt dieser direkte Erzählstil aber dennoch sehr gut. Huston konzentriert sich auf Hanks Odyssee durch New York. Es gibt nur eine Handvoll Nebenfiguren, deren Charakterisierung aber stets oberflächlich bleibt. Umso detaillierter setzt Huston sich mit seinem Protagonisten auseinander. Hank, der auf den ersten Seiten noch einen etwas asozialen und unsympathischen Eindruck hinterlässt, wächst dem Leser schnell ans Herz. Hank wirkt natürlich und glaubwürdig. Eine gescheiterte Existenz, die irgendwie ihre Lebensziele aus den Augen verloren hat, so wie Menschen nun einmal Ziele aus den Augen verlieren. Er hatte Pech und hat sich zwischenzeitlich damit abgefunden. So wie Hank sind viele Menschen, und das macht ihn als Protagonisten so großartig. Man kann sich in ihn hineinversetzen, findet sich vielleicht sogar ein Stück weit in ihm wieder. Das lässt die Geschichte authentisch wirken und fesselt den Leser in Anbetracht der Dinge, die Hank erlebt, umso mehr.
Zugegeben, was Hank in „Der Prügelknabe“ so alles erlebt, das mag auf Ottonormalverbraucher doch recht unwahrscheinlich wirken. Es ist nun einmal eine actiongeladene Thrillergeschichte, authentische Hauptfigur hin oder her. Hank hat alle möglichen Leute an den Hacken, von denen der eine skrupelloser als der andere ist. Aber Hank bleibt in all diesem Trubel so erfrischend normal, dass die Geschichte auf ihre Art wirklich glaubwürdig erscheint. Er glaubt anfangs beharrlich an ein Missverständnis, glaubt, dass sich schon alles aufklären wird, wenn Russ erst einmal zurückkommt und er glaubt, dass er den Gangstern schon irgendwie begreiflich machen kann, dass er der Falsche ist, doch so einfach ist das natürlich nicht. Hank hat niemanden, den er um Hilfe bitten kann, und steht ziemlich allein vor dem ganzen Schlammassel.
Ein wenig naiv wirkt er, wie er, stets begleitet von Russ‘ Katze Bud (um deren Wohlergehen er sich permanent und geradezu rührend sorgt), durch die Geschichte stolpert. Dieser Umstand hat schon eine gewisse schwarzhumorige Seite, die auch an anderen Stellen des Romans gelegentlich wieder aufblitzt. So knallhart, wie die Geschichte verläuft, so komische Momente hat sie eben auch immer wieder mal, wenngleich der Humor dahinter eher ein unterschwelliger, indirekter ist.
Hank entwickelt sich innerhalb der Geschehnisse weiter, und auch das durchaus glaubwürdig. Zunehmend frustriert darüber, für alle nur der titelstiftende Prügelknabe zu sein und dementsprechend einstecken zu müssen, obwohl er sich das augenblicklich gesundheitlich gar nicht leisten kann, wird Hank mit der Zeit hart im Nehmen. Er beginnt das Spielchen mitzuspielen und entwickelt sich dabei zu einem durchaus ernst zu nehmenden Gegenspieler. Und dann wird das, was im Roman innerhalb weniger Tage passiert, richtig spannend und temporeich.
So rasant wie „Der Prügelknabe“ daherkommt, so blutig ist er teilweise auch. Das, was manche der Figuren an Kaltblütigkeit und Brutalität auffahren, ist nicht unbedingt für die zartesten Gemüter geeignet. Besonders im Gedächtnis bleiben da die Szenen, die mit Nähten und Wunden zu tun haben, denn einmal ist es Hank, der durch eher unsachgemäßes Fädenziehen an seiner OP-Wunde zum Reden gebracht werden soll, ein anderes Mal ist es Hank, der mit Nadel und Faden versucht, Russ‘ Schädel zusammenzuflicken. Alles nicht unbedingt appetitlich in all seiner Deutlichkeit und Detailliertheit. Sehr deutlich ist Huston auch sprachlich. Es wird viel geflucht, der Ton ist derbe, teils vulgär – wie man es von einer echten New Yorker Gangstergeschichte nun einmal erwartet.
Im Klappentext fällt übrigens das gefährliche Wort |Kultroman|. Kultromane lassen sich natürlich nicht durch Klappentexte zu eben solchen machen, insofern bin ich bei dieser Vokabel immer äußerst skeptisch. Es werden allerhand Vergleiche gezogen (Tarantino, Hitchcock, „The Big Lebowski“, „Der Marathon-Mann“, „American Psycho“). Nicht alles zwangsläufig nachvollziehbar, aber die Zielgruppe lässt sich damit immerhin recht ordentlich einkreisen. Meine These ist eigentlich immer die, dass Bücher, auf denen Dinge wie |“der perfekte Kultroman“| stehen, niemals genau das werden können. Schließlich wird Kultstatus nur durch die Resonanz des Publikums erzeugt und nicht durch den Willen des Verlags. Kult geht die merkwürdigsten und unvorhersehbarsten Wege. Ob „Der Prügelknabe“ also jemals in irgendeiner Weise „Kultstatus“ erreichen wird, kann einzig und allein die Zeit zeigen.
Woran der Verlag aber ruhig noch einmal arbeiten dürfte, ist das Lektorat. „Der Prügelknabe“ enthält eine ganze Reihe nervtötender und überflüssiger Fehler, die eigentlich vor der Veröffentlichung ausgemerzt gehören. Da gibt es nicht nur Tippfehler (über die man eventuell noch hinwegsehen könnte), sondern durchaus auch mal Wortdreher und vertauschte Namen und das sind dann Fehler, die wirklich stören.
Ansonsten gibt es abschließend kaum Negatives festzuhalten. Charlie Huston ist ein rasantes, spannendes und ernst zu nehmendes Romandebüt gelungen, mit einem Protagonisten, der dem Leser schnell ans Herz wächst. Er skizziert eine intensive, nervenaufreibende Odyssee durch New York, die zu verfolgen bis zur letzten Seite Freude bereitet. Der sprunghafte, teils etwas abgehackte Erzählstil mit den rasanten Wortwechseln erfordert zwar eine gewisse Konzentration und mag hier und da etwas stören, passt aber gut zum Inhalt.
Wem „Der Prügelknabe“ gefallen hat, der darf sich obendrein auf zwei weitere Bücher um den sympathischen Verlierertypen Hank freuen, denn Huston hat die Geschichte als Trilogie geschrieben, deren zweiter Teil („Der Gejagte“) in diesem Monat in die Buchläden kommt.
Bujold, Lois McMaster – Barrayar – Gefährliche Missionen (alternativ: Cetaganda)
Mit dem |Barrayar|-Zyklus schreibt sich Lois McMaster Bujold seit 1986 in die Herzen nicht nur amerikanischer SF-Fans. Die vielfach ausgezeichnete Autorin verdankt der Space Opera um den körperlich missgebildeten Miles Vorkosigan vier ihrer fünf |Hugo| sowie zwei |Nebula Awards|. Auch im Fantasy-Bereich hat Bujold mit „Chalions Fluch“ sowie dem mit |Hugo| und |Nebula Award| ausgezeichneten [„Paladin der Seelen“ 973 Erfolge aufzuweisen.
Der ungewöhnliche Held Miles besticht in seinen Romanen mit Humor und Verstand, in der traditionellen und rückständigen Kriegergesellschaft der Barrayaner ist sein scharfer Verstand für den kaiserlichen Geheimdienst unentbehrlich, doch offiziell wird er als Diplomat und Günstling des Kaisers geführt, der nur aufgrund seines berühmten Vaters trotz Glasknochen und verkrüppeltem Wuchs in der körperbetonten Gesellschaft der Barrayaner einen Platz gefunden hat.
Der kluge Miles erhält so einen tragisch-komischen Touch, der ihn sehr sympathisch macht, man leidet mit ihm, wenn seine spröden Knochen im ungünstigsten Moment brechen, oder er in der Liebe wegen seines Mangels an Attraktivität frustriert ist. Seine Karriere im Geheimdienst beginnt, nachdem er an der körperlich zu schweren Aufnahmeprüfung der Flotte scheitert – um sich kurze Zeit später unter dem Pseudonym Admiral Naismith eine eigene Söldnertruppe aufzubauen, die Dendarii-Söldner, die unwissend somit im Dienst des Kaiserreichs Barrayar steht.
Auch in diesem Sammelband, der die vielfach prämierten Romane „Cetaganda“, „Ethan von Athos“ sowie die Novelle „Labyrinth“ enthält, wird die Söldnertruppe von Bedeutung sein. Dieses Mal werden jedoch die Genetik und ihre Folgen und Auswirkungen für einzelne Personen sowie die gesamte cetagandische Gesellschaft im Mittelpunkt stehen.
Die Neuauflage des |Barrayar|-Zyklus in Sammelbänden durch |Heyne| ermöglicht es SF-Fans, eine chronologisch geordnete Gesamtausgabe des Barrayar-Zyklus zu erwerben. Diese sind in sich abgeschlossen, man muss also nicht gezwungenermaßen bei Band 1 beginnen, zumal jeder einzelne Sammelband einen anderen Schwerpunkt setzt, wie in diesem Fall auf Genetik. Wer es sich nicht nehmen lassen will, den Zyklus in chronologischer Reihenfolge zu lesen, sollte mit den ebenfalls ausgezeichneten Sammelbänden „Cordelias Ehre“ und [Der junge Miles 953 beginnen.
|Cetaganda|
Miles Vorkosigan stellt zusammen mit seinem Cousin Ivan Vorpatril die Trauerdelegation des barrayanischen Kaiserreichs anlässlich des Staatsbegräbnisses der Kaiserin Cetagandas, dem Erzfeind Barrayars.
Bereits bei der Ankunft wird ihre Fähre in ein abgelegenes Terminal umgeleitet und Miles von einem offensichtlich sehr nervösen und ungeschickten Attentäter attackiert, der auf der Flucht zudem noch einen aufwändig kodierten Datenspeicher verliert. Miles bittet Ivan, den Vorfall vorerst für sich zu behalten – denn offenkundig ging dieser Anschlag nicht vom cetagandischen Sicherheitsdienst aus, der selbst nichts davon zu wissen scheint …
In der Folge lernt Miles die komplizierte cetagandische Gesellschaft besser kennen, während Ivan sich am liebsten Vorreedi, dem barrayanischen Sicherheitschef auf Cetaganda, anvertrauen würde, denn auf Miles und ihn werden immer weitere Mordanschläge verübt. Schlimmer noch: Man findet die Leiche des Terminal-Attentäters mit aufgeschlitzer Kehle am öffentlich ausgestellten Sarg der Kaiserin!
Erst die Haud Rian, Hüterin der Sternenkrippe, offenbart Miles die Tragweite der Ereignisse: Eine Verschwörung gegen das cetagandische Kaiserreich, die auch Barrayar mit ins Verderben reißen könnte, ist im Gange! Deshalb fordert sie energisch von Miles den „Schlüssel“, den sie in seinem Besitz weiß. Miles ist zugleich ihre letzte Hoffnung, denn der berüchtigte Sicherheitsdienst kann ihr nicht helfen, auch er ist in den Wirrwarr aus Verrat und Intrige verwickelt … Es geht um nichts Geringeres als die Kontrolle über das Haud-Genom, dem die herrschende Schicht Cetagandas entstammt.
|Ethan von Athos|
Der Planet Athos ist eine reine Männergesellschaft – es gibt keine Frauen, alle Männer werden in Uterus-Replikatoren gezüchtet, Homosexualität ist die Norm und das Recht auf Kinder muss man sich durch soziale Verdienstpunkte erwerben. Doch dem Männerplanet droht eine Existenzkrise: Die für die Uterus-Replikatoren verwendeten Eierstöcke altern und sterben ab. Eine Lieferung frischer Eierstöcke sollte dieses Problem lösen, doch man hat die Athosianer hereingelegt: Totes Gewebe, teilweise von Kühen und anderer Unrat wurde ihnen für eine horrende Summe angedreht. Dr. Ethan Urquhart, Leiter der Abteilung für reproduktive Biologie, soll den Fall auf der Raumstation Kline klären und unter allen Umständen umgehend neues Gewebe für die Replikatoren besorgen.
Ethan ist mit dieser Aufgabe völlig überfordert: Er wird als Schwuchtel und Perversling verprügelt, kommt mit der fremdartigen Umgebung einer Raumstation nicht klar, und zu allem Überfluss gibt es auf dieser auch noch Frauen!
Völlig verstört und eingeschüchtert, wird Ethan von der hübschen Eli Quinn von den Dendarii-Söldnern unter ihre Fittiche genommen. Denn seltsamerweise hat auch der cetagandische Geheimdienst Interesse an der Lieferung für Athos und beginnt mit der Jagd auf Ethan. Eli findet heraus, dass es ihnen um das Genmaterial des entlaufenen Klons Terrence Cee geht, der sich angeblich auch auf der Raumstation befindet – und tot oder lebendig für den Geheimdienst von höchster Bedeutung ist …
|Labyrinth|
Miles soll in seiner Tarnidentität als Admiral Naismith von den Dendarii-Söldnern für den barrayanischen Geheimdienst einen Genetiker in Sicherheit bringen. Leider arbeitet dieser auf Jackson’s Whole, dem korruptesten Gangsterloch der ganzen Galaxis, für eines der hohen Häuser. Diese aus Verbrechersyndikaten hervorgegangenen Pseudoaristokratien stellen die recht eigenwillige „Regierung“ dieser Welt. Traditionell widmen sich die Häuser bevorzugt einem Gebiet, das von Waffenhandel bis hin zur Prostitution reichen kann – oder eben der Schaffung künstlicher Lebewesen ohne moralische Einschränkungen jeglicher Art.
Seine Mission bringt Miles in Kontakt mit den Baronen und ihren bedauernswerten Opfern. Bei der Rettung des Wissenschaftlers stellt sich dieser ebenfalls als Scheusal heraus, entgegen seinen Anweisungen befreit Miles eines seiner „Experimente“, nebst der von den Baronen als einer Art exotisches Schaustück gehaltenen Quaddie Nicol.
_Geheimagenten und Genetiker_
Man mag es kaum glauben, aber zwischen „Cetaganda“, dem neuesten der drei Romane, und „Ethan von Athos“ liegen ganze elf Jahre. Die Thematik dieses Sammelbandes ist trotzdem erstaunlicherweise aus einem Guss, alles dreht sich um Genetik und ihre Einflüsse auf Einzelpersonen und ganze Gesellschaften, vortrefflich demonstriert an dem Kaiserreich Cetaganda, dessen Kultur japanische Einflüsse aufweist, aber dennoch so vollkommen anders ist. Besonders interessant fand ich das Machtverhältnis zwischen Kaiser und Kaiserin und ihren Gouverneuren. Miles wird von der übermenschlichen Schönheit der cetagandischen Haud-Frauen, die sich normalerweise nur in ihren weißen Energiekugeln quasi verschleiert zeigen, geradezu geblendet, und darf sich anstelle des Lesers beängstigt fragen, wohin die Perfektion und Zuchtauswahl der Haud sie führen wird – Werden sie sich im weiteren Verlauf ihrer Entwicklung überhaupt noch als Teil der gewöhnlichen menschlichen Rasse ansehen? „Cetaganda“ ist mit Abstand der spannendste Roman des Sammelbands und mein Favorit, der Mix aus Agententhriller, SciFi und Genetik ist vortrefflich gelungen.
„Ethan von Athos“ ist die humorvollste Geschichte, sie entstand bereits vor der Veröffentlichung des ersten |Barrayar|-Romans bei |Baen Books|. So trägt Ethan einige Charakterzüge des späteren Helden Miles; mit der smarten Eli Quinn, die bereits im ersten Sammelband Plasmaverbrennungen im Gesicht erlitten hat, taucht zudem eine dank betanischer Biotechnologie wiederhergestellte strahlende Schönheit auf, die in einer ursprünglichen Konzeption der Serie wohl Miles Gefährtin hätte werden sollen. Neben der amüsanten Männergesellschafts von Athos gefällt vor allem der Kontrast zu der Raumstation. Originell stellt Bujold das Leben an Bord von Station Kline dar: So machen sich Eli und Ethan des Öfteren die Sicherheitsorgane der Station zunutze, fingieren einen Brand oder geben der Biokontrollwartin der Station Hinweise auf eine eingeschleppte Krankheit oder eine Kakerlake, auf die sie sich mit dem Zorn und Eifer einer Furie stürzt. Mit der Ernährung an Bord der Station hat Ethan auch einige Probleme, werden doch tote Menschen zum Düngen der Pflanzenkulturen verwendet, ebenso scheint die Speisekarte fast nur aus Wassermolch zu bestehen: Wassermolch-Creole, Molch-Mousse in Aspik, gebratene Wassermolcheier, Molch mit Fritten oder Molch im Topf hängen allerdings auch den Stationsbewohnern zum Hals heraus, welche die in der atmosphärischen Wiederaufbereitungsanlage als Nebenprodukte entstandenen Molche massenweise als Froschschenkel an planetarische Restaurants verkaufen.
Doch es geht nicht nur abstrus und lustig zu auf Station Kline, denn Oberst Millisor vom cetagandischen Sicherheitsdienst versteht überhaupt keinen Spaß – ohne die smarte Eli hätten der gesuchte Klon Terrence sowie Ethan keine Chance. Hier setzt auch meine Kritik an, denn Eli ist nicht ganz so sympathisch oder glaubwürdig wie andere Figuren; wie viele weibliche Hauptfiguren Bujolds (wie z. B. Miles Mutter Cordelia) ist sie ein wenig zu perfekt, wo bei den männlichen klare Schrullen und Macken vorhanden sind. Der Spaßfaktor überwiegt in dieser Geschichte den Thriller-Anteil, allerdings ist Bujolds Humor wirklich köstlich genug, um die durch die Blödelei etwas fehlende Spannung zu kompensieren.
Der Titel „Labyrinth“ enthält eine Anspielung auf den Klon, den Miles aus seinem Kerker befreit: |Taura| ist eine Mischung aus Mensch und Stier – quasi ein Minotaurus, ein gezüchteter Superkriegerprototyp, der leider nicht zur vollständigen Zufriedenheit ausfiel. In dieser Novelle wird die Skrupellosigkeit von Wissenschaftlern im Dienst noch skrupelloserer Verbrecher, den Baronen des verkommenen und ultrakorrupten Planeten Jackson’s Whole, angeprangert. Aber auch normale Menschen sind gegenüber exotischen Wesen herablassend oder reduzieren sie auf den Status eines Lustspielzeugs, wie es Baron Ryoval mit der Quaddie Nicol tut. Quaddies sind übrigens beinlose, dafür vierarmige Menschen, die an Nullgravitation angepasst wurden. Auch auf Miles wirkt Taura sehr befremdlich, aber er selbst ist an Gehässigkeiten und herablassende Kommentare wegen seiner körperlichen Defizite gewöhnt; gerade auf Barrayar wird alles von der Norm Abweichende abgelehnt. Darum setzt er alles daran, nicht nur sie, sondern auch Nicol zu retten.
Um seinen Auftrag, den Genetiker sicher nach Barrayar zu bringen, zu erfüllen, muss Miles sich auf einige krumme Deals mit den Baronen Fell und Ryoval einlassen und sie gegeneinander ausspielen – was gar nicht so einfach ist, denn auch wenn man sich untereinander inoffiziell um die Macht rangelt, von einem dahergelaufenen Söldnerkommandanten lässt man sich nun wirklich nicht an der Nase herumführen – und so landet Miles schließlich im Labyrinth bei Taura …
Als Novelle ist |Labyrinth| nicht ganz so umfangreich wie die beiden vorhergehenden Romane, die Geschichte passt dennoch hervorragend in das große Thema des Romans, die Genetik, und setzt dabei wieder andere Akzente. War |Cetaganda| spannend und faszinierend, |Ethan von Athos| vor allem humorvoll, macht das |Labyrinth| in erster Linie nachdenklich.
_Unterhaltsamer kann eine Space Opera kaum sein_
Lois McMaster Bujold wurde und wird nicht umsonst mit Auszeichnungen überhäuft. Sie hat ein Talent als Geschichtenerzählerin, das seinesgleichen sucht. Mit Miles Vorkosigan hat sie einen liebenswerten Antihelden geschaffen, dessen Abenteuer einen unwiderstehlichen Mix aus Science-Fiction, Agententhriller und Komödie bieten. Ihr Sinn für Humor und die ironische Weise, in der die Charaktere in ihren Dialogen Ereignisse kommentieren, sind einfach köstlich.
Neben einer Sternenkarte sowie einer nützlichen Zeittafel des Zyklus enthält der Sammelband auch ein aufschlussreiches Nachwort der Autorin. Für die exzellente Übersetzung zeichnet wieder einmal Michael Morgental verantwortlich, der bereits zahlreiche andere Romane des Barrayar-Universums übersetzt hat. Ebenso zahlreiche in den Originalausgaben vorhandene (Sinn-)Fehler der Übersetzung wurden für „Gefährliche Missionen“ dankenswerterweise korrigiert.
Ich kann die Barrayar-Sammelbände jedem SciFi-Fan nachdrücklich empfehlen. Man erhält nicht nur in Deutschland schwer erhältliche Novellen aus dem Barrayar-Universum; die Möglichkeit, eine hervorragende Neuausgabe dieser mit Preisen wahrlich überschütteten Serie zu erhalten, sollte man sich nicht entgehen lassen. Wie auch die anderen Barrayar-Romane konnte ich dieses Buch einfach nicht aus der Hand legen.
Der Titel „Gefährliche Missionen“ ist vermutlich eine Last-Minute-Entscheidung des Verlags, ursprünglich wurde der dritte Barrayar-Sammelband mit „Cetaganda“ tituliert, deshalb findet man selbst auf den Seiten des Verlags „Gefährliche Missionen“ noch mit dem alten Covertitel „Cetaganda“.
Die offizielle Homepage der Autorin:
http://www.dendarii.com/
Rankin, Ian – zweite Zeichen, Das
Ein ganz normaler Montag im Leben von John Rebus, Detective Inspector bei der Mordkommission der schottischen Metropole Edinburgh. Gerade hat ihn die Freundin verlassen, sein publicitygieriger Chef will ihn für eine Antidrogen-Kampagne zwangsrekrutieren, und selbstverständlich regnet es wieder in Strömen – da passt es gut ins Bild, dass Rebus in die übel beleumundete Siedlung Pilmuir gerufen wird. Dort stehen die meisten Gebäude leer und warten darauf abgerissen zu werden – theoretisch jedenfalls, denn tatsächlich haben sich in den Ruinen Hausbesetzer eingenistet, deren bloße Anwesenheit den Stadtvätern schon lange ein Dorn im Auge ist.
Der junge Herumtreiber Ronnie McGrath ist offensichtlich an einer Überdosis Heroin gestorben – kein ungewöhnliches Ende in Pilmuir. Doch Rankin fällt auf, dass der Körper des Toten mit Blutergüssen übersät ist, und später wird der Polizeiarzt entdecken, dass Ronnies „Stoff“ reichlich mit Rattengift versetzt wurde. In einem Nebenraum irritiert den Inspector ein sorgfältig an die Wand gemaltes Pentagramm – wurde Ronnie ein Opfer satanistischer Umtriebe? Seiner Freundin Tracy weiß davon angeblich nichts, aber sie gibt immerhin zu, dass sich Ronnie in den letzten Wochen seines Lebens verfolgt fühlte.
Rebus dreht sich bei seinen Ermittlungen im Kreis. Überrascht muss er erfahren, dass in Edinburgh mindestens sechs okkultistische Gruppen bekannt sind. Doch die Spuren weisen auch in andere Richtungen: Ronnies Bruder ist Polizist und deckte dessen illegale Aktivitäten. Noch beunruhigender sind die Verbindungen, die Rebus zwischen dem Ermordeten und jener Gruppe vermögender und einflussreicher Geschäftsleute entdeckt, von denen die erwähnte Antidrogen-Kampagne finanziert wird. Sie gehören einer neuen Generation an: Junge, skrupellose, erfolgreiche Finanzhaie sind es, die hart arbeiten und sich in ihrer knappen Freizeit amüsieren wollen – und im Beruf wie im Privatleben ist das Gesetz etwas, über das sie sich jederzeit erhaben fühlen!
Das bekommt Rebus zu spüren, als er der Wahrheit zu nahe kommt. Seine unsichtbaren Gegner fädeln ein Komplott ein, um den lästigen und ihnen allmählich gefährlich werdenden Spielverderber auszuschalten. Doch sie haben Rebus unterschätzt – und sie wissen nichts von Ronnies Vermächtnis, das dieser als Lebensversicherung an einem ganz besonderen Ort verborgen hält …
„Das zweite Zeichen“ ist – wie der Zufall so spielt – nicht nur der deutsche Titel des im Original viel anschaulicher „Verstecken & Suchen“ betitelten Romans, sondern markiert tatsächlich den zweiten Auftritt von John Rebus, Polizist in Edinburgh, der nun definitiv ansetzt, seinen Siegeszug auch durch die hiesige Krimi-Szene anzutreten.
In Großbritannien ist Rebus schon lange Stammgast in den Bestseller-Listen. Zwar geht es gar finster und notorisch depressiv zu in Ian Rankins Edinburgh, aber wenn man schon glaubt, nun geht’s nicht mehr, kommt doch irgendwo ein Lichtlein in Gestalt des berühmten britischen Humors her. Die Welt ist schlecht, das Leben hart, aber das heißt noch lange nicht, dass man beidem keine komischen Seiten abgewinnen könnte!
Dazu kommen die ungewöhnlichen Fälle, mit denen Rankin seinen Inspektor von der traurigen Gestalt konfrontiert. Sie sind beinahe überkompliziert, „gothic“ und ziemlich abgedreht; das wird sich in den weiteren Bänden der Serie sogar noch steigern. Weil Rankin aber den Überblick behält und sein Garn zu spinnen weiß, entsteht stets eine höllisch spannende und rasante Geschichte daraus.
Mit „Das zweite Zeichen“, im Original bereits 1991 erschienen, beweist Rankin ungewöhnlichen Scharfblick: Spätestens als im Kino der „Fight Club“ erfolgreich lief, musste sich die Gesellschaft in den sogenannten Industrieländern der unangenehmen Gewissheit stellen, dass unter denen, die nicht unter die Räder der Globalisierung geraten sind, sondern wirtschaftlich definitiv zu den Gewinnern gehören, eine Generation herangewachsen ist, die sich langweilt mit dem, was sich für schnöden Mammon kaufen lässt, und auch in der bizarrsten Extremsportart den ersehnten Kick nicht mehr findet.
Hier setzt Rankin an. Er hatte allerdings zusätzlich eine solide Basis für seine böse Geschichte vom menschlichen Treibgut, das die Satten und Unbarmherzigen im wahrsten Sinn des Wortes befriedigen muss: Großbritannien im Jahre 1991 war ein durch den Steinzeit-Kapitalismus der Ära Margareth Thatcher zerrüttetes Land, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich nicht nur immer größer, sondern das Verantwortungsgefühl der Privilegierten für die (unschuldig) weniger Begünstigten praktisch auf den Nullpunkt gefallen war. An dieses Phänomen konnten wir uns weltweit inzwischen gewöhnen; man denke nur an die verelendeten Länder des ehemaligen Ostblocks, deren Jugend – so denkt man manchmal – hauptsächlich deshalb heranwächst, um der Pornoindustrie des Westens den regelmäßigen Nachschub an Darsteller/inne/n zu sichern. Insofern hat „Das zweite Zeichen“ nichts von seiner Aktualität verloren.
Rebus selbst hat sich verändert. Fröhlicher ist er nicht geworden. Allerdings verliert Rankin auch kein Wort mehr über die Psychosen seines Helden, die auf eine brutale militärische „Spezialausbildung“ bei einer Elite-Fallschirmjäger-Einheit zurückgehen. Bei seinem Debüt drohte Rebus daran noch endgültig zu zerbrechen, aber nachdem die Figur ihre „Serientauglichkeit“ unter Beweis gestellt hatte, ließ Rankin Rebus’ geistige Defekte offensichtlich stillschweigend fallen. Er wird aber trotzdem nie auf dem Tisch tanzen, denn dafür präsentiert ihm die Welt – repräsentiert durch seine Heimatstadt Edinburgh – immer wieder neue Beweise dafür, wie schlecht sie (geworden) ist. In dieser Beziehung ist Rebus Deutschlands Lieblings-Kommissar Kurt Wallander durchaus ein Bruder im Geiste (der richtige sitzt ja als verurteilter Drogendealer im Gefängnis – ein weiterer Nagel zu Rebus’ Sarg …) – nur eben mit Humor.
Ian Rankin, geboren 1960 im schottischen Fife, lebte zwar mit seiner Familie lange in Südfrankreich, konnte sich dort aber offensichtlich gut an seine Jahre in Edinburgh und später London erinnern. Sein erstes John-Rebus-Abenteuer veröffentlichte er 1987; da sich der Erfolg rasch einstellte, ließ Rankin seinem Debüt weitere John-Rebus-Abenteuer folgen, die inzwischen ihren Weg nach Deutschland gefunden haben; kurioserweise in chronologischer Reihenfolge als Taschenbuch die älteren Bände, während die aktuellen Rebus-Thriller gebunden geadelt werden, um die angefütterten Krimi-Freunde besser zur Kasse zu bitten. In seiner schottischen Heimat, aber auch im gesamten britischen Inselreich hat Rankin dank Rebus inzwischen längst Kultstatus erreicht. Dazu trägt in nicht geringem Maße die höchst erfolgreiche TV-Serie „Inspector Rebus“ bei, die das Schottische Fernsehen seit 2000 ausstrahlt. Wer weiß; vielleicht erbarmt sich ja auch hierzulande ein (wahrscheinlich privater) Sender, der noch eine Sendepause zwischen zwei Verkaufsshows füllen muss …
Ford, G. M. – Erbarmungslos
Wer mein Arbeitszimmer beguckt, muss mich mittlerweile für einen arg morbiden Menschen halten. Aus jeder Ecke lugen Serienkiller und wetzen ihre vom menschlichen Hang zum Perversen determinierten Mordinstrumente. Das Blut von tausend Opfern müsste längst die Regalhölzer aus fester Eiche brutal aufgeweicht haben, die Todesschreie müssten mir in den Ohren gellen, während ich doch scheinbar ach so ruhig diese Zeilen schreibe. Dabei läuft es mir kalt den Rücken runter – warum sind so viele Menschen begierig, derlei Romane zuhauf aus den Buchläden zu schleifen und sich einem blutdurstigen Mörder in die Arme zu werfen …
Diese Frage erörtere ich hier natürlich nicht – ich höre bis zu meinem Schreibtisch das Aufatmen! -, aber es ist doch bezeichnend, dass Jahr um Jahr in die breite Phalanx profilierter und frisch hineingewachsener Autoren und Autorinnen neue Epigonen eine Schneise schlagen und sich am Schnitzel-Handwerk versuchen wollen. G. M. Ford (Ein Name wie zwei Automarken! Wenn seine Romane nicht rasant sind, dann weiß ich’s nicht …) ist eines dieser aufstrebenden Jungtalente (das wage ich einmal ohne nähere Verifizierung zu schreiben, denn der Verlag hält sich ungewohnt bedeckt bei Fords Vita: „G. M. Ford unterrichtete einige Zeit Creative Writing in Washington, heute lebt er als freier Schriftsteller in Seattle …“ Ford könnte also auch ein Pseudonym für Irgendwen sein oder raschen Schrittes auf die Hundert zugehen). Mit „Erbarmungslos“ (recht frei übersetzt aus dem Original: „Fury“; der Titel „Wut“ hat eine gewisse Bedeutung) legt er sein Erstlingswerk vor.
Ein vor den Augen der Öffentlichkeit (und somit auch möglicher Arbeitgeber) in Ungnade gefallener Journalist namens Frank Corso steigt in einen alten Fall ein, der ihn vor einigen Jahren bereits in Atem gehalten hat: Der als „Müllmann“ in Seattle und Umgebung bekannt gewordene Serienvergewaltiger und Killer ließ seine acht Opfer allesamt auf Müllbergen zurück. Der Fall schien 1998 aufgeklärt, als Walter Leroy Himes hinter Gitter gebracht werden konnte; die Beweise waren sogar stichhaltig genug, um die Todesstrafe in wenigen Tagen vollstrecken zu können.
Da meldet sich eine Zeugin von damals, die ihre Aussage vor den Leuten der Seattle Sun widerruft; ein Fall für Corso, dem eine letzte Chance vor die Füße gelegt wird. Er nimmt an und greift die losen Fäden auf, die ihn bereits vor Jahren an der Täterschaft von Himes zweifeln ließen. Gemeinsam mit der Fotografin Meg Dougherty, die ihm auf Schritt und Tritt folgen wird, auch wenn sie sich anfangs recht widerwillig geriert, hängt er sich an die wagen Spuren. Dabei darf er nicht auf die Unterstützung der örtlichen Polizei zählen, im Gegenteil, Densmore ist ein richtig schmieriger Polizist, der Corso am liebsten in hohem Bogen aus der Stadt werfen würde. Also forscht Corso auf eigene Faust weiter, was dem notorischen Einzelgänger sicherlich auch sehr nahe liegt.
Na ja, ganz so einzelgängerisch ist Corso nicht, Dougherty (wie sie liebreizend genannt wird) kommt ihm näher; oder war es umgekehrt? Jedenfalls bleibt ein solches koitales Intermezzo natürlich nicht aus, zudem Corso sich seiner haarigen Ex-Frau mit Händen und Füßen erwehren muss. Das alles gestaltet sich zaghaft turbulent und nimmt etwa in der Mitte des Buches, so bei Seite 200 von 386, etwas Fahrt auf, ohne dass der Thriller dem vorbelasteten Namen des Autors alle Ehre machen würde.
Zum Ende hin, als Himes mehr oder weniger errettet wird, nimmt die Handlung noch eine durchaus logische Wendung, denn ein Mitläufer hat sich in die Serienmorde eingeklinkt und möchte unauffällig an der fremden Täterschaft partizipieren. Corso ist der Einzige, dem ein Lichtlein aufgeht, die Polizei dagegen ist bequem und mit dem Erreichten zufrieden (eigentlich auch wieder nicht, denn Ford stellt es so dar, dass wohl alle Himes gerne hingerichtet gesehen hätten – nur Corso will Gerechtigkeit …)
Da hinterlässt uns Ford ein zwiespältiges Buch: Die Spannung ist ja doch vorhanden, aber der Einstieg in die Handlung will nicht so recht marschieren. Das dümpelt stattdessen fade dahin, wenn Corsos Werdegang in Ansätzen aufgedröselt wird – wen interessiert’s, fragte ich mich irgendwann, trägt es doch weder zur Geschichte entscheidend bei, noch verleiht die maue Fehlleistung von Corso ihm so viel Profil, dass sein Charakter an Schärfe gewinnt. Er bleibt blass. Und reiht sich damit in die Gruppe derjenigen ein, die uns Ford ansonsten noch präsentiert: Meg Dougherty – okay, ein nettes Mädchen, aber grau im Teint und schmal hinter Corsos Rücken versteckt. Die übrigen Statisten sind eben nur Randfiguren, deren Leben für den Leser unscheinbar, unnahbar bleibt. Austauschbare Figuren in einem von Corso dominierten Spiel. Wenn dem aber so ist, dann hätte Corso eine kräftige Persönlichkeit sein müssen. Dazu fehlen ihm die Klasse, das Charisma, die Lebensgeschichte, standfeste moralische Grundsätze.
Er ist beliebig, auch wenn ihm Ford an einer Stelle ein starkes Stück in den Mund legt, als die Sprache auf den elektrischen Stuhl kommt und ein Opfer, dem die Flammen zwanzig Zentimeter aus den Ohren schossen: „Lasst die Kids ein paar Dutzend Mal zusehen, wie Kriminelle sich als Bunsenbrenner präsentieren, dann kreuzen garantiert sehr viel weniger von diesen kleinen Scheißern mit Kanonen in der Schule auf … Weil Sachen wie intellektuelle Gewissheit, moralische Entrüstung und rechtschaffene Empörung die Motoren der Gesellschaft sind. Selbstzufriedene Toleranz hat noch nie irgendetwas bewirkt, außer den Blick auf das zu vernebeln, was falsch und was richtig ist.“ Hoppla, starker Tobak und gar nicht politisch korrekt, Mister Ford. Derart verkürzt unters Volk geschleuderte philosophische Exzerpte aus dem Bauch eines Thrillerautoren sind natürlich gefährliches Brot, weil sie ohne nachgehende Erläuterung gar nichts erklären, sondern nur ein brüchiges Statement abgeben. Damit ist niemandem gedient, das sind Stammtisch-Parolen auf gediegenem Niveau, mehr nicht.
Möchte ich G. M. Ford das noch durchgehen lassen, so muss ich ihm den aus verschiedenen Versatzstücken des Krimilehrbuchs erstellten Roman ankreiden: Es wirkt wie bessere Flickschusterei, aus dem Schubfach mit den Motiven nehme ich den psychopathischen Serienmörder, das Fach mit den Hauptdarstellern bevorratet einen beziehungslosen, halbwegs gescheiterten Schnüffler (oder Journalist, was in der propagierten Form auf dasselbe hinausläuft), die Schublade der Begleitpersonen hält eine erst einmal distanzierte, geziemend forsche Frau bereit, und so weiter. Sodann verkürze ich die Sprache, sobald Tempo die Erzählung vorantreiben soll: „Wald ließ den Umschlag los. Corso ließ ihn gegen sein Bein fallen. Wald öffnete den Mund, um etwas zu sagen, überlegte es sich anders. Drückte auf den Knopf.“ Wenn dieses stilistische Mittel gekonnt eingesetzt wird, fühlt sich der Leser in den Sog der Geschichte hineingezogen. Bei Ford liest es sich dagegen aufgesetzt, weil er wahllos damit hantiert.
Sind das Auswirkungen des „Creative Writing“? – Könnte sein. Dann sollte Ford aber schnellstens einige seiner eigenen Kurse selbst belegen, um sich noch den letzten Schliff zu verpassen.
Ach, und wenn man schon irgendwie hip sein will, dann sollte ein US-Autor wie Ford nach all den Jahren auch kapiert haben, dass sich |Lynyrd Skynyrd| so und nicht anders schreiben. Aber man kann natürlich auch zusammengeschaufeltes Second-Hand-Wissen als eigene Schlaumeierheiten verkaufen – blöd nur, wenn man sein Unwissen dann durch Fehler selbst offen legt. (Okay, als Uralt-Fan reagiere ich hier wahrscheinlich etwas überreizt …)
„Erbarmungslos“ ist für einen Thriller-Erstling nicht schlecht, aber das Sujet hat bessere Kriminalromane gesehen, mit tafferen Ermittlern und Serienmördern mit mehr Kontur. G. M. Ford muss beim nächsten Buch einen Zahn zulegen, um nicht gleich nach der ersten Runde abgehängt zu werden.
|Originaltitel: Fury
Aus dem Amerikanischen von Marie-Luise Bezzenberger|
_Karl-Georg Müller_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de veröffentlicht.|
Smith, Jonathan – Fenster zur Nacht
In den Jahren 1987 bis 1994 wurde der Autor Jonathan Smith selbst Opfer eines Persönlichkeitsdiebstahls, das vorliegende Buch ist aus dieser Erfahrung heraus entstanden, doch kann der Leser nur mutmaßen, wie weit die autobiografischen Bezüge reichen …
_Ich bin du und du bist niemand_
Patrick Balfour steht in der Mitte seines Lebens und kann auf weitreichende Erfolge zurückblicken: Er ist nicht nur Direktor einer Schule mit ausgezeichnetem Ruf, sondern auch Autor von historischen Bestsellern. Einzig sein Familienleben droht auseinander zu brechen, denn nach der Affäre mit seiner Lektorin Liz existiert Patricks Ehe eigentlich nur noch auf dem Papier. Seine Ehefrau Caroline und er haben sich praktisch nichts mehr zu sagen, außerdem verbringt Patrick mehr Zeit in seiner Wohnung in der Schule als in seinem Haus bei Caroline. Doch eines Tages bricht Patrick Balfours nahezu heile Welt in sich zusammen. Er wird beschuldigt, an einer Tankstelle Benzin gestohlen und in seiner Wohnung pädophile Fotos aufgenommen zu haben. Seine Alibis sind recht dünn, sodass Patrick Balfour sich unverhofft in Untersuchungshaft wiederfindet.
Auf Kaution darf Patrick das Gefängnis schließlich wieder verlassen, doch scheint die Polizei weiterhin von seiner Schuld überzeugt zu sein. Auch die Fotos von „ihm“ an der Tankstelle sprechen gegen ihn, bei dem aufgezeichneten Benzindieb kann es sich nur um einen guten Doppelgänger handeln, doch wie sind die Fotos von dem kleinen Jungen in Patricks Wohnung entstanden? Für Patrick Balfour beginnt das Rätselraten; kann es ein neidischer Kollege sein, der ihm an den Kragen möchte? Wie denkt jemand, der ihm diese Verbrechen anhängen möchte? Und wem kann er nun noch trauen? Soll er mit seiner Frau sprechen oder doch eher mit der ehemaligen Geliebten?
Als verdächtige Botschaften von seinem Widersacher in Patricks Postfach in der Schule auftauchen, scheint der Kreis der Verdächtigen sich weiter einzugrenzen. Doch handelt es sich tatsächlich um ein Ränkespiel innerhalb des Lehrerkollegiums? Zu diesen Sorgen gesellen sich schließlich noch Probleme mit Patricks Tochter Alice, die mehr Zeit in ihr Theaterspiel investiert als in die Schule und die ihren Eltern gegenüber immer abweisender reagiert. Was ist bloß los an Patricks Schule?
_Zerbrechende Idylle_
Zu Beginn des Buches begegnet uns Patrick Balfour, der uns als erfolgreicher Schuldirektor und Bestsellerautor vorgestellt wird, doch dauert es nicht lange, bis er mit der Polizei und ihren Anschuldigungen konfrontiert wird. Völlig unverhofft sieht Patrick Balfour sich Inspector Bevan gegenüber, der Beweisfotos besitzt, die den bekannten Schuldirektor schwer belasten können. Doch wie kann dies sein? Balfour weiß weder von dem Benzindiebstahl noch von den pornografischen Fotos. Nachdem er wieder auf freiem Fuß ist, beginnt für Balfour das Nachdenken. Langsam ahnt der Leser, dass Patrick Balfour mehr Feinde hat, als auf den ersten Blick offensichtlich war. Schnell fallen ihm aus dem Lehrerkollegium einige Namen ein, die durchaus für einen solchen Persönlichkeitsdiebstahl in Frage kämen. Balfour durchdenkt nicht nur gewissenhaft mögliche Tatmotive, sondern versucht sogar, wie sein Feind zu denken. Bei diesen Gedankenexperimenten bemerkt Balfour schnell, wie der Täter vorgegangen sein kann, doch kristallisiert sich immer noch niemand heraus, der für die Botschaften, den Diebstahl und die Fotos verantwortlich gemacht werden kann.
Jonathan Smith inszeniert ein interessantes Psychospiel, indem er Patrick Balfours Gedanken, seiner Ungewissheit und seinen Zweifeln viel Raum gibt. Patrick versucht sogar, sich in den Täter hineinzuversetzen und erschreckenderweise gelingt ihm diese Identifikation äußerst gut. In seinen Gedanken kommt er so seinem Widersacher sehr nah, nur einige wenige Wissenslücken bleiben, die Balfour sich nicht erklären kann. Der Leser ist zu jedem Zeitpunkt mitten im Geschehen und hat Anteil an jedem Gedanken, den Patrick Balfour fasst; hier merkt man der Erzählung an, dass der Autor weiß, wovon er schreibt und dass er diese Gedanken selbst schon gehabt haben muss. In das Opfer eines Persönlichkeitsdiebstahls kann man sich wohl nur schwer hineinversetzen; viele Ideen, die Patrick Balfour kamen, erschienen mir etwas absurd, doch aus Jonathan Smiths eigener Erfahrung heraus wirken sie dennoch realistisch.
Leider hält sich Smith an etlichen Stellen mit zu ausschweifenden Erzählungen auf, springt ohne Überleitung in Patricks Vergangenheit und berichtet ausführlich von seiner Affäre zu Liz oder auch von seinem und Carolines Kennenlernen. Diese Exkurse stellen zwar den Hauptprotagonisten besser vor und helfen uns dabei, uns ein gutes Bild von ihm zu machen, dennoch bremsen sie den Spannungsaufbau arg aus, der gerade zu Anfang zunächst gelungen schien. Über weite Strecken passiert nicht mehr, als dass Patrick Balfour immer neue Nachrichten in sein Postfach gelegt bekommt und über mögliche Täter nachdenkt.
Dem Buch fehlt eine wirklich packende und spannungsgeladene Rahmengeschichte, die dem Roman seine Brisanz verliehen hätte. Zu schnell erhält Patrick Balfour den Rückhalt seiner Familie und auch Inspector Bevan schlägt sich bald auf seine Seite, sodass die drohende Gefahr zu sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Balfour wird dadurch früh zu einem bemitleidenswerten Opfer, um das man nicht wirklich fürchten muss. Von Psychothriller war in diesem Buch daher bedauerlicherweise nur wenig zu spüren. Der Autor verspielt leider viel Potenzial, denn aus diesem Thema hätte gerade Jonathan Smith aus seiner eigenen Erfahrung heraus einen gut durchdachten und spannenden Thriller schreiben müssen.
Jonathan Smith ist die Gratwanderung zwischen interessanten psychologischen Gedankenspielen und stetig wachsender Gefahr leider nicht gelungen, zu sehr legt er seinen Schwerpunkt auf die Suche nach dem Täter und vergisst dabei völlig, den Spannungsbogen steigen zu lassen und zwischendurch Situationen einzustreuen, die die Handlung bedrohlicher gestaltet hätten. Besonders der Mittelteil des Buches zieht sich dadurch lang hin. Am Ende schafft Smith es zwar, mit einer kleinen Überraschung aufzuwarten, allerdings verpufft auch bei der Auflösung viel Spannung.
Insgesamt ist das „Fenster zur Nacht“ zügig durchgelesen und weiß stellenweise auch zu unterhalten, doch erhält es nicht die Faszination, die ich mir von einem Autor erwartet hätte, der selbst über Jahre hinweg Opfer eines Persönlichkeitsdiebstahls geworden ist und daher viele eigene Erfahrungen in die Geschichte hätte einfließen lassen können. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Jonathan Smith absichtlich nicht allzu viel von sich preisgeben wollte, denn die beschriebene Situation muss in Wirklichkeit viel bedrohlicher (gewesen) sein, als sie sich dem Leser darstellt. Durch die weitschweifenden Gedankenmonologe Patrick Balfours schleppt sich die Geschichte träge dahin, ohne wirklich Spannung aufzubauen; leider führt dies auch dazu, dass man dem Hauptcharakter recht gleichgültig gegenüber steht. So bleibt am Ende doch eher ein mittelmäßiger Eindruck, weiterempfehlen würde ich dieses Buch daher nicht.
Jordan, Sherryl – Jing-Wei und der letzte Drache
Justin ist ein einfacher Bauernbursch, der zuhause die Schweine hütet. Besonders zufrieden ist er nicht mit seinem Leben. Doch eines Tages kehrt er vom Nachbarort nach Hause zurück und findet das gesamte Dorf in Schutt und Asche vor! Zutiefst verzweifelt, will er am liebsten ebenfalls sterben. Stattdessen nimmt ihn der Anführer einer fahrenden Schaustellertruppe mit. Was Justin letztlich aus seiner Lethargie reißt, ist die Bekanntschaft mit Jing-Wei, einem Chinesenmädchen, das wegen seiner eingebundenen Füße von den Schaustellern als Missgeburt ausgestellt wird. Als der Sohn des Anführers sich an ihr zu vergreifen droht, fliehen die beiden und landen schließlich bei einer alten Frau, die nichts Geringeres von den beiden verlangt als den Drachen zu töten, der Justins Dorf niedergebrannt hat. Schon die Idee erscheint Justin absolut närrisch! Und trotzdem lässt er sich auf dieses Abenteuer ein.
Sherryl Jordan hat ein Buch geschrieben, das sowohl von historischen als auch Fantasy-Elementen geprägt ist. So hat sie die Geschichte nicht in einer erfundenen Welt sondern im England des Jahres 1356 angesiedelt, ihre Charaktere sind keine Magier oder Zauberinnen oder sonst in irgendeiner Weise besonders begabt. Im Gegenteil.
Justin, der Ich-Erzähler, ist ein einfacher Bauernbursche, der weder besonders klug noch besonders geschickt ist. Das Mädchen, für das er schwärmt, belächelt ihn lediglich. Dass er dem Inferno entkommen ist, das seine ganze Familie dahingerafft hat, ist purer Zufall. Und nach der Rolle des Helden drängt es ihn absolut nicht, vielmehr würde er es vorziehen, schleunigst das Weite zu suchen. Er hat entsetzliche Angst vor dem Drachen und gibt das auch ganz freimütig zu. Dass er im Grunde nicht wirklich ein Feigling ist und auch sonst durchaus einige Qualitäten besitzt wie Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft, das ist ihm vor lauter Bescheidenheit noch gar nicht aufgefallen. Justin ist auf eine stille, unaufdringliche Weise Held, ohne strahlende Rüstung und dergleichen.
Auch Jing-Wei ist eigentlich keine Wundertäterin oder etwas in der Art. Ihr Tun wirkt nur so wunderbar auf Justin, weil es ihm so fremd ist. Fast alles von dem Wissen, das Jing-Wei im Kampf gegen den Drachen nutzt, ist im damaligen England noch völlig unbekannt. Justin hat keine Ahnung, wie Schießpulver funktioniert, und noch nie im Leben einen Seidendrachen gesehen. Folglich kommt ihm das alles unglaublich fantastisch vor. Insofern bildet Jing-Wei sozusagen das Bindeglied zwischen Justins „normaler“ Welt und dem phantastischen Wesen des Drachen.
Bemerkenswert an Jordans Buch ist allerdings, dass der Drache kein Ungeheuer ist. In der chinesischen Kultur sind Drachen Schutzwesen, folglich ist für Jing-Wei als Chinesin ein Drache etwas Gutes und Schönes. Diese Ansicht findet Justin außerordentlich verwirrend, er kann sie nicht mit dem Anblick der verkohlten Dörfer in Einklang bringen. Doch schon, als er den Drachen zum ersten Mal aus der Nähe beobachtet, wird deutlich, dass Justin mit sich selbst nicht ganz einig ist. Die ungeheure Schönheit des Drachen hat ihn beeindruckt, und obwohl er immer noch entsetzliche Angst hat, wird aus der Vorstellung vom Ungeheuer allmählich die Erkenntnis, dass der Drache im Grunde nichts weiter ist als ein Tier. Zwar ein besonderes Tier, das Feuer speien kann, das aber weder bösartig noch hinterlistig ist. Eigentlich ist es fast schade und eine Verschwendung, es zu töten, da der Drache jedoch Menschen gefressen hat, kann er nicht am Leben bleiben.
Genauso außergewöhnlich wie die Darstellung des Drachen ist es, dass die Autorin ganz ohne Bösewicht auskommt. Vielmehr sind die Beteiligten alle Kinder ihrer Zeit, die geprägt war von Unwissenheit und Aberglaube. Tybalt, der Anführer der Schausteller, ist nicht wirklich grausam in dem Sinne, dass es ihm Spaß macht, Jing-Wei zu quälen. Eine Exotin ausstellen zu können, ist einfach eine Möglichkeit des Geldverdienens. Immerhin versucht er gleichzeitig, auf rauhe und unbeholfene Art Justin aus seinem Kummer und seiner Lethargie herauszuholen. Sein Sohn Richard ist ein Traumtänzer und sehr mit sich selbst beschäftig, Jing-Weis Schicksal lässt ihn einfach kalt, genau wie das des Bären. Aufmerksam wird er erst, als das Mädchen sich mit Justin anfreundet. Seine Reaktion ist typisch für jemanden, der es nicht verträgt, wenn andere ihm vorgezogen werden.
Die Reaktion der Leute angesichts des Mädchens sind eine Folge dessen, auf welche Weise sie angepriesen wird. Eine Missgeburt oder ein Gruselmonster aus sicherer Entfernung bestaunen zu können, ist so, wie heutzutage vom bequemen Fernsehsessel aus einen Horrorfilm anzusehen. Für die Gaffer waren diese armen Geschöpfe einfach keine Menschen und deshalb nicht bemitleidenswert. Diese Einschätzung zu revidieren, war für die meisten einfach nicht möglich, zu stark waren Aberglauben und Angst vor Teufeln und Dämonen in den Menschen verankert. Kein Wunder also, dass niemand Justin und Jing-Wei helfen will.
Ohne Hilfe von außen andererseits ist der Drache nicht zu bezwingen, denn Justin ist kein Kämpfer, und ohnehin ist selbst das keine Garantie für einen Erfolg. Da die Hilfe aus genannten Gründen nicht von Einheimischen kommen kann, begegnen Justin und Jing-Wei einer alten Chinesin. Wie diese Frau nach England kam, wird nicht erzählt, was wahrscheinlich auch besser ist, denn schon Jing-Weis Weg nach England kam mir ein wenig erstaunlich vor angesichts der Tatsache, dass China sich jahrhundertelang völlig von der Außenwelt abgeriegelt hat, und selbst in offenen Zeiten niemals weiter als bis nach Arabien gesegelt ist! Andererseits handelt es sich hier um ein Jugendbuch, und ich denke, jugendlichen Lesern dürfte dieser Schnitzer wohl kaum auffallen, also sei darüber hinweggesehen.
Von der alten Lan erhalten die beiden die Informationen und Hilfsmittel, die sie für den Kampf gegen den Drachen brauchen, außerdem lernt Jing-Wei durch sie wieder gehen. Das Verhalten der Leute der alten Lan gegenüber wirft erneut einen deutlichen Blick auf Aberglaube und Vorurteile der damaligen Zeit.
Sherryl Jordan schreibt flüssig und in kurzen, schlichten Sätzen. Auf einfache Weise bringt sie Justins Gefühle, vor allem seine Ängste, zum Ausdruck. Die Einleitungen der Kapitel sind anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, da sie außerhalb der Erzählung liegen, enthalten aber gelegentlich auch kleine Nettigkeiten zum Schmunzeln und geben gegen Ende auch einen kleinen Ausblick darauf, wie es mit Justin und Jing-Wei weitergeht, etwas, was der Leser natürlich schon noch wissen will, ehe er das Buch zuklappt.
Mit seinen gut zweihundert Seiten ist das Buch schnell gelesen. Es ist eine nette Geschichte, durchaus nicht seicht, aber einfach gestrickt und von der Masse her gerade mal ein Happen für zwischendurch. Für Jugendliche ab zwölf Jahren stellt es mit Sicherheit eine interessante und spannende Lektüre dar, Erwachsene dagegen dürfte es mit seiner einspurigen Handlung und dem schlichten Aufbau nicht unbedingt reizen.
|Patmos| hat für das Buch ein ansprechendes Cover gestaltet, auch die Karte im Buchdeckel war nett gemacht, wenn auch nicht notwendig. Die Bindung des Buches ist allerdings nicht so toll; obwohl ich Bücher niemals ganz aufschlage, konnte ich die Klebepunkte der einzelnen Seiten sehen. Ob das lang hält …? Das Lektorat war dafür fehlerfrei.
_Sherryl Jordan_ lebt in Neuseeland und hat bereits eine ganze Anzahl Jugendbücher geschrieben, von denen auch einige ausgezeichnet, aber nicht alle ins Deutsche übersetzt wurden. Erschienen sind bei uns unter anderem „Tanith, die Wolfsfrau“, „Der Meister der Zitadelle“ und „Flüsternde Hände“.
http://www.patmos.de
Koontz, Dean R. – Kalt
Es gibt Worte, die rufen bestimmte Bilder hervor. Bei mir gehören dazu unter anderem auch „Verfolgungsjagd“ und „Roadmovie“. Bei „Verfolgungsjagd“ hat man schnell Bilder von aufregenden Verfolgungen in Autos oder zu Fuß vor Auten, bei welchen der eine unentwegt hinter dem anderen her ist. „Roadmovie“ erinnert andererseits an Filme wie „Easy Rider“, „Thelma and Louise“ oder „Wild at Heart“, wobei das Wort selbst tatsächlich einen Film impliziert.
Der Klappentext von Dean Koontz‘ Roman „Kalt“ wirbt damit, dass es sich bei dem Buch um „Eine gnadenlose Verfolgungsjagd und ein fantastisches Roadmovie“ handeln würde. Und tatsächlich werden die Helden des Romans gnadenlos verfolgt, es geschieht „fantastisches“ und ein gutes Stück des Buches fliehen sie über die Straße und erleben entlang der Straße ihre Abenteuer. Was fehlt, sind der Film und die Jagd. Dies mag jetzt pedantisch erscheinen, ist aber symptomatisch für die Aufmachung des Buches. Der Klappentext ist zwar teilweise falsch, gibt aber genug preis, um etwa die Hälfte des Buches zu verraten. Der deutsche Titel hat relativ wenig mit dem Buch zu tun und bezieht sich wohl als eine Art Wortspiel darauf, dass der eigentliche Bösewicht „Kalt“-blütig agiert und außerdem die Helden den Nordpol besuchen. Oder vielleicht soll er sich auch an bekannte Horrorromane mit Einworttiteln anlehnen und damit die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen lassen. Was schade ist, da der Originaltitel „By the Light of the Moon“ (Beim Licht des Mondes) wesentlich besser zum Buch passt und auch als Satz zentrale Bedeutung für die Akteure erlangt. Und warum gerade ein Insekt für das Cover-Bild gewählt wurde, vermag vermutlich nur der Designer zu sagen – besonders bei dem Titel.
Wenigstens hat man darauf verzichtet, das Buch als Horrorroman, Thriller oder Science-Fiction zu bezeichnen, denn dies wird dem Roman nicht gerecht, weil dieser sich mit dem etwas kitschigen Schluss in das Genre der Superhelden begibt.
Dabei fängt die Geschichte mit einem Schwall an gewaltigen Bildern an, die zwischen Kitsch („Der verblichene Tag war inzwischen in der Erde, im Asphalt vergraben. Dem Auge entzogen, aber spürbar, spukte sein Geist durch das nächtliche Arizona: ein heißer Geist, der träge von jedem Zoll des Bodens aufstieg …“) und Detektivbüro-Sprache („Die zeitgenössische Kultur passte Dylan O´Conner etwa so gut wie ein dreifingriger Handschuh …“) hin und her schwanken.
Nachdem man jedoch erfahren hat, dass es sich bei dem Charakter, aus dessen Perspektive der Roman begonnen wird, um einen Künstler namens Dylan O´Connor handelt, der in der Welt nur die wunderbarsten Bilder wahrnimmt, wird klar, dass diese Sprache als Stilmittel gedacht ist, um die Perspektiven der Akteure zu verdeutlichen. Denn der zweite Hauptakteur, die Comidiene Jill Jackson, sieht die Welt mit anderen Augen, und diese Sichtweise wird dem Leser auch vermittelt. Besonders interessant wird das Buch jedoch immer dann, wenn Dylans Bruder, der autistische Shepard, in das Geschehen einbezogen wird, denn Koontz hat sich große Mühe gegeben, die Probleme, die Shepard selbst mit der Welt und vor allem seine Begleiter Dylan und Jill während der Flucht mit ihm haben, herauszuarbeiten.
Immer wieder sagt er seine Mantras auf, begibt sich in eine Ecke, um die Welt auszuschließen und gibt sinnlose Dinge von sich, die aber mit der Zeit Bedeutung gewinnen. So wird auch ein guter Teil der Spannung während der Szenen, in denen es tatsächlich um den Konflikt mit den Verfolgern geht, daraus gewonnen, dass Shepard nicht angemessen auf die Situation reagieren kann und damit sich und seine Begleiter in Gefahr bringt.
Dieses Stilmittel hat aber zwischenzeitlich auch den Effekt, dass es die Handlung in die Länge zieht und man versucht ist, Teile des sich nur geringfügig ändernden Dialoges zwischen Shepard und Dylan zu überspringen. Genauso gehen die Übercharakterisierungen der Protagonisten irgendwann ein wenig auf die Nerven, da man das Gefühl bekommt, dass die Personen nur existieren, um ihre Neurosen auszuleben.
Wie vielleicht auffällt, hat sich diese Rezension bisher wenig mit dem tatsächlichen Inhalt des Romans beschäftigt. Dies liegt nicht daran, dass es dem Buch an Spannung mangelt, sondern daran, dass der Inhalt bereits überwiegend auf dem Klappentext beschrieben wird:
Ein verrückter Wissenschaftler injiziert drei Personen gegen ihren Willen ein Mittel, welches sie verändert und dazu führt, dass sie dank des Mittels besondere Fähigkeiten entwickeln und sich gezwungen sehen, anderen zu helfen. Das Mittel hatte bei vorherigen Testpersonen zu brutalen Übergriffen geführt, weswegen einige Mörder auf die neuen Probanden angesetzt werden. Diese Söldner tauchen tatsächlich einmal im Buch als echte Bedrohung auf, verschwinden jedoch die meiste Zeit hinter der Action, die die guten Taten mit sich bringen. Nicht wirklich überraschend, war die Auswahl der drei Helden nicht zufällig, da der Wissenschaftler zu zweien von ihnen eine ihnen bis dahin nicht bekannte Beziehung hatte. Und nachdem man noch ein paar Dinge erledigt hat, ist alles gut und man ist mit sich und den bisher am Körper eingetretenen Veränderungen im Reinen.
Wie bereits geschrieben, ist der Roman tatsächlich spannend und diese Zusammenfassung wird der Spannung nicht gerecht, aber die eigentliche Spannung liegt auch nicht in der Geschichte, sondern in den Akteuren, die das Buch lesenswert machen. Herauszuheben ist dabei noch die Figur des Wissenschaftlers, welcher in seiner selbstanklagenden Art tatsächlich hassenswerter ist als so mancher manische Psychopath, besonders nachdem man schließlich erfahren hat, was wirklich hinter seinen Selbstanklagen steckt. Daher kann ich den Roman durchaus als Ferienlektüre empfehlen.
|Orginaltitel: A Maze of Death
übersetzt von Yoma Cap, überarbeitet von Alexander Martin|
_Peter Singewald_
|Diese Rezension wurde mit freundlicher Genehmigung unseres Partnermagazins [X-Zine]http://www.x-zine.de veröffentlicht.|
John Wyndham – Wenn der Krake erwacht

John Wyndham – Wenn der Krake erwacht weiterlesen
Rainer Wekwerth – Das Hades-Labyrinth
Rainer Wekwerth wurde 1959 geboren und hat bereits unter einem Pseudonym mehrere Buchtitel veröffentlicht. Heute lebt der Mann in Stuttgart und hat just mit „Das Hades-Labyrinth“ sein neuestes Werk auf den Markt gebracht. Nähere Informationen zu diesem Thriller-Autor sind unserem Interview mit ihm zu entnehmen.
Handlung:
Daniel Fischer hat alles verloren. Sein Körper ist schwer gezeichnet von den schwerwiegenden Ereignissen, die gerade erst zurückliegen, seine Frau hat ihn verlassen, weil Daniel seinem ‚alten‘ Leben aufgrund der grausamen Erfahrungen nicht mehr nachgehen kann, und wegen seiner Verletzungen ist es ihm auch nicht mehr möglich, seinem Job als Gesetzeshüter nachzugehen. Doch was ist geschehen?
Hal Clement – Das Nadelöhr
1948 bekam der halbwüchsige Robert Kinnaird überraschenden Besuch. Der „Jäger“, ein außerirdischer Polizist, verfolgte einen Verbrecher aus seinem Volk. Beide mussten sie auf der Erde und nahe der kleinen Tahiti-Insel Ell notlanden. Der Jäger, ein vier Pfund leichter, giftgrüner, hochintelligenter Gallert-Klumpen, schlüpfte in Roberts Körper. Er wurde ein Freund und schützte seinen Wirt vor Krankheiten und Verletzungen. Gemeinsam verfolgte das ungleiche Duo den Verbrecher, der nach langer Jagd gestellt und ausgeschaltet werden konnte. Dafür zahlte der Jäger einen hohen Preis: Weil sein Raumschiff durch die Notlandung irreparabel beschädigt wurde, blieb er ein Gestrandeter. Hal Clement – Das Nadelöhr weiterlesen
Fried, Hel / Lancaster, Peter / Ninge, Joel E. / Först, Lukas / M., Manuel / Uffer, Matthias – Fleisch … und andere Appetitverderber
Leute, Kurzgeschichten sind einfach etwas Feines! Wenn sie von einem guten Autor ersponnen und verbrochen wurden, schaffen sie es in aller Kürze, den Leser zu fesseln und ihn in eine Parallelwelt zu entführen, in die man mal so zwischendurch entfliehen kann. In der Pause auf der Arbeit, beim Thronen auf der Schüssel oder zwischen den einzelnen Sexetappen. Solche Bücher zehre ich, sofern sie entsprechend gut geschrieben wurden, gern unter Volldampf in mich hinein, so dass es auch kein Wunder war, dass ich „Fleisch … und andere Appetitverderber“, eine Shortstory-Compilation des |Eldur|-Verlags, in null Komma nix verdaut hatte.
Siebzehn Geschichten von zehn verschiedenen Autoren, voller Leichenflederei, Sex, Gewalt, Tod, Blut und viel Gedärm; hier wird einem die fette Schlachtplatte |in personae| serviert. Herausragend im eigentlichen Sinne ist bei dieser Sammlung keine Story so recht, da sie alle auf einem ähnlich hohen Niveau kompetent verfasst wurden. Lediglich im Spannungsaufbau und letztendlich im Ekelfaktor stechen einige bestialisch hervor. So zum Beispiel „Der Messi“ von Salem Stoke, der von einem etwas unreinlichen Sammler allen Schrotts erzählt, der in seiner Wohnung aber auch Gütertrennung betreibt. Auch wenn ich dies im Falle von eigentlich zusammengehörigen Gliedmaßen reichlich merkwürdig finde.
Ein weiteres Highlight absoluten Ekels stellt „Das Bad“ dar, in dem der Protagonist für 30.000 Euro in einer Wanne umherschwimmen muss. Genauer gesagt, handelt es sich bei dieser Wanne jedoch um eine Kläranlage, was die Sache schon etwas erschwert und es dem Leser auch wirklich schwierig macht, seine Magensäfte bei sich zu behalten. ‚Widerlich und pervers‘ ist die treffende Umschreibung, doch ’spaßig und köstlich‘ passt in meinen Augen ebenso gut dazu.
Ein Sahnehäubchen des Sex-Gore stellt besonders die Titelgeschichte dar, in der man in der nahen Zukunft menschliches Fleisch für die oralen Bedürfnisse kaufen kann. Ein leicht verschrobenes Pärchen stellt aber noch bizarrere Dinge mit den Klumpen an. Als ob fressen nicht schon reichen würde …
Ich will und muss, denke ich, nicht jede Geschichte im Einzelnen auflisten, da sie sich in ihren Stilistiken sehr homogen zusammenfügen und sich im Schreib- und Lesefluss nicht großartig brechen. Mal werden Psychogramme kranker Seelen gezeichnet („Amputation“, „Ein Schmerz lang glücklich“, „Aeternitas“) und mal gehen die Storys deutlich ins Phantastische („Heinrichs Abendmahl“, „The Love Craft“). All diesen Geschichten ist aber definitiv der extreme Gorefaktor gemein, der manch einem Warmduscher die Kinnlade entgleisen lassen sollte.
Ich für meinen Teil hatte einhundertneunzig Seiten, die sich lesen wie ein paar geile Comics und runtergehen wie reines Olivenöl, puren Spaß.
Das ist nun einmal der Vorteil bei Kurzgeschichten: Die Autoren müssen sich nicht erst großartig Gedanken über einen komplexen Storyaufbau und ausführliche Charakterzeichnungen machen. Compuffter an und uff die Mutti! Genau so liest sich das Material auch.
Also wünsche ich viel Spaß und einen ordentlich fetten Happen verdorbenen Fleisches. Lasst es euch gut munden …
Hal Clement – Die Nadelsuche
Durch die halbe Galaxis ist der außerirdische Jäger seinem kriminellen Artgenossen gefolgt. Als er ihn endlich stellt, wird er ausgetrickst. Beide Raumschiffe müssen auf einem kleinen blauen Planeten notlanden, der zu zwei Dritteln aus Wasser besteht. Die Fremden überleben unbeschadet, denn sie sind Meister der Anpassung: vier Pfund intelligente, gallegrüne Gallerte. Doch so sieht man sie selten, denn die Angehörigen dieser seltsamen Spezies sind Symbionten. Sie suchen sich Wirtskörper, denen sie die Gastfreundschaft mit der Abwehr fast sämtlicher Krankheitserreger und einer fast unheimlichen Zunahme der Heilungskraft danken. Außerdem teilen sie ihr auf vielen Welten erworbenes Wissen mit dem Wirt, denn dies ist ihr oberstes Gebot: „Tue nichts, was deinem Gastgeber Schaden zufügen könnte!“ Hal Clement – Die Nadelsuche weiterlesen
Klein, Edward – Geheimnis der Kennedys, Das
„Dieses Buch ist eine Kriminalgeschichte. Es untersucht eines der großen Mysterien unserer Zeit – den Kennedy-Fluch. Es beschäftigt sich mit den Mustern, die dem Fluch zugrunde liegen und ihn bestimmen, und untersucht die zahlreichen Einflüsse – historische, psychologische und genetische -, die den Charakter der Kennedys geformt und zu ihrem selbstzerstörerischen Verhalten geführt haben.“ (S. 37)
Ob Verfasser Klein diesem hehren Ziel genügen kann, dazu äußert sich Ihr Rezensent weiter unten. An dieser Stelle sei vermerkt, dass er es in vier Buchteilen am Beispiel von insgesamt sieben Kennedys versucht. Um die Leser sogleich an den Kanthaken zu nehmen, beginnt Klein das Pferd am Schwanz aufzuzäumen und erzählt die dramatische, noch recht frische Geschichte vom tragischen Ende des John Fitzgerald Kennedy jr., der im Sommer 1999 samt Glamourgattin Carolyn mit seinem Kleinflugzeug ins Meer stürzte.
Eigentlich ist es nur die halbe Geschichte, denn Klein greift sie im Finale seines Buches, wenn das Risiko der Leserflucht gering geworden ist, noch einmal auf. Diese Zweiteilung soll gewährleisten, dass sich sein Publikum pflichttreu durch jene Kapitel arbeitet, in denen von weniger bekannten Kennedys die Rede ist. Klug nachgedacht, denn die Tatsache, dass Patrick Kennedy (1823-1858) der angebliche Auslöser des Familienfluches ist, lässt ihn nicht zwangsläufig interessanter wirken.
Wobei besagter „Fluch“ nach Ansicht Kleins eine Mischung aus Minderwertigkeitsgefühlen – entstanden durch die Erfahrungen einer an Entbehrungen und Zurückweisungen reichen, aber ansonsten bitterarmen irischen Auswandererfamilie -, Narzissmus und emotionaler Kälte ist, die in dem Slogan „Siegen um jeden Preis“ kulminierte. Dies ist nach Klein die Quelle des Musters, das noch heute so vielen Kennedys Kopf & Kragen kostet.
Auch die Ära des Politik-Hallodris John Francis „Honey Fitz“ Fitzgerald (1863-1950) dient Klein vor allem als Beleg dafür, dass die Kennedys, wie sie die Medien und die Öffentlichkeit zu schätzen wissen, sowohl väterlicher- als auch mütterlicherseits verflucht sind. Weiter geht es mit Joseph Patrick Kennedy (1888-1969), dem krankhaft ehrgeizigen, eiskalten Patriarchen, Alkoholschmuggler und Politgangster, den man – in Tateinheit mit seiner frömmelnden Gattin Rose (1890-1995) – objektiv wohl als eigentlichen Familienfluch bezeichnen müsste. Weniger bekannt ist die Geschichte von Kathleen „Kick“ Kennedy (1920-1948), die es bis zur englischen Marquise schaffte und einem Flugzeugabsturz zum Opfer fiel.
Auf vertrautem Terrain bewegt sich Klein im Kapitel „John F. Kennedy“. Im Blickpunkt seiner „Kriminalgeschichte“ stehen weniger die politische Leistung des US-Präsidenten (1917-1963), sondern sein ausschweifendes Sexleben, seine vertuschten Gesundheitsprobleme sowie sein historisches Ende. Am Beispiel des William Kennedy Smith (geb. 1960) zelebriert der Verfasser beispielhaft seine „Götterdämmerung“ des Kennedy-Clans, bevor er noch einmal zu J.-F. K. jr. zurückkehrt. Für jene, die noch immer nicht begriffen haben, folgt ein Epilog: „Der Fall des Hauses Kennedy“.
Was ist nun davon zu halten? Die Kennedys führen ein aktives Leben unter den Augen einer allzeit interessierten Öffentlichkeit. Außerdem vermehren sie sich wie die Karnickel. Ob es da wohl einen Zusammenhang mit den zahlreichen Schicksalsschlägen gibt, welche diese Familie in anderthalb Jahrhunderten trafen? Oder anders gefragt: Wenn man die Opfer ebenso kopfstarker, aber eben nicht berühmter Familien addiert, wäre das Ergebnis nicht ähnlich erschreckend? Natürlich fehlt hier der Kennedy-Glamour; die Normalsterblichen des 19. und 20. Jahrhundert starben unbemerkt und nur von den Ihren betrauert. Gibt ein Kennedy den Löffel ab, steht dagegen die Presse Spalier – so ist das schon seit vielen Jahrzehnten.
Nicht nur die Kennedys selbst, sondern viele von denen, welche sie aus unerfindlichen Gründen bewundern und auch an ihren privaten Geschicken Anteil nehmen, scheinen der Auffassung zu sein, dass nur böse Mächte aus dem Jenseits die göttergleichen Titanen dieses Clans fällen können. Ein „Fluch“ muss her, der die Story gleich wesentlich interessanter macht. Notfalls konstruiert man ihn halt selbst: „Keine zehn Jahre nach der Emigration aus Irland stirbt Patrick Kennedy … am 22. November [1858] an der Schwindsucht. Die Todesursache ist im neunzehnten Jahrhundert nicht ungewöhnlich, das Datum aber scheint manchen bedeutsam: Auf den Tag genau 105 Jahre vor dem Attentat auf John F. Kennedy.“ – S. 39. Klar, dass mit „manchen“ vor allem Edward Klein gemeint ist …
Womit wir die Urheber dieser Mär schon identifiziert haben: Die Kennedys sind und waren Medienmenschen. Über sie lassen sich Schlagzeilen füllen, hohe Auflagen und Zuschauerzahlen erzielen. Gleichzeitig scheinen menschliche Unzulänglichkeiten wie Wahlbetrug, Ehebruch oder Alkoholismus viel dramatischer zu sein, wenn sie jene zelebrieren, die doch angeblich unsere Vorbilder sein sollen. Bloß: Wer hat sie eigentlich dazu ernannt?
Auch Edward Klein scheint nicht fassen zu können, wieso sich die Kennedys so benehmen, wie sie sich benehmen. Vielleicht hat er allzu lange die Gnade genossen, bei Jacqueline Kennedy Onassis selig auf der Sofakante sitzen und den Erzählungen einer alternden, einsamen Frau lauschen zu dürfen. Die nötige Distanz zum Objekt seiner „historischen Forschungen“ lässt er jedenfalls jederzeit vermissen. Das mag wundern angesichts der „Skandale“, die er in diesem Buch gleich in Serie präsentiert. Der Blick ins Literaturverzeichnis belegt indes, dass Klein quasi ausschließlich auf längst publiziertes Material zurückgegriffen hat: Seine Zeter-Chronik ist zusammengeschrieben aus dem, was andere zu Tage brachten. Auf seinem angeblichen Schatz in Jahrzehnten angehäuften Insiderwissens bleibt Klein jedenfalls weiterhin eifersüchtig hocken. Ausgesprochen selten zitiert er aus eigenen Quellen (dies zudem – auf Wunsch des jeweiligen Informanten – stets anonym …)
Das rächt sich, wenn das Wissen aus erster und zweiter Hand zu versiegen beginnt. Für Klein ist spätestens das 19. Jahrhundert eine Informationswüste. Leider rührten sich die ersten Kennedys im Irland der 1850er Jahre. Aus dem Nachwort geht auch hervor, dass Klein vor Ort gewesen ist. Was hat er dort gemacht? In den Archiven hat er sich wohl nicht lange aufgehalten. Stattdessen zieht er einige allgemeine Geschichtsbücher zu Rate. Ein Bericht über den Emigrantenhafen Liverpool wird von Klein kurzerhand als historische Kulisse umgearbeitet, in die er „seine“ Kennedys setzt und sie wie in einem (schlechten) Historienroman reden und denken lässt. Dass keinerlei gesicherten Belege dies stützen, stört ihn überhaupt nicht.
Halbwissen, Insiderklatsch, für den eigenen Gebrauch aus dem historischen Zusammenhang gepickte Fakten bilden das Fundament, auf dem Klein sein faktenwackliges Kennedy-Monument errichtet. Viel Zeit – z. B. für echte Recherchen – darf er sich ohnehin nicht lassen, denn der Buchmarkt drängt ihn schon wieder (s. u.) zur nächsten Skandalchronik. Für den Leser muss deshalb das Fazit lauten, Zeit & Geld zu sparen. „Das Geheimnis der Kennedys“ ist als historisches Sachbuch indiskutabel und als Gossentrash einfach nicht unterhaltsam genug.
Aber Amerika ist halt ein seltsames Land … Edward Klein gilt dort keineswegs als Klatschmaulwurf, sondern genießt den Ruf eines seriösen Autors und Herausgebers. Tatsächlich liest sich sein journalistischer Lebenslauf eindrucksvoll. U. a. war Klein von 1977 bis 1988 Chefherausgeber des ganz und gar nicht unbekannten „New York Times Magazine“. In dieser Zeit gewann es den ersten Pulitzer-Preis in seiner Geschichte. 1989 ging Klein zu „Vanity Fair“. Hier wurde er bekannt für seine Artikel über Jacqueline Kennedy Onassis und Onassis-Enkelin Athina Onassis Roussel. Darüber hinaus schrieb Klein für viele andere Zeitschriften und Zeitungen, wobei er sich auf Interviews mit Persönlichkeiten der politischen Zeitgeschichte spezialisierte.
Der Buchautor Klein nutzt sein fein gesponnenes Netz prominenter Kontakte als Verfasser biografieähnlicher Sachbücher, die sich meist diverser Tragödien und Skandale als Aufhänger bedienen. Jackie Kennedy Onassis wurde als ertragreiche Gossip-Mine gleich mehrfach ausgebeutet, so in „Just Jackie: Her Private Years“, „All Too Human: The Love Story of Jack and Jackie Kennedy“ (dt. „Jack & Jackie. Das Kennedy-Traumpaar im Zentrum der Macht“) und – Peinlichkeit und Geschäftssinn kennen keine Grenzen – „Farewell Jackie. A Portrait of Her Final Days“. Nachdem Jackie nunmehr auf Wolke Sieben Hof hält, hat Klein in „The Kennedy Curse“ die letzten Notizbucheinträge verbraten und sich anschließend neuen saftigen Wiesen zugewandt. 2005 verfasste er nach bekanntem Muster „The Truth About Hillary“, dessen Vorverkauf durch die vorab verkündete „Topinfo“ angekurbelt wurde, Ex-Präsident Bill Clinton habe seine Tochter Chelsea durch Vergewaltigung der Gattin gezeugt …
Philip K. Dick – Irrgarten des Todes

Doch kaum auf dem fremden Planeten angekommen, stellen die vermeintlichen Siedler fest, dass sie hier festsitzen, keiner ein rückflugtaugliches Raumfahrzeug mitgebracht hat.
Elsaesser, Thomas – Metropolis. Der Filmklassiker von Fritz Lang
Wie kann es eigentlich angehen, dass ein Film als Klassiker gilt, den kaum jemand wirklich gesehen hat …? Ein Dreivierteljahrhundert nach seiner Entstehung ist es gar nicht so einfach, „Metropolis“ neu oder wieder zu entdecken. Manchmal wird er von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern im Dunkel der Nacht gezeigt, aber eigentlich müsste man ihn natürlich auf der großen Leinwand so sehen, wie ihn Fritz Lang einst konzipiert hat.
Bei dieser Gelegenheit zeigt sich, dass „Metropolis“ auch im 21. Jahrhundert die Gemüter zu erregen vermag. Viel bewundert ob seiner monumentalen Bildsprache, die noch heute staunen macht, aber vielleicht noch mehr kritisiert und geschmäht wegen der naiven Geschichte, die da mit stupendem Aufwand erzählt wird, ist es an der Zeit für eine aktuelle und vor allem sachliche Bestandsaufnahme: Was ist „Metropolis“ wirklich bzw. was haben sich seine Schöpfer vor 78 Jahren dabei gedacht, ein bei objektiver Betrachtung wahnwitziges Projekt zu verwirklichen?
Der Film- und Fernsehhistoriker Thomas Elsaesser, der an der Universität Amsterdam lehrt, hat sich diesen Fragen im Auftrag des renommierten „British Film Institute“ angenommen. Auf gerade 135 Seiten ist das keine einfache Aufgabe, denn über „Metropolis“ haben sich schon viele und manchmal sogar kluge Köpfe ausführlich dieselben zerbrochen. Im Gewirr dieser wild bewegten Rezeptionsgeschichte den roten Faden zu finden, ist eine respektable Leistung. Elsaesser ist es gelungen – und noch besser: Er schafft es, das schwierige Thema mit spielerischer Leichtigkeit in den Griff zu bekommen und seinem Publikum nahe zu bringen.
Dabei geht Elsaesser beileibe nicht den einfachen Weg, der in der Filmbuch-Welt leider in der Regel so aussieht: Man erzähle ausführlich die Story nach, ergänze dies durch die Nachbetung einiger Fakten aus der Pressemappe und peppe das Ganze mit (meistens reichlich apokryphen) Anekdoten auf, die im Falle von „Metropolis“ ungeprüft seit über siebzig Jahren nachgeplappert werden. Dazu kommen viele, viele Bilder – fertig! Elsaesser geht dagegen inhaltlich in die Tiefe, und er setzt mit einer ungewöhnlichen These an: „Metropolis“ ist in seiner Deutung kein geplantes Monument der frühen Filmgeschichte, keine ehrgeizige Prophezeiung einer möglichen Zukunft, auch kein (missglücktes) politisches Manifest, sondern ein kühl kalkulierter Blockbuster à la „Star Wars – Episode 1“. Die Belege dafür sind bestechend: In den 20er Jahren befand sich die deutsche Filmindustrie, die einst führend in der Welt war, in einer tiefen Krise. Hollywood hatte die Zelluloid-Krone an sich gerissen. „Metropolis“ sollte als Kraftakt beweisen, dass Deutschland nicht nur mithalten, sondern die Konkurrenz jederzeit in die Schranken verweisen konnte. Dies war der Grund, wieso die UFA Fritz Lang praktisch unbegrenzte Mittel gewährte und ihn zwei Jahre (!) ungestört an „Metropolis“ arbeiten ließ.
Auf der anderen Seite erklärt diese Zielrichtung auch die oft beklagte formale wie inhaltliche Indifferenz des Films. Ungehemmt und offenen Auges wilderten Regisseur Fritz Lang, Drehbuchautorin Thea von Harbou oder Ausstatter Ernst Ketelhut in den Höhen der hehren Kunst wie in den Niederungen des alltäglichen Kitsches. Elsaesser ist es gelungen, den Ursprung vieler „Metropolis“-Bilder, die sich längst in Pop-Ikonen verwandelt haben – der weibliche Roboter, der Turm zu Babel, das Rotwang-Labor usw. -, zu rekonstruieren. Die Betroffenheit über die scheinbare Banalität der meist recht seichten Quellen, aus denen sich „Metropolis“ speist, weicht der Bewunderung, wenn man sich erst einmal vor Augen geführt hat, dass „Metropolis“ in erster Linie ein Spektakel und „nur“ ein Film ist und nie als etwas Anderes, gar „Großartiges“ geplant war.
Unter diesem Aspekt relativiert sich auch die Mär vom künstlerischen und geschäftlichen Scheitern des ehrgeizigen Projektes. Fritz Lang und besonders Thea von Harbou, die stets als die „Hauptschuldigen“ gescholten werden für das schlechte Abschneiden an den Kinokassen, hatten einfach Pech: „Metropolis“ entstand für einen Konzern am Rande des Konkurses, in einer Zeit der Inflation und der politischen wie wirtschaftlichen Unruhen – und kam auf den Markt, als sich der Tonfilm massiv ankündigte.
Was dagegen von der Kritik niemals richtig gewürdigt wurde, ist der enorme Erfolg des Films auf anderem Gebiet: Einen Kultfilm erkennt man daran, dass er moderne Mythen entstehen lässt. „Metropolis“ ist in dieser Hinsicht ein einziges Füllhorn; ein Ideen- und Bildersteinbruch, aus dem sich die Nachgeborenen gern und großzügig bedienten. Elsaesser kann nur wenige, aber beeindruckende Beispiele präsentieren – bereits die Nennung von Filmen wie „Frankenstein“ über „Blade Runner“ bis zur „Batman“-Serie (der „richtige“ der Teile 1, 2 und 5, nicht der Schumachersche Clown im Cape), „Das Fünfte Element“ oder „Sin City“ gibt ihm uneingeschränkt Recht.
Wenn man Elsaesser bereitwillig schon bis zu diesem Punkt gefolgt ist, akzeptiert man auch sein zunächst irritierendes Plädoyer für Giorgio Moroders bonbonbunte, massiv umgeschnittene und mit der Popmusik der 80er unterlegte „Metropolis“-Fassung von 1983. Das Protestgeheul der etablierten Filmkritik ließ damals die Kinowände weltweit erzittern, doch Elsaesser nimmt Moroder in Schutz und weist nach, dass „Metropolis“ bereits seit seiner Uraufführung immer wieder geschnitten und neu montiert wurde – womöglich gibt es gar keine authentische Urfassung! Die eigentliche Kraft dieses Films, so Elsaesser, liegt in der erstaunlichen Tatsache, dass noch jede Version ihr Publikum gefunden hat: In einem Film, der stets Stückwerk war, nimmt der Zuschauer nur jene Elemente wahr, die seine Phantasie beflügeln.
Doch ist Thomas Elsaesser denn nun im Besitz der einzigen Wahrheit? Er stellt seine Thesen zur Diskussion, aber das heißt keineswegs, dass seine überzeugenden Thesen in zehn Jahren noch gültig sein werden. Elsaessers „Metropolis“-Buch fesselt auch als Exkurs über die Filmkritik im Wandel der Zeit. Jede Generation, jede Kultur hat den Film so interpretiert, wie er in ihr Weltbild passte. „Metropolis“ wurde als kommunistische Agitation wie als faschistische Propaganda, als Warnung vor den Nazis wie als früher Gruß an Hitler & Co, als Utopie wie als Dystopie interpretiert oder besser: instrumentalisiert. Heute ist es möglich offen anzusprechen, dass „Metropolis“ in erster Linie Unterhaltung war und ist, ohne dafür von der verkopften Cineastenschar früherer Jahre gesteinigt zu werden. (Nicht, dass es sie nicht mehr gäbe oder sie es nicht gern täte – sie ist nur einfach nicht mehr in der Überzahl und musste heraus aus ihrem Elfenbeinturm …) Unter dieser Prämisse ist übrigens ausgerechnet der arme H. G. Wells das beste Beispiel für solche Kurzsichtigkeit: Der hoch und mit Recht gerühmte Autor unsterblicher Klassiker wie [„Die Zeitmaschine“ 1414 oder „Der Krieg der Welten“ listete penibel die „Fehler“ und Anachronismen auf, die ihm in „Metropolis“ als Geschichte aus der Zukunft aufgefallen waren, ohne jemals zu begreifen, dass diese überhaupt nicht beabsichtigt war bzw. eine Story im Film völlig anderen Gesetzen zu gehorchen hat als ein Roman.
„Metropolis“ gehört eindeutig zu den Highlights der Reihe „Filmbibliothek“ des |Europa|-Verlags: brandaktuell, fern jedes pseudo-philosophischen Schwurbels kundig und lesbar geschrieben, vorzüglich übersetzt und erfreulich preisgünstig – ein erstaunlicher, neugierig machender (Rück)Blick auf einen halb vergessenen, doch stets präsenten, oft missverstandenen Klassiker der Filmgeschichte.
Eugenides, Jeffrey – Air Mail
Spätestens seit Jeffrey Eugenides 2003 für seinen erstklassigen Roman [„Middlesex“ 916 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, ist er einer der großen Stars der zeitgenössischen amerikanischen Literatur. Ein großartiges Erzähltalent, das fesselnd seine Geschichten spinnt und Figuren aus dem Hut zaubert, die erfrischend normal und alltäglich sind.
In Romanform hat Eugenides sein Können bereits zweimal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Zum einen mit seinem Romandebüt „Die Selbstmord-Schwestern“, der Geschichte des Selbstmords der fünf Schwestern der amerikanischen Vorstadtfamilie Lisbon, zum anderen durch die Familiengeschichte des Hermaphroditen Cal/Callie in „Middlesex“. Beide Romane drehen sich um ähnliche Dinge. Normalitäten und Absurditäten in den weißen Vorstädten der amerikanischen Mittelschicht und gleichzeitig um die Zeit des Erwachsenwerdens, die schwierige Phase der Pubertät, des Erwachens der Sexualität, mit all den Irritationen und Kuriositäten, die dazugehören. Beide Romane sind Familiengeschichten der etwas anderen Art.
„Air Mail“ ist nun ein Werk, das sich von den beiden bekannten Veröffentlichungen des Autor einerseits fundamental unterscheidet, andererseits aber durchaus das Bild vervollständigt. „Air Mail“ vereint drei Erzählungen, deren zeitlicher Ursprung genau zwischen den beiden genannten Romanen liegt, zwei stammen aus dem Jahr 1997, die dritte wurde 1999 verfasst.
Nun ist das immer so eine Sache, von einem überaus erfolgreichen und vielgelobten Autor zu einem späteren Zeitpunkt frühere Werk auszugraben und zu veröffentlichen. Im Fall von Jonathan Franzen fand ich mit [„Die 27ste Stadt“ 1207 das Ergebnis eher weniger befriedigend. Oft werden die frühen Werke der heute so großartigen Autoren den Erwartungen nicht ganz gerecht. Doch bei „Air Mail“ ist diese Gefahr schon aufgrund des gänzlich anderen Erzählformats geringer. Als „Kurzstrecken-Erzähler“ ist Eugenides schließlich dem deutschen Leser bislang noch weitestgehend unbekannt.
_Air Mail (1997)_
Die erste Erzählung dreht sich um Mitchell, der gerade auf einer kleinen Insel im Golf von Siam auf einer Strohmatte in einer kleinen Hütte gegen die Ruhr ankämpft. Inspiriert durch die fernöstliche Mentalität, durch den Glauben an die Kraft des Geistes, versucht Mitchell die Ruhr durch eisernes Fasten kleinzukriegen. Fernab von zu Hause, in der Abgeschiedenheit seiner Hütte, bringt Mitchell all seine Gedanken über sich und den Lauf der Welt zu Papier – auf Luftpostpapier, in Form von Briefen, die er seinen Eltern schicken will, in der Hoffnung, dass sie ihn besser verstehen. Während Mitchell seinen Durchfall „wegfastet“, stapeln sich Briefe, die Mitchell nie abschicken wird.
„Air Mail“ ist eine recht sonderbare, aber gleichsam faszinierende Erzählung. Ein exotischer Schauplatz, an dem der Protagonist Mitchell nach einem Inhalt für sein Leben sucht. Der Kontakt zu den Eltern beschränkt sich auf ein Minimum. Sie sind enttäuscht von ihm, dass er die eigentlich geplante Europareise zu einer ausgedehnten Asienreise erweitert hat, mittlerweile seit einem halben Jahr fort ist und ihnen keinerlei Hoffnung auf eine baldige Rückkehr macht. Karriere, Studium und Familie stehen hinten an, solange Mitchell ohnehin nicht weiß, was er einmal machen will.
Fernab der Zivilisation beginnt Mitchell sich selbst zu erforschen, nach einem Sinn zu suchen. Die Ruhr sieht er da fast als eine Art Weg zur Erkenntnis. Er beginnt, sich von der Welt abzukapseln, während er gleichzeitig in dem Glauben ist, er würde sich ihr öffnen, sie endlich verstehen. Innere Erkenntnis und äußere Kommunikation stellen dabei gegenläufige Entwicklungen dar. Verfasste Briefe werden nicht mehr abgeschickt, sein Kumpel Larry versteht nicht recht, warum Mitchell nicht endlich Medikamente nimmt, statt weiter zu fasten, und als Mitchell nach vielen Tagen der Abgeschiedenheit in die Gemeinschaft am Strand zurückkehrt, hat er sich längst meilenweit von ihr entfernt.
Besonders das Ende der Geschichte ist merkwürdig und man steht als Leser etwas ratlos da. Doch irgendwie bleibt auch der Eindruck zurück, dass das Ende gar nicht so sehr das Entscheidende ist. Kern der Erzählung ist vielmehr der Gegensatz zwischen Innen- und Außenleben des Protagonisten.
_Die Bratenspritze (1999)_
„Die Bratenspritze“ ist eine Erzählung, die eine gänzlich andere Richtung einschlägt. Weniger nachdenklich stimmend, weniger sonderbar und weniger verkopft als „Air Mail“. Tomasina ist vierzig, hat alles erreicht, was man sich wünschen kann und einen Job als Produzentin der CBS Evening News, auf den andere nur neidisch sein können. Tomasina ist Single, hatte viele Liebschaften mit nicht wenigen Pannen und daraus resultierend immerhin auch schon eine Handvoll Abtreibungen. Doch mit vierzig beginnt allmählich die biologische Uhr zu ticken, auch für Tomasina. Sie will ein Kind, aber möglichst ohne Mann. Samenspende heißt das Zauberwort, und so lädt sie zu einer Art Befruchtungsparty, inklusive Samenspende, am Tag ihres mittels Basalthermometer ermittelten Eisprungs.
Rein erzählerisch spielt „Die Bratenspritze“ schon in der Liga, in der etwas später auch „Middlesex“ spielt. Bildhafte Vergleiche, die den Leser schmunzeln lassen, und lebhaft gezeichnete Figuren. „Die Bratenspritze“ ist letztendlich eine satirische Momentaufnahme à la „Sex and the City“. Eine Party zwecks Befruchtung der Gastgeberin, das ist für sich schon schräg genug, aber Eugenides lässt diese Party durchaus ernsthaft organisiert erscheinen – so wie man sich eine Party in der feinen New Yorker Gesellschaft der Besserverdienenden halt vorstellt, mit passendem Nippes und feinstem Champagner.
Der eigentliche Protagonist stolpert erst im Verlauf der Erzählung in die Geschichte, ganz unvermittelt und unerwartet platzt er mit einem |“An diesem Punkt sollte ich mich vielleicht vorstellen. Ich heiße Wally Mars.“| in das Geschehen. Wally ist die heimliche Hauptfigur. Ein abgelegter Liebhaber von Tomasina, dem die Rolle des unauffälligen Beobachters zufällt. Mit einem feinen Blick für das Absurde der Situation erzählt Wally die Geschichte, in der er selbst später noch eine maßgebliche Rolle spielen wird.
Eugenides zeigt sich hier von seiner unterhaltsamsten und ironischsten Seite. Während die anderen beiden Erzählungen vielfältigere und weniger leicht zu entschlüsselnde Emotionen transportieren, ist „Die Bratenspritze“ recht einfach gestrickte Unterhaltung, mit einem Blick für die teilweise absurden Züge der modernen Gesellschaft.
_Timesharing (1997)_
In der dritten Erzählung geht es mitten hinein in den tristen amerikanischen Alltag. Eine Vater-Sohn-Geschichte, die in Florida angesiedelt ist. Der Ich-Erzähler besucht seine Eltern, die in Florida gerade ein heruntergekommenes Motel in eine Goldgrube umzuwandeln versuchen. Timesharing heißt das Zauberwort. Die Zimmer werden mit Kochnischen ausgestattet und sollen möglichst längerfristig an zahlungskräftige Gäste vermietet werden.
„Timesharing“ ist einfach eine Momentaufnahme. Anfang und Ende bleiben ein wenig diffus. Eine Pointe, auf die alles hinausläuft, oder einen Höhepunkt gibt es in dem Sinne nicht. Es ist lediglich eine Zustandsbeschreibung des Lebens der Protagonisten und ihres Verhältnisses zueinander. Der Zustand des alten Motels geht dabei mehr oder weniger konform mit dem Zustand des Vaters, der mit brüchiger Gesundheit und stetig schwindender Kraft versucht, sein Lebenswerk zu vollenden. Der Sohn wirkt dabei nicht weniger müde, als es die Eltern sind. Unmotiviert verbringt er seine Zeit als Beobachter auf der Baustelle der Eltern, zieht abends durch die Kneipen und sieht sich nicht einmal dazu in der Lage, ein neues Paar Schuhe zu kaufen.
„Timesharing“ lässt den Leser mit einem merkwürdigen Gefühl zurück. Die Geschichte wirkt irgendwie melancholisch und traurig und die Figuren in all ihrer Müdigkeit und Zerbrechlichkeit erschreckend menschlich. Dadurch, dass die Geschichte keinen klar definierten Handlungsrahmen aufweist, bleibt sie einerseits etwas distanziert und befremdlich, trifft einen andererseits aber auch ins Mark, weil sie authentisch und lebensecht wirkt.
Ergänzt werden die drei Erzählungen durch ein Nachwort des ARD-Literaturkritikers Dennis Scheck. Es wirkt teilweise etwas hochtrabend, wie Scheck sich von Fremdwort zu Fremdwort hangelt, unterstreicht inhaltlich aber die Bedeutung, die Eugenides in der modernen Literatur hat. Möglich auch, dass das Nachwort noch ein wenig als Füllwerk dienen soll, um das Büchlein auf immerhin knappe 120 Seiten zu bringen. In meinen Augen wäre es nicht unbedingt nötig gewesen.
Die drei Erzählungen in „Air Mail“ sind Lektüre für knapp etwas mehr als eine Stunde, dennoch fordern sie eine gewisse darüber hinausgehende Aufmerksamkeit. Ein wenig bedauerlich ist es schon, einen Eugenides so schnell aus der Hand legen zu müssen, und so bleibt ein gewisses Gefühl der Unzufriedenheit zurück. Aber die deutet weniger auf einen qualitativen Mangel hin, sondern mehr darauf, dass man als Leser einfach schon verwöhnt ist, wenn man vorher „Middlesex“ gelesen hat. Eugenides bleibt auch nach der Veröffentlichung von „Air Mail“ ein großartiges Erzähltalent, das man im Auge behalten sollte.
H. G. Wells – Die Zeitmaschine

H. G. Wells – Die Zeitmaschine weiterlesen
Sträter, Torsten – Postkarten aus der Dunkelheit (Jacks Gutenachtgeschichten 2)
„Postkarten aus der Dunkelheit“ ist Teil zwei der Kurzgeschichtensammlung aus der Feder Torsten Sträters, dessen erster Teil [„Hämoglobin“ 1416 im Jahre 2004 sensationelle Kritiken einheimsen konnte. Nun, was soll ich sagen? Teil eins fand ich schon sehr gelungen, aber stellenweise zu wenig im Bereich der Phantastik angesiedelt. Als hätte mich Herr Sträter in meinem Klagen erhört, erhöht er sogleich den Phantastikfaktor und hämmert einem zwölf ultraextreme Prosamonster vor die Birne, die in ihrer schreiberischen Bildgewalt in Deutschland ihresgleichen suchen. Man nehme als Beispiel die Geschichte ‚Heiliger Krieg: Einer muss es ja machen‘, bei der der Vatikan sich mit Hilfe freiwilliger, heiliger Krieger zum großen Schlagabtausch mit dem Bösen aufmacht. So schlicht sich dieses Grundgerüst auch anhören mag, so deftig heftig explodieren die Worte im Leserkopf. Man kann fast nicht anders und verschluckt Geschichte für Geschichte, in meinem Fall in nur knapp drei Stunden.
Wieder einmal balanciert Sträter seine Storys gut aus, hängt seicht gifttriefende, beißend ironische Geschichten und pure Splatterorgien hintereinander und bekommt so eine exzellent ausgewogene Mischung aus Grusel und purem Horror hin, die von der ersten Seite an fesseln kann. Ob da jetzt Geisterbahnwärter ihre Aufgabe etwas zu genau nehmen oder Luzifer höchstpersönlich in den Berliner Bunkern von zwei ahnungslosen Polizisten erweckt wird, ein Geist in einer Achterbahn verzweifelt darauf wartet, dass sich jemand das Genick bricht, damit ihm seine Seele fortan Gesellschaft leisten kann oder der klassische Serienmörder in ‚Der Kasper will kein Snickers‘ seine Huldigung erfährt – Sträter erweist sich als wahrer Künstler auf der Klaviatur des Grauens. Dabei fliegen einem die Knochenfetzen und Gewebestreifen recht blutig aus den Seiten entgegen, wenn Herr Sträter mit seinem Schreibstil richtig ausholt. Teilweise geht das schon ziemlich weit über meine Definition von Ekelgrenze hinaus, und die liegt bei mir weiß Gott nicht gerade niedrig.
Wer mit dem extrem bildgewaltigen Stil von Torsten Sträter klarkommt und auch mit bärbeißigem und pechschwarzem Humor leben kann, der sollte „Postkarten aus der Dunkelheit“ auf jeden Fall klemmen. Im Vergleich zum Erstling „Hämoglobin“ ist Band zwei eine weitere, einhundertprozentige Steigerung und ich wage es jetzt einmal ganz forsch, Torsten Sträter als den neuen deutschen |king of horror| zu bezeichnen. Für alle Horrorfans ist definitives Zugreifen angesagt.
Luciano Mecacci – Der Fall Marilyn Monroe und andere Desaster der Psychoanalyse

Luciano Mecacci – Der Fall Marilyn Monroe und andere Desaster der Psychoanalyse weiterlesen