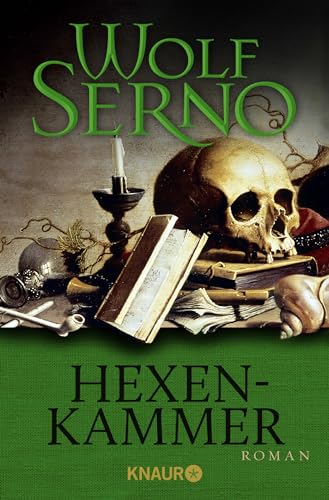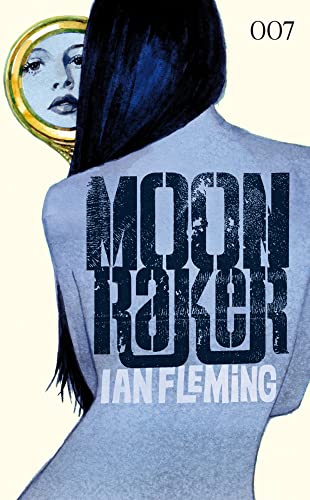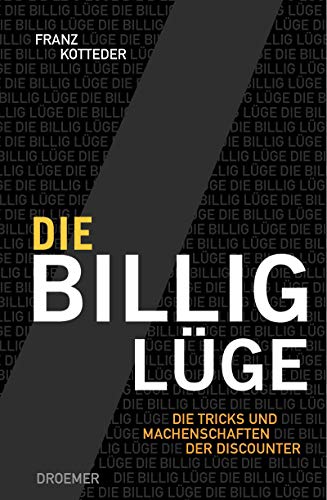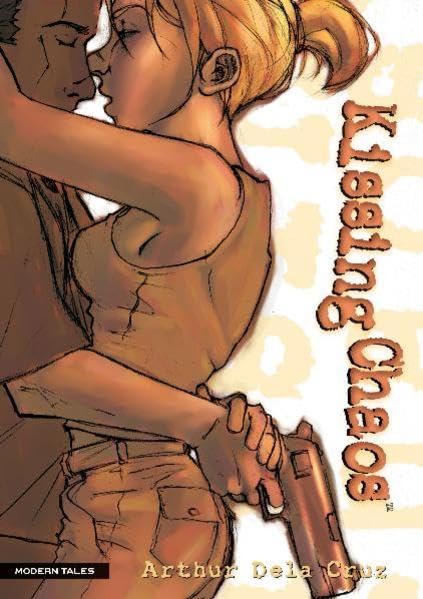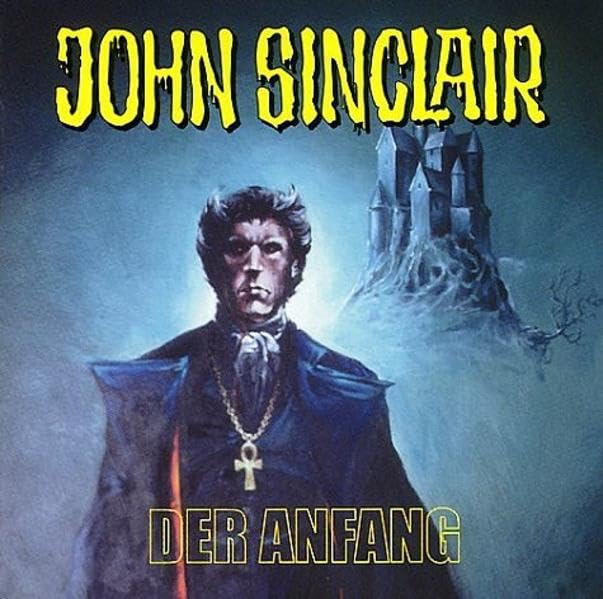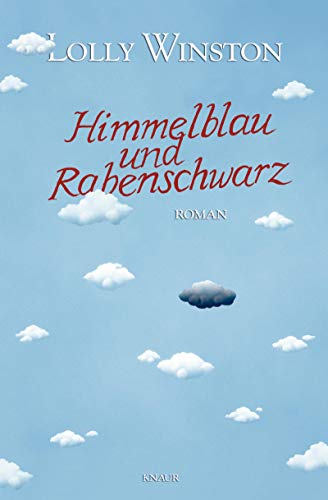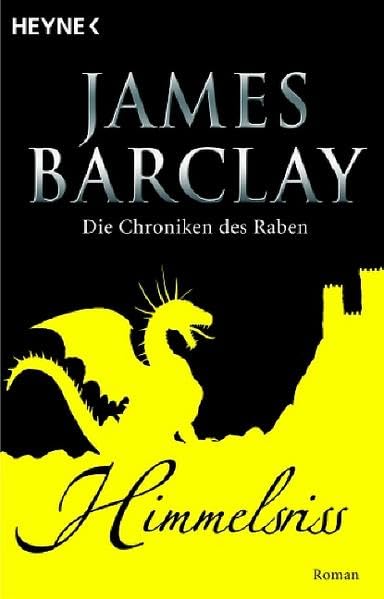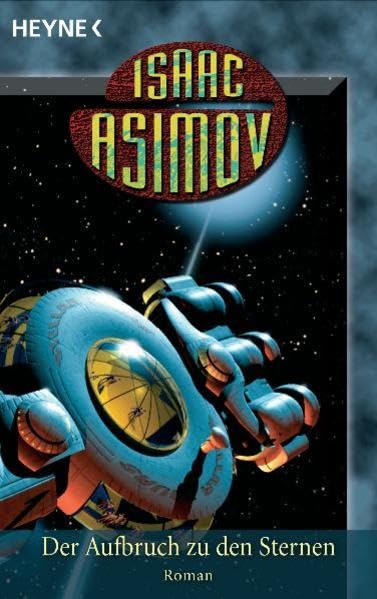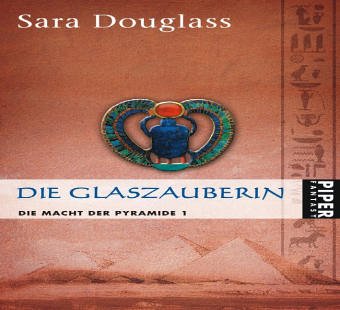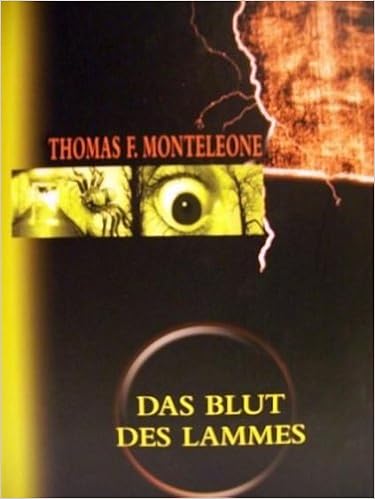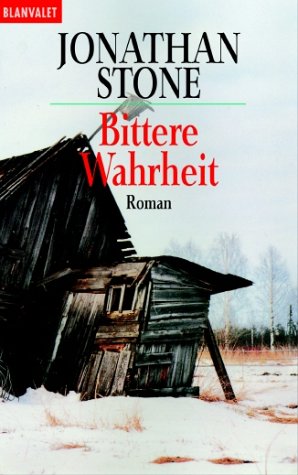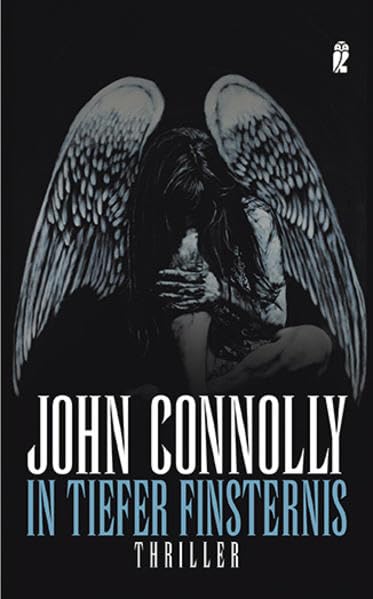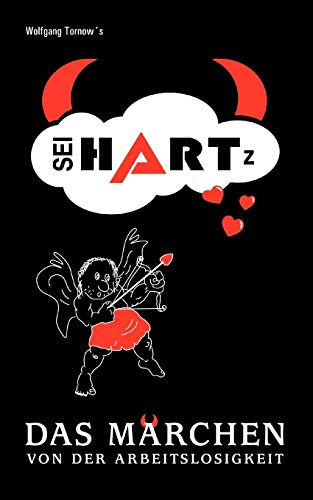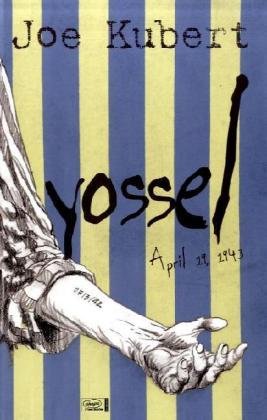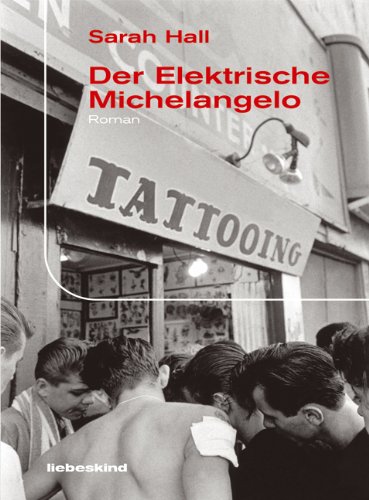Nach wie vor beschäftigt uns die _Rechtschreibreform_. Auch die als unumstritten geltenden Teile der Reform (wie Groß- und Kleinschreibung) könnten nach Auskunft des Vorsitzenden des „Rats für deutsche Rechtschreibung“, Hans Zehetmair, noch nachgebessert werden. Interessant sind auch die beginnenden juristischen Auseinandersetzungen. In Oldenburg hatte eine Schülerin dafür geklagt, dass sie in ihren Klassenarbeiten die alte Rechtschreibung nicht als Fehler gewertet bekommt. Im September entschied das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg, dass sie weiterhin die alte Rechtschreibung verwenden darf. Das Gericht bekräftige seine Rechtsauffassung, wonach Schüler Anspruch darauf haben, in der Rechtschreibung unterrichtet zu werden, die in der Gesellschaft allgemein praktiziert wird. Den Schülern dürfen nur Regeln beigebracht werden, die „der Schreibpraxis entsprächen“. Die „allgemeine Akzeptanz“ der neuen, 2004 modifizierten Regeln sei aber zweifelhaft.
Jeder kennt das Phänomen: Preisgünstige neue Bücher erhalten einfach einen Stempel „_Mängelexemplar_“ und werden dann viel günstiger verkauft. Dieser Praxis wurde nun Ende Juli durch ein Grundsatzurteil vom Oberlandesgericht Frankfurt ein Ende gesetzt. Das bloße Kennzeichnen eines neuen Buches als Mängelexemplar rechtfertigt ab sofort nicht mehr die Aufhebung der Preisbindung. Die Verantwortung für die Einhaltung der Preisbindung liegt dabei beim Letztverkäufer. Ein Sortimenter muss nun also genau prüfen, ob Titel, die er als Mängelexemplare eingekauft hat und weiter anbietet, auch tatsächlich Mängel aufweisen. Er kann sich nicht mehr auf den Standpunkt stellen, gutgläubig gehandelt zu haben. Wahrscheinlich wird nun die Zahl der Mängelexemplare deutlich sinken und verschiedene Preiskämpfe werden unterbleiben. Echte Mängelexemplare unterliegen natürlich weiterhin nicht der Preisbindung.
_Harry Potter_ ging mit dem neuesten Band zwar wie gewohnt sofort auf den ersten Platz der Bestseller-Listen, aber das Interesse flaute diesmal schon zwei Wochen nach dem Erstverkaufstag ab, der große Boom scheint vorbei zu sein. Die Preisnachlässe bei Harry Potter beschäftigen nunmehr auch das britische Parlament, da es zu bis zu 70 % Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis kam. Zum Schutz des Buchhandels müssten Autoren und Verlage ihren Vertriebspartnern solch „exzessive Nachlässe“ untersagen. Das wäre aber ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Helfen würde ein fester Buchpreis wie in Deutschland, der war aber in England 1995 zu Fall gebracht worden.
Religiöse Bücher boomen ebenfalls, seit Harry Potter auftauchte, aber seit dem Tod von Papst Johannes Paul II. und der Wahl des _Papstes Benedikt XVI._ verkauft sich vor allem und überraschend das katholische Thema wieder wie nur selten in den letzten Jahrzehnten. Die Nachfrage nach den Papstbüchern ebbt einfach nicht ab, wohl auch wegen des in Köln stattgefundenen Weltjugendtages. Dort kaufte die Jugend selbst aber wenig Bücher, deren Interesse lag eindeutig bei Musik-CDs.
Wie bereits berichtet, steigt demnächst „Focus“ ins _Hörbuch-Download-Geschäft_ ein. Bevor allerdings „Claudio“ (das Projekt von Focus mit dem Hörverlag) ins Netz ging, kam Ende August nach den bisherigen zwei Anbietern Soforthoeren.de und Audible.de ein anderer neuer Anbieter. Diadopo.de geht mit 300 Titeln ins Netz, und den Vorsprung zu den Vorgängern wollen diese Anbieter mit vielfältigen redaktionellen Inhalten und günstigen Konditionen wettmachen.
_Hörbuch-Automaten_: In Deutschland stehen bereits etwa 700 DVD-Automaten, und wer in nächster Zeit die Augen aufmacht, wird in den Städten auch Hörbuchautomaten mit je nach Größe Platz für 400 bis 800 Hörbücher finden. An einer Buchautomatenentwicklung wird auch bereits gearbeitet. In Frankreich werden Taschenbuchautomaten derzeit schon in Metro-Stationen getestet. Verläuft dort der Test gut, folgen Bahnhöfe, Krankenhäuser, Schulen und Universitäten.
Die Agentur |MEMA Messe & Marketing| veranstaltet vom 10. bis 12. November 2006 in der Oberschwabenhalle Ravensburg erstmals die _Hörbuchmesse Hearing 2006_. Die Veranstalter rechnen mit ca. 60 Ausstellern und 5.000 Besuchern. Auf der Messe (Ausstellungsfläche: 3.000 Quadratmeter) sollen alle Themengebiete rund um das Medium Hörbuch angeboten werden. Zudem soll ein Rahmenprogramm mit Lesungen, Voice-Castings, Vorträgen etc. Besucher anlocken. Das Angebot der Messe richtet sich am ersten Tag an den Fachhandel; an den beiden darauf folgenden Tagen direkt an den Endverbraucher. Die Mehrheit der Hörbuchverlage steht dennoch dieser Messe sehr kritisch gegenüber. Fortwährende neue Messen sind für sie nicht leistbar und man konzentriert sich weiterhin auf Leipzig und Frankfurt. Der Markt für Hörbücher geht zwar stetig nach oben, scheint nun aber im Ganzen doch überschätzt zu werden. Es braucht nicht noch weitere Regionalmessen, sondern wichtig sind die bisherigen drei überregionalen – wobei schon da die Hörbuchmesse auf der LitCologne unverändert umstritten bleibt.
Reinhilde Ruprecht, bis Ende 2004 noch Verlegerin von Vandenhoeck & Ruprecht, hat ihren eigenen Verlag gegründet: _Edition Ruprecht_ startet 2006 mit Titeln eines überwiegend geisteswissenschaftlichen Programms.
15 Jahre alt ist nunmehr schon _Faber & Faber Leipzig_, den nach der Wende der frühere „Aufbau“-Verleger Elmar Faber mit seinem Sohn Michael Faber leitet. Bis 1992 stand Elmar Faber an der Spitze von „Aufbau“, dem auch so genannten „Suhrkamp des Ostens“.
Der Verlag _Vittorio Klostermann_ durfte 75-jähriges Jubiläum begehen. Am 1.10.1930 gründete der 28-jährige Vittorio Klostermann seinen Verlag in Frankfurt am Main, für die damaligen Wirtschaftsverhältnisse eine sehr ungünstige Zeit. Zudem war drei Jahre später die Machtergreifung Adolf Hitlers, und einige Autoren der ersten Stunde wie Herbert Marcuse, Karl Löwith, Kurt Rietzler und andere mussten fliehen. Zwölf Jahre bestand das Dritte Reich und das Verlagsprogramm blieb eine Gratwanderung. Bücher von Otto J. Hartmann und Rudolf Hauschka wurden von der Gestapo beschlagnahmt. Hanns Wilhelm Eppelsheimer verlor seine Anstellung, weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war. Werner Krauss wurde zum Tode verurteilt und konnte nur dank des energischen Eintretens von Hans-Georg Gadamer und seinen Freunden überleben. Der Verlag wich auf ideologiefernere Gebiete aus, verlegte zoologische und finanzgeschichtliche Literatur. Juristische Quellentexte und die „Philosophischen Texte“, die Gadamer betreute, wurden für das Studium an der Front und später in den amerikanischen Kriegsgefangenenlagern benötigt. Der Verlag wurde daher dann bis zu seiner Schließung 1944 sogar als „kriegswichtiger“ Betrieb eingestuft. Da Vittorio Klostermann aber keine Nazi-Umtriebe nachsagbar waren, konnte dieser mit Lizenz der amerikanischen Militärregierung in Frankfurt 1946 neu beginnen. Das war die Zeit der goldenen Jahre, die Bevölkerung hungerte nach guter Literatur und die Höhe der Druckauflagen wurde allein durch die Papierbewilligungen begrenzt. 1978 verstarb Vittorio Klostermann, aber die beiden Söhne waren bereits in die Verlagsarbeit integriert. Der ältere Bruder starb 1992, und seitdem leitet Vittorio E. Klostermann allein den Verlag, dessen Schwerpunkte Philosophie, Rechtsgeschichte, Literaturwissenschaft und Fachliteratur für Bibliothekare sind. Alles nicht ohne Schwierigkeiten, denn Deutsch geht als Wissenschaftssprache im Ausland seit Jahrzehnten drastisch zurück und die notwendigen Auflagenhöhen sind nur durch den starken Exportanteil (Japan, USA, Italien u. a.) zu erreichen. Dennoch steht für den Verlag die Qualität der Bücher weiterhin vor den Interventionen des Marketings. Im Internet findet man ihn unter http://www.klostermann.de.
|Droemer/Knaur| hat sich vom _Battenberg Verlag_ getrennt und ihn an den H. Gietl Verlag verkauft. Battenberg bringt jährlich zehn Novitäten für Münzliebhaber heraus. Mit dem Verkauf will Droemer seine Strategie einer populären Gesamtausrichtung der Programme fortsetzen.
Wie wir berichteten, hatte sich |Rowohlt| vom „Kursbuch“ getrennt. Das erste neue „_Kursbuch_“ erschien nun zum 25. August unter dem Dach des _Zeitverlags_. Herausgeber sind Michael Naumann von der „Zeit“ und, wie schon zuvor, Tilman Sprengler. Das 140- bis 150-seitige und zehn Euro teure Magazin ist jetzt vierfarbig, hat ein kleineres Format und erscheint wie bisher vierteljährlich. Die Auflage, die bei Rowohlt zuletzt auf weniger als 10.000 Exemplare abgesackt war, liegt zum Neustart bei 25.000 Exemplaren. Sie soll verstärkt über den Kiosk vertrieben werden. Das kulturpolitische Blatt ist seit der 68er-Gründerzeit berühmt, und niemand konnte wirklich verstehen, wie Rowohlt dieses Projekt einfach einstellen konnte.
Eigentlich sollte auch „_Die andere Bibliothek_“ bei Eichborn wechseln, worüber wir ebenfalls schon ausführlich berichteten. Es kam deswegen ja zu juristischen Auseinandersetzungen, und das Oberlandesgericht Frankfurt hat nun entschieden, dass die fristlose Kündigung der Vereinbarung durch Hans Magnus Enzensberger nicht gültig ist und er nicht als Herausgeber der von „FAZ“ und |dtv| geplanten _Frankfurter Allgemeinen Bücherei_, die im November starten soll, fungieren darf. Die FAZ hat aufgrund dieses Urteils beschlossen, das Buchprojekt zunächst zurückzustellen.
Die _Brigitte-Edition_, eine 26-bändige, von Elke Heidenreich zusammengestellte Buchreihe, lief wie erwartet gut an. Der erste Band (Enquists „Der Besuch des Leibarztes“) kam sofort in die „Focus“-Bestsellerliste. Den Startauflagen der ersten Titel von 50.000 Exemplaren folgten sofort Nachdrucke.
Nun startet auch der _Stern_ Ende des Jahres eine preiswerte Krimi-Bibliothek mit 24 Romanen. Vertriebspartner ist |Random House|, also ein Schwesternunternehmen aus dem Hause Bertelsmann.
Derzeit laufen die Comic-Editionen von _Bild_ mit |Weltbild| und der _FAZ_.
_Heyne_ startet im November eine neue Taschenbuchreihe: _Heyne Hardcore_. Vorzeitig kam bereits – aufgrund des Dokumentarfilms „Inside Deep Throat“ – wieder „Die Wahrheit über Deep Throat“ von Linda Lovelace heraus. Die neue Reihe richtet sich an Leser, die sich für anspruchsvolle, aufsehenerregende Titel interessieren – Titel, die das Potenzial zum Kultbuch haben. Die Startauflagen bewegen sich zwischen 15.000 und 25.000 Exemplaren pro Titel. In den ersten sieben Titeln geht es um Pornografie, SM-Alpträume, Horror und Drogeneskapaden. Heyne Hardcore spiegelt genau das wider, was in Hollywood oder in der Musikindustrie seit Jahren als extreme Kunst im Mainstream fest verankert ist. Die Bücher sollen provozieren und anecken, aber literarischen Ansprüchen ebenso genügen.
_Egmont Ehapa_ legt das Werk des Disney-Zeichners _Carl Barks_ in einer exklusiven Ausgabe vor. Die „Carl Barks Collection“ ist eine von Geoffrey Blum kommentierte 30-bändige Werkausgabe rund um den Schöpfer von Mickey Mouse und Donald Duck, limitiert auf 3.333 Exemplare in zehn Kassetten, die jeweils drei Bände mit einem Umfang von bis zu 288 Seiten enthalten (Preis pro Kassette: 149 Euro). Die exklusiv gestalteten, neu kolorierten Bände breiten auf mehr als 8.000 Seiten den gesamten Entenhausen-Kosmos aus – darunter auch die verschollen geglaubte Dagobert-Story „King Scrooge I“, die Charles Dickens´ geizigen Mr. Scrooge aus „Ein Weihnachtsmärchen“ zum Vorbild hat. Der deutsche Text der Disney-Storys basiert auf der Übersetzung von Erika Fuchs, die kürzlich mit 98 Jahren verstarb.
Am 22. August ist im Alter von 76 Jahren _Roland Klett_, Mitinhaber des Ernst-Klett-Verlages, gestorben. Im Börsenverein hatte er sich in den 70er Jahren sehr engagiert für Tarifpolitik eingesetzt.
Im September ist auch der Zeichner und Autor _F. K. Waechter_ im Alter von 68 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Er war Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule und des Satire-Magazins „Titanic“, schrieb rund 40 Bücher für Kinder und Erwachsene und ebenso viele Theaterstücke, an deren Inszenierungen und Bühnenbildern er mitwirkte. Richtungsweisend waren seine Bücher „Anti-Struwwelpeter“, „Opa Huckes Mitmach-Kabinett“ und „Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein“.
Die Zahl der Aussteller der kommenden _Frankfurter Buchmesse_ vom 19. – 23.Oktober ist weiter gewachsen, und in diesem Jahr wurde erstmals die Marke von 7.000 Ausstellern überschritten. Premiere haben in diesem Jahr eine Pressemesse, die Frankfurter Antiquariatsmesse und die Ausstellung „Spiele & Spielen“ in Kooperation mit der Spielwarenmesse Nürnberg.
Vor Beginn der Frankfurter Buchmesse, am 17. Oktober, wird der neue _Deutsche Buchpreis_ für den besten Roman des Jahres verliehen, ausgewählt aus 138 Romanen. (www.deutscher-buchpreis.de) Von diesen wurden am 19. September bereits sechs Titel vorgestellt, die es geschafft haben, in die Endrunde zu gelangen. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert – 2.500 Euro fließen an jeden weiteren Titel von den sechsen der Shortlist. Mit dem Deutschen Buchpreis will der Börsenverein eine Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman etablieren, die sich an Vorbildern wie dem Prix Concourt in Frankreich oder dem britischen Man Booker-Prize messen lassen soll. Zur Preisverleihung stellt die Stadt Frankfurt den Kaisersaal im Frankfurter Römer zur Verfügung. Gert Scobbel, Grimme-Preisträger und Moderator der 3sat-Sendung „Kulturzeit“, führte durch die einstündige Veranstaltung, die den kulturellen Auftakt der Buchmesse darstellte. Der Börsenverein hofft, dass sein jüngstes Projekt, ähnlich wie der renommierte Friedenspreis, nach und nach internationale Strahlkraft entwickelt – und auf diese Weise der deutschsprachigen Literatur im Ausland den Rücken stärken kann.
Nominiert wurden:
Thomas Lehr, „42“, Aufbau-Verlag 2005, 368 S., 22,90 Euro
Arno Geiger, „Es geht uns gut“, Hanser Verlag 2005, 392 S., 21,50 Euro
Gila Lustiger, „So sind wir“, Berlin Verlag 2005, 260 S., 18 Euro
Daniel Kehlmann, „Die Vermessung der Welt“, Rowohlt 2005, 304 S., 19,90 Euro
Friedrich Mayröcker, „Und ich schüttelte einen Liebling“, Suhrkamp Verlag 2005, 19,80 Euro
Gert Loschütz, „Dunkle Gesellschaft“, Frankfurter Verlagsanstalt 2005, 220 S., 19,90 Euro
Die _Friedenspreisverleihung_ dagegen stellt das eventuell künftige EU-Mitgliedsland Türkei einmal mehr ins völlige Abseits. Mit Bestürzung haben der Stiftungsrat Friedenspreis und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels zur Kenntnis genommen, dass die türkische Staatsanwaltschaft _Orhan Pamuk_, Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2005 , wegen „öffentlicher Herabsetzung des Türkentums“ angeklagt hat. Dabei droht eine Haftstrafe von mehreren Jahren. „Wir protestieren und fordern den türkischen Staat auf, das Verfahren gegen Orhan Pamuk einzustellen, denn die Freiheit des Wortes gehört zu den Grundwerten einer demokratischen Gesellschaft“, so Dieter Schormann, Vorsteher des Börsenvereins. Auch das PEN-Zentrum Deutschland kritisiert: „Die Anklage ist ein brutaler Angriff auf die Meinungsfreiheit. Die Türkei kann ihre inneren Konflikte nur lösen, wenn sie sich endlich auch den dunklen Seiten ihrer Geschichte stellt“. Die türkische Staatsanwaltschaft legt dem Friedenspreisträger in ihrer Anklage Interview-Äußerungen in einer Schweizer Zeitung zum Völkermord an den Armeniern zur Last, der in der Türkei bis heute offiziell nicht anerkannt wird. Pamuk hatte davon gesprochen, dass in der Türkei eine Million Armenier und 30.000 Kurden umgebracht worden seien. Orhan Pamuk wird am 23. Oktober 2005 in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. In der Begründung des Stiftungsrats heißt es: „Mit Orhan Pamuk wird ein Schriftsteller geehrt, der wie kein anderer Dichter unserer Zeit den historischen Spuren des Westens im Osten und des Ostens im Westen nachgeht, einem Begriff von Kultur verpflichtet, der ganz auf Wissen und Respekt vor dem anderen gründet. So eigenwillig das einzigartige Gedächtnis des Autors in die große osmanische Vergangenheit zurückreicht, so unerschrocken greift er die brennende Gegenwart auf, tritt für Menschen- und Minderheitenrechte ein und bezieht immer wieder Stellung zu den politischen Problemen seines Landes.“ Die Freiheit des Wortes ist Grundlage demokratischer Gesellschaften und damit auch der freien verlegerischen und buchhändlerischen Tätigkeit. Auch der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entstand vor dem Hintergrund dieses Wertes. Er würdigt seit 1950 Persönlichkeiten, die mit ihrer literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Arbeit als Friedensstifter wirken. Anderen türkischen Trägern des deutschen Friedenspreises ging es schon ähnlich: _Yasar Kemal_, der Friedenspreisträger von 1997, wurde 1995 zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Dass nun zehn Jahre später die Staatsanwaltschaft in Istanbul erneut ein Exempel statuieren will, wirft kein gutes Licht auf einen EU-Beitritt der Türkei.
Es gibt nach Frankfurt und Leipzig und der anders gelagerten LitCologne in Köln eine weitere deutsche Buchmesse: _Buch! Berlin_ bietet fünf Wochen nach der Frankfurter Messe vom 25. – 27.November deutschen und internationalen Verlagen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, inklusive Direktverkaufserlaubnis am Stand. Die Buchhandlungen in Berlin sind verärgert deswegen. Neben den Verlagsständen gibt es umfangreiches Programm auf mehreren Lesebühnen, darunter Buchvorstellungen für Kinder und Jugendliche und eine Ausstellung für Comic-Art.
|Das Börsenblatt, das die hauptsächliche Quelle für diese Essayreihe darstellt, ist selbstverständlich auch im Internet zu finden, mit ausgewählten Artikeln der Printausgabe, täglicher Presseschau, TV-Tipps und vielem mehr: http://www.boersenblatt.net/.|